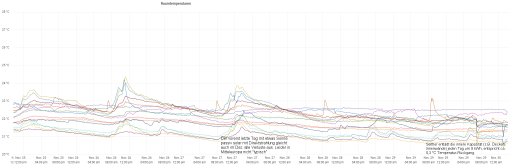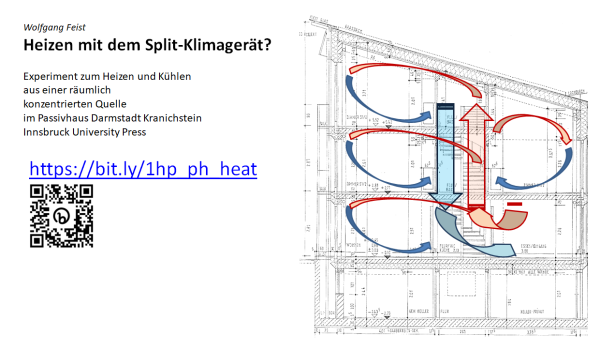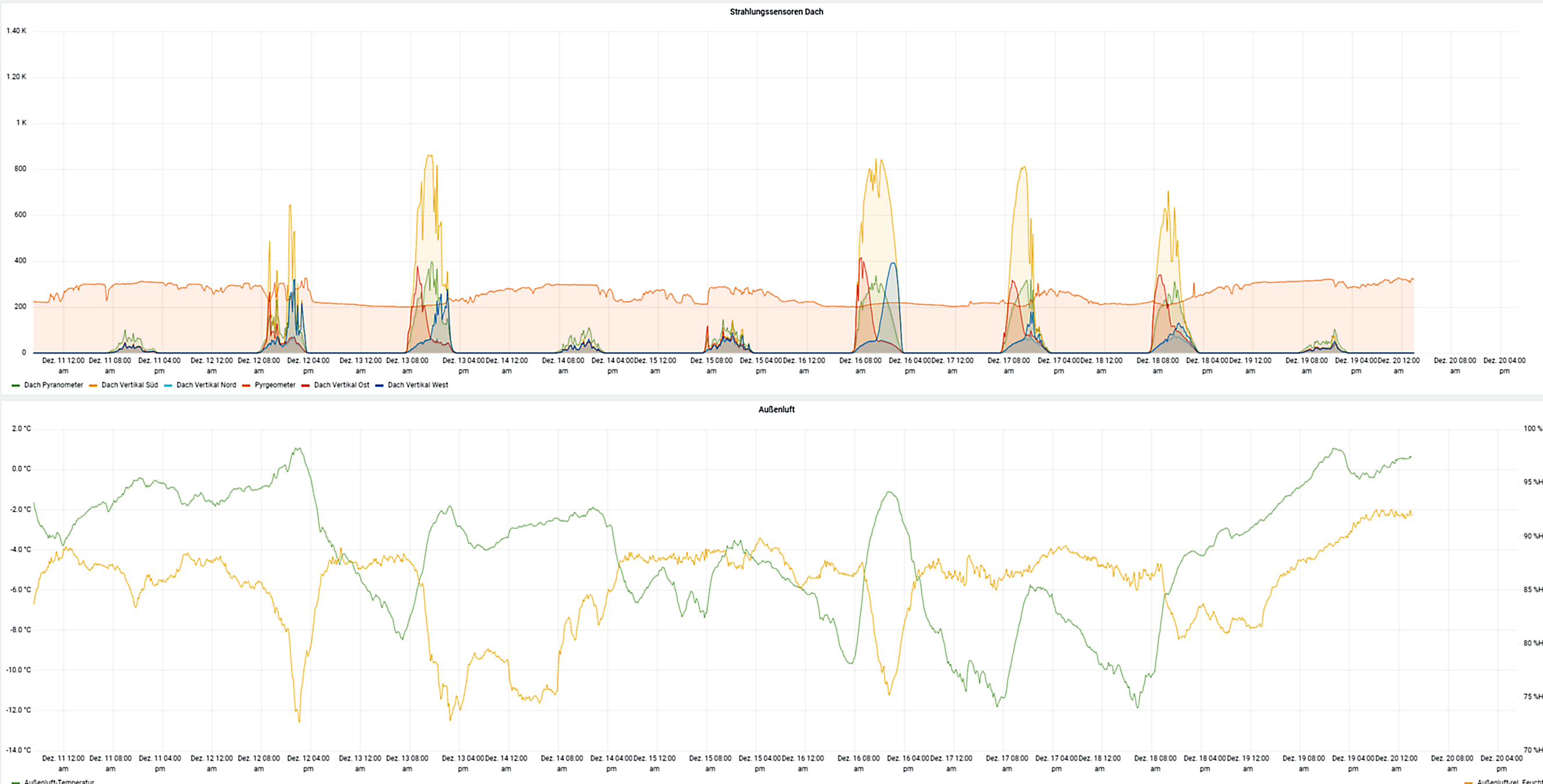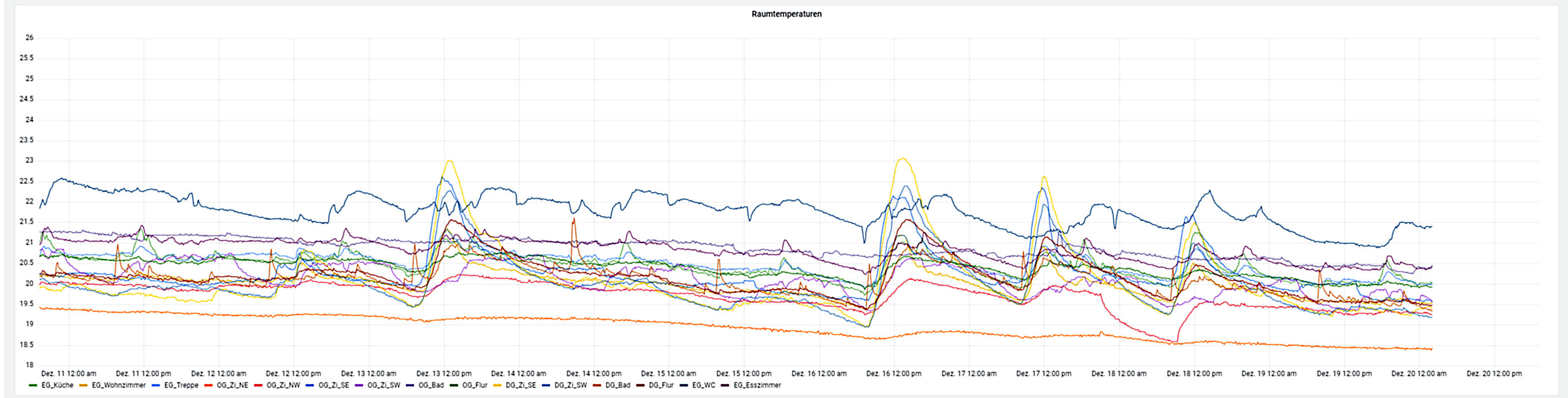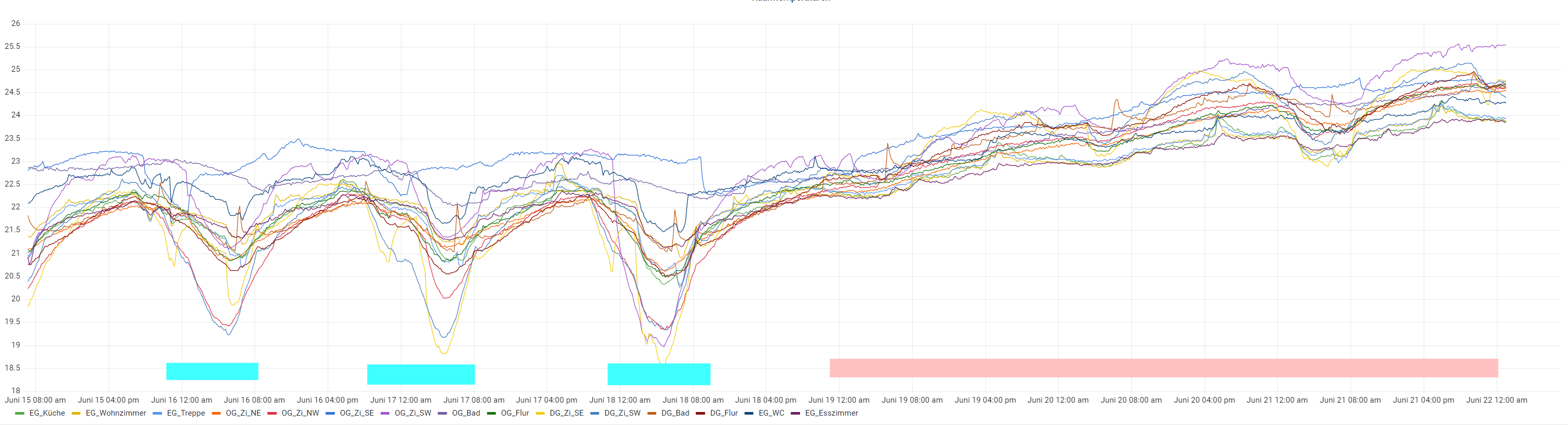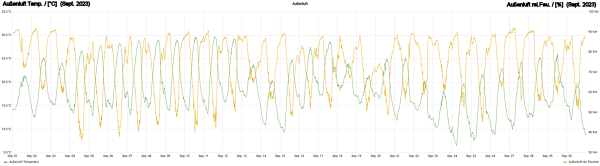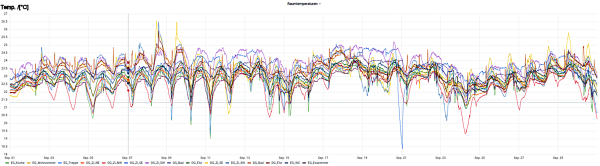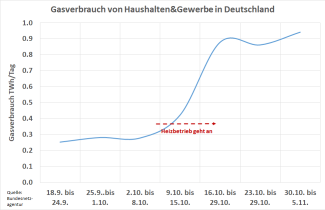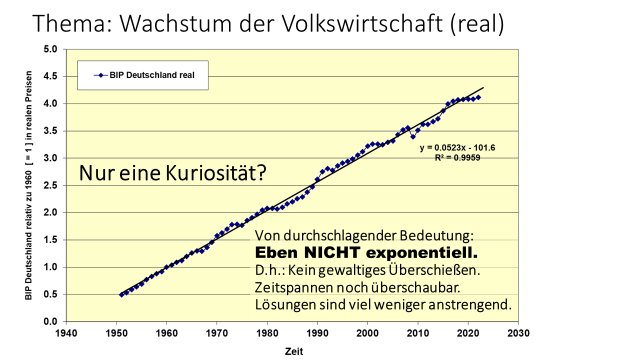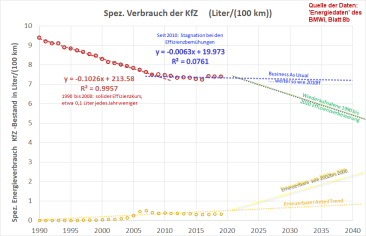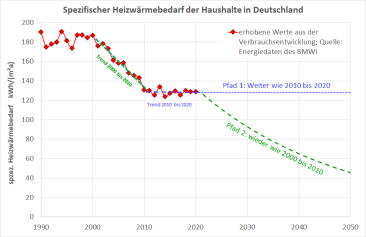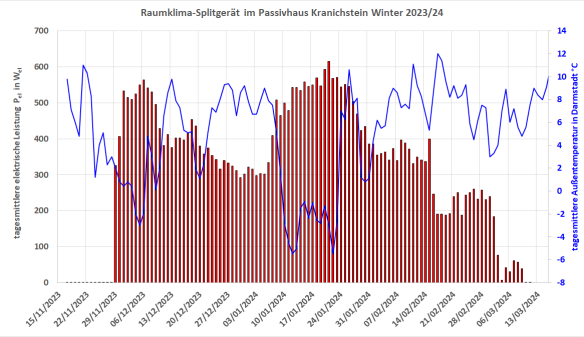Inhaltsverzeichnis
Das Passivhaus Kranichstein im Winter 2022/23 besonders sparsam heizen
Schnelllink Zur aktuell letzten Eintragung
 Seit 2016 wird die gesamte Wohneinheit auf der Westseite des Passivhauses in Darmstadt Kranichstein allein mit einem sog. „Mini-Split-Gerät“ beheizt. Wie das installiert wurde ist hier dokumentiert: Installation eines Splitgerätes. Seit 6 Jahren wird das Gerät mit laufenden Aufzeichnungen messtechnisch verfolgt, eine Publikation zur den Ergebnissen gibt es hier: [Feist 2022] Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Kurz gefasst: das funktioniert durchaus sehr gut, im Sommer wie im Winter und die Stromverbrauchswerte des Mini-Split-Gerätes sind im Passivhaus extrem gering; das ist also eine sehr kostengünstige Heiz-Variante.
Seit 2016 wird die gesamte Wohneinheit auf der Westseite des Passivhauses in Darmstadt Kranichstein allein mit einem sog. „Mini-Split-Gerät“ beheizt. Wie das installiert wurde ist hier dokumentiert: Installation eines Splitgerätes. Seit 6 Jahren wird das Gerät mit laufenden Aufzeichnungen messtechnisch verfolgt, eine Publikation zur den Ergebnissen gibt es hier: [Feist 2022] Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Kurz gefasst: das funktioniert durchaus sehr gut, im Sommer wie im Winter und die Stromverbrauchswerte des Mini-Split-Gerätes sind im Passivhaus extrem gering; das ist also eine sehr kostengünstige Heiz-Variante.
2022 wurde auf Grund der Kriegssituation eine weltweite Erdgas-Krise ausgelöst, die insbesondere Deutschland schwer getroffen hat; dies war der Fall, weil Deutschland gerade bei der Heizung in sehr hohem Maß von Erdgas abhängig war und noch ist: etwa 50% des Heizenergiebedarfs wurde über fossiles Gas gedeckt; diese Gas kam zu einem sehr hohen Prozentsatz (um 66%) ziemlich kostengünstig aus Russland - und diese Lieferung fiel im Zuge des Jahres 2022 schließlich vollständig aus. Das erklärt eine ernste Folgekrise, verbunden mit extremen Steigerungen der Kosten für das fossile Gas aber auch für andere Endenergieträger. Allein schon wegen des Mengengerüstes, aber auch wegen der Kosten, war deshalb ein besonders sparsames Verhalten, gerade bei der Raumwärme, angesagt. Nun ist schon allein durch die geringe Heizleistung im Passivhaus und durch die Wärmepumpe im Splitgerät der Stromverbrauch dieses Gerätes im vorliegenden Fall extrem gering:
zwischen 700 und 1100 kWhel /Jahr für die gesamte Wohnung
entspr. Kosten von unter 400 € im gesamten Jahr.
Das heißt um 5,5 kWh/(m²a) Stromverbrauch für die Heizung. Davon ist heute schon weniger als die Hälfte fossil erzeugt, weniger als ein Sechstel mit Erdgas. Das gilt bei mittleren Innentemperaturen im Winter von rund 21,5 °C, die dabei dauerhaft gehalten wurden (in fast allen Räumen). Trotzdem nahmen wir die diesjährige Situation als Anlass für eine weitere Untersuchung: Wenn wir durch systematisch verbessertes Kleidungsniveau auch im Passivhaus ein besonders sparsames Nutzerverhalten umsetzen - wie weit kommen wir damit auch hier noch mehr im Wärmepumpen-Stromverbrauch herunter? Dazu sind die folgenden Aufzeichnungen jeweils aktuell dokumentiert worden - die folgenden Absätze sind daher im Präsenz geschrieben und geben die jeweils zeitnah vorliegende Situation wieder.
Wieviel war es denn nun im Winter 2022/23? Abkürzungs-Link zum Messergebnis.|
Vor dem 5. Dezember 2022: Keine Heizung
Die elektronisch aufgezeichneten Temperaturen an den Tagen vor der Inbetriebnahme: Bis zum 26. November lagen die gemessenen Temperaturen in allen Zonen des Gebäudes zwischen 21 und 23 °C (vollständig ohne Heizung). Immer, wenn direkte Solarstrahlung auf der Südseite einfallen konnte (so z.B. am 26. und 27. November) hat sich das Haus dadurch wieder erkennbar erwärmt1) .Seit dem 28. November kam die Sonne dann allerdings nicht mehr hinter den Wolken hervor - und bei Außentemperuren zwischen 3 und 6°C2) beträgt der Wärmeverlust dann um 9 kWh jeden Tag. Mit der Wärmekapazität der Innenwände und Decken entspricht das einer mittleren Temperaturabnahme von rund 0,3 Grad täglich. Das ist dann immer noch ein paar Tage 'durchzuhalten'; irgendwann würde es dann aber ungemütlich kalt; bevor das passiert, werden wir das Klima-Split-Gerät einsetzen, um weitere Verluste zu kompensieren.
Am 5. Dezember 2022: das Mini-Split-Gerät im Erdgeschoss in Betrieb genommen
Morgens fanden wir im Esszimmer (Standort der Inneneinheit des Splitgerätes) eine „Raum“-Temperatur von 19,4 °C vor. Das ist in einem Passivhaus eine durchaus noch komfortable Temperatur, wenn ein Pullover getragen wird, eine warme Hose und Hausschuhe mit dicken Sohlen. Behaglich ist es dann vor allem, weil es kaum Unterschiede zwischen den Temperaturen im Raum gibt: Stühle, Tischplatten, Innenwände und selbst die Außenwände und der EG-Fußboden haben davon maximal um ein paar Zehntel Grad abweichende Temperaturen: Es gibt also keine Strahlungstemperatur-Asymmetrie und auch keinen thermischen Antrieb für Zugerscheinungen. Weitere Temperaturabsenkungen wären hier durchaus auch noch auszuhalten, allerdings müsste dazu eine weitere Kleidungsanpassung erfolgen.
Weil die generelle Vorgabe für Büros in der öffentlichen Hand in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bei 19°C liegt, sehen wir bei Temperatur-Sollwerten in diesem Bereich jetzt eine sinnvolle Zielsetzung für unseren neuen Selbstversuch: In diesem Intervall zwischen 19 und knapp über 20°C wollen wir die Räume in dieser Jahreszeit halten und beobachten, was es dazu an Energieaufwand benötigt.
Das Splitgerät war zuletzt am 31.08.2022 in Betriebsbereitschaft, dabei für die Kühlung, gewesen und wurde um 9:29 MEWZ am 5.12. im Betriebszustand:
„Heizung, automatischer Volumenstrom, interne thermostatische Regelung auf 21°C“
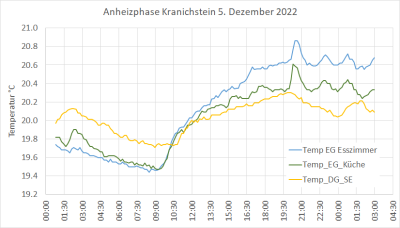 Abb. 1 in Betrieb genommen. Das erfolgt ganz einfach über Freigabe des Netzstroms über einen Schalter. Die Einstellungen werden dann über die original-Fernbedienung vorgenommen, das ist intuitiv und nicht wesentlich anders als die Bedienung eines Thermostatventils3) . Das Gerät lief sofort an und zog in den ersten 30 Minuten (auch zum Anheizen der Geräteteile) zwischen 424 und 1140 Watt elektrisch. Um 10:00 lag dann die Raumtemperatur im Aufstellraum bereits bei 19,6 °C. Wie wir schon au den vorausgehenden Jahren wissen, werden über die folgenden Tage durch das hier vorhandene offene Treppenhaus auch alle anderen Räume Zug um Zug „mitgenommen“. Das System aus Heiztechnik und Gebäude ist sehr träge - deshalb warten wir auch nicht bis die Temperaturen überall unter 19° liegen sondern fangen schon jetzt an, dem Temperaturabfall ein wenig gegen zu steuern. Die Räume, in denen wir uns jeweils aufhalten, liegen in den Temperaturen dann noch einmal um ein paar Zehntel Grad über dem Mittel, weil jede Person eben auch selbst nennenswert4) zum Warmhalten beiträgt - solche Leistungen spielen in gut wärmegedämmten Gebäuden eben dann bereits eine Rolle, und selbst die wenigen Watt, die als passiv solare Einstrahlung5) durch die Fenster dazu kommen, helfen, tagsüber 2 bis 3 Zehntel Grad 'mehr' zu erhalten als am frühen Morgen.
Abb. 1 in Betrieb genommen. Das erfolgt ganz einfach über Freigabe des Netzstroms über einen Schalter. Die Einstellungen werden dann über die original-Fernbedienung vorgenommen, das ist intuitiv und nicht wesentlich anders als die Bedienung eines Thermostatventils3) . Das Gerät lief sofort an und zog in den ersten 30 Minuten (auch zum Anheizen der Geräteteile) zwischen 424 und 1140 Watt elektrisch. Um 10:00 lag dann die Raumtemperatur im Aufstellraum bereits bei 19,6 °C. Wie wir schon au den vorausgehenden Jahren wissen, werden über die folgenden Tage durch das hier vorhandene offene Treppenhaus auch alle anderen Räume Zug um Zug „mitgenommen“. Das System aus Heiztechnik und Gebäude ist sehr träge - deshalb warten wir auch nicht bis die Temperaturen überall unter 19° liegen sondern fangen schon jetzt an, dem Temperaturabfall ein wenig gegen zu steuern. Die Räume, in denen wir uns jeweils aufhalten, liegen in den Temperaturen dann noch einmal um ein paar Zehntel Grad über dem Mittel, weil jede Person eben auch selbst nennenswert4) zum Warmhalten beiträgt - solche Leistungen spielen in gut wärmegedämmten Gebäuden eben dann bereits eine Rolle, und selbst die wenigen Watt, die als passiv solare Einstrahlung5) durch die Fenster dazu kommen, helfen, tagsüber 2 bis 3 Zehntel Grad 'mehr' zu erhalten als am frühen Morgen.
Der Stromverbrauch am ersten Tag (bis 6.12. 9:29) war 10,7 kWh entsprechend einer durchschnittlichen 24-h-Leistung von rund 350 Wel . Daraus erzeugt die Wärmepumpe im Splitgerät in der vorliegenden Konfiguration etwa 800 Wtherm an Heizwärme („thermisch“). Das ist auch etwa die Leistung, die dieses Haus im Durchschnitt gerade braucht, um die Netto-Verluste nach außen6) auszugleichen7) .
Einordnung: Der mittlere Stromverbrauch für alle übrigen Anwendungen (wie Kühlschrank, Licht, Spülmaschine, Arbeitsplatzrechner etc.) betragen in dieser Wohnung rund 350 Wel im Winter8) . Der aktuelle Verbrauch der Klimageräte-Heizung ist durchaus ein realitätsnaher Dezemberwert: Er verdoppelt etwa die aus dem Netz entnommene Leistung gegenüber dem Jahresdurchschnitt9) ; obwohl der Heizenergieverbrauch in der Jahressumme im Passivhaus10) nur rund ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs ausmacht: Heizung ist eben eine „Wintersache“, das ist eigentlich bekannt, es wird leider sehr oft verdrängt. In nicht so gut gedämmten Häusern sind die erforderlichen Leistungen (sehr) viel höher: Gegenüber den 350 W können es locker 2000 bis 4000 W sein. Und das sind dann Durchschnittsleitungen eines Haushalts, die 6 bis über 10mal höher liegen als bisher gewohnt.
Diese konkreten Werte illustrieren, wie Energieeffizienz, Umstellen auf elektrische Systeme mit hoher Effizienz (Wärmepumpen) und Erneuerbare Energiekonzepte erfolgreich zusammenwirken, um uns auf Dauer von fossiler Energie unabhängig zu machen.
Am 7. Dezember: Zeitweise schaut die Sonne hinter den Wolken hervor
 Abb. 2 Zunächst das Ergebnis vom 6. Dezember: Da war es schon nicht mehr ganz „so dunkel“ am Himmel wie am Tag zuvor, auch unsere PV-Anlage hat nun fast 4 W11) geliefert; das ist immer noch wenig gegenüber dem typischen Winterstromverbrauch (bereits erwähnt um 350 W)12) .
Abb. 2 Zunächst das Ergebnis vom 6. Dezember: Da war es schon nicht mehr ganz „so dunkel“ am Himmel wie am Tag zuvor, auch unsere PV-Anlage hat nun fast 4 W11) geliefert; das ist immer noch wenig gegenüber dem typischen Winterstromverbrauch (bereits erwähnt um 350 W)12) .
Die mittlere gemessene elektrische Leistungsaufnahme unseres als alleinige Heizung verwendeten Klima-Split-Raumgerätes lag bei
rund 312 Wel.
Trotz niedrigerer Außentemperaturen etwas weniger als am Vortag: Das liegt daran, dass das Gebäude jetzt etwas näher am neuen Fließgleichgewicht ist. Insbesondere die Betondecke über dem EG-Raum mit dem Klimagerät hat sich nun bereits etwas erwärmt - und die Heizanforderung des Gerätes wird dadurch geringer. Allerdings: Bis im gesamten Haus ein Gleichgewicht erreicht wird, dazu werden noch ein paar Tage vergehen - und die werden möglicherweise gleich wieder gestört, denn die Wetterdienste kündigen für die kommende Woche einen Einfall von sibirischer Kaltluft an. Es bleibt spannend.
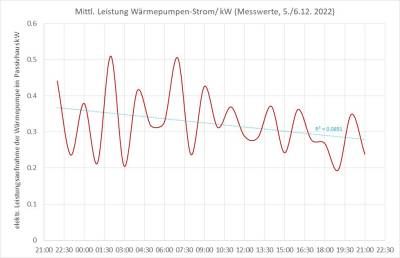 Abb. 3Abb. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der stündlich gemessenen elektrischen Durchschnittsleistung. Das sind rund 104 Watt für jede Person - für den Betrieb der Wärmepumpe zur Heizung, in der Größenordnung noch einmal die gleiche Leistung, die diese Personen auch durch ihren Kalorien-Grundumsatz abgeben. Im Passivhaus ist das für die Winterperiode typisch: Die Leistungen liegen in derselben Größenordnung wie die originelle Leistungsfähigkeit der Personen, wir sind bei menschlichen Maßstäben. Natürlich kommt da der Basis-Stromverbrauch (in gleicher Größenordnung für Computer, Licht, Kühlschrank etc.) dazu. Und der Verbrauch für die Mobilität - der im konkreten Fall aber extrem gering ist, denn wir sind seit gut 2 Jahren vor allem zu Fuß, mit dem Fahrrad und ab und zu mit der Straßenbahn unterwegs. Die Nahrungsaufnahme hat dann noch einmal etwa ein solches Niveau.
Abb. 3Abb. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der stündlich gemessenen elektrischen Durchschnittsleistung. Das sind rund 104 Watt für jede Person - für den Betrieb der Wärmepumpe zur Heizung, in der Größenordnung noch einmal die gleiche Leistung, die diese Personen auch durch ihren Kalorien-Grundumsatz abgeben. Im Passivhaus ist das für die Winterperiode typisch: Die Leistungen liegen in derselben Größenordnung wie die originelle Leistungsfähigkeit der Personen, wir sind bei menschlichen Maßstäben. Natürlich kommt da der Basis-Stromverbrauch (in gleicher Größenordnung für Computer, Licht, Kühlschrank etc.) dazu. Und der Verbrauch für die Mobilität - der im konkreten Fall aber extrem gering ist, denn wir sind seit gut 2 Jahren vor allem zu Fuß, mit dem Fahrrad und ab und zu mit der Straßenbahn unterwegs. Die Nahrungsaufnahme hat dann noch einmal etwa ein solches Niveau.
Bleibt das so? Eine kritische Frage aus den Medien, berechtigt
Heute, am 8. Dezember, ist das Wetter ein wenige kälter und es kommen nur seltener ein paar Sonnenstrahlen. Die Innentemperaturen haben sich in einem Bereich im 20 °C (plus oder minus einige Zehntel Grad) eingependelt. Da wissen wir schon aus den Jahren zuvor, dass das so bleibt - denn, selbst bei einem Kälteeinbruch ist das Klimagerät in der Lage, auch rund die doppelte Heizleistung dauerhaft zu liefern; die Regelung, mit der das derzeit passiert, ist allerdings nicht optimal - aber sie funktioniert. Wer Genaueres zu diesen Erfahrungen wissen möchte, findet dies in der Publikation [Feist 2022].
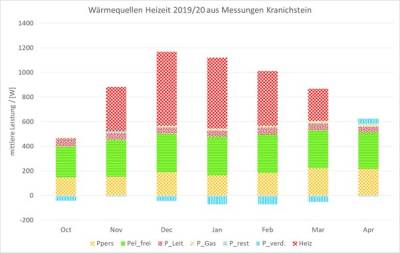 Abb. 4Da finden sich dann auch detaillierte Messdaten zur Wärmeerzeugung, den Stromverbrauchswerten und zur Effizienz des verwendeten Splitgerätes. Welche Wärmemengen im Winter 2019/20 vom Splitgerät und von den inneren Wärmequellen wie Personen, Warmwasserleitungen und Stromverbrauchern erzeugt wurde, zeigt Abb.4. Typischerweise ist die benötigte Heizleistung des Splitgerätes im Dezember am höchsten, im dargestellten Jahr um 600 Watt im Durschnitt), obwohl das nicht der 'kälteste Monat' ist. Wie schon erwähnt, ist für Gebäude dieses Dämmstandards und ausreichenden Fenstern für gutes Tageslicht die Solareinstrahlung mindestens genauso wichtig. Ab Mitte März spätestens ist daher auch „mit Heizen Schluss“ im Passivhaus in Kranichstein. Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes für die Erzeugung dieser Wärme ist um den Faktor des „COP“ (Coefficient Of Performance - 'Arbeitszahl', d.h. das Verhältnis der bereitgestellte Wärme zum eingesetztem Strom) geringer. Für unser Gerät liegt diese Leistungsaufnahme dann im Durchschnitt knapp unter 300 Wel. Das passt zu den Werten, die wir in den letzten Tagen dieses Dezembers gemessen und hier dokumentiert hatten.
Abb. 4Da finden sich dann auch detaillierte Messdaten zur Wärmeerzeugung, den Stromverbrauchswerten und zur Effizienz des verwendeten Splitgerätes. Welche Wärmemengen im Winter 2019/20 vom Splitgerät und von den inneren Wärmequellen wie Personen, Warmwasserleitungen und Stromverbrauchern erzeugt wurde, zeigt Abb.4. Typischerweise ist die benötigte Heizleistung des Splitgerätes im Dezember am höchsten, im dargestellten Jahr um 600 Watt im Durschnitt), obwohl das nicht der 'kälteste Monat' ist. Wie schon erwähnt, ist für Gebäude dieses Dämmstandards und ausreichenden Fenstern für gutes Tageslicht die Solareinstrahlung mindestens genauso wichtig. Ab Mitte März spätestens ist daher auch „mit Heizen Schluss“ im Passivhaus in Kranichstein. Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes für die Erzeugung dieser Wärme ist um den Faktor des „COP“ (Coefficient Of Performance - 'Arbeitszahl', d.h. das Verhältnis der bereitgestellte Wärme zum eingesetztem Strom) geringer. Für unser Gerät liegt diese Leistungsaufnahme dann im Durchschnitt knapp unter 300 Wel. Das passt zu den Werten, die wir in den letzten Tagen dieses Dezembers gemessen und hier dokumentiert hatten.
Merkpunkt: Selbst in einem hocheffizienten Gebäude wie dem Passivhaus ist von etwa Dezember bis Februar der Energieverbrauch für die Heizung immer noch dominant; das führt zu sehr ungleichmäßigen Jahres-Bedarfs-Verläufen. Der Wert (um die 600 Watt im Durchschnitt im Dezember) liegt allerdings im Passivhaus in einer beherrschbaren Größenordnung. Mit Wärmepumpe braucht es im Schnitt um 300 Watt herum zusätzlich, und das ist für das Netz immer verkraftbar, selbst „wenn das alle machen würden“. Wichtig bleibt aber, dass die entsprechenden erneuerbaren Stromerzeuger auch gebaut werden.
9. Dezember: Trotz Kälte nur wenig Wärmeverluste
Am 9. Dezember war es schon wieder etwa 2 °C kälter im Außenbereich - dadurch erhöhen sich natürlich die Wärmeverluste. Die sind tatsächlich näherungsweise proportional zur Differenz aus Innen- und Außentemperatur(en13) ). Der Faktor $ H_e $, mit dem die Wärmeverlustleistung aus der Temperaturdifferenz durch Multiplikation erhalten wird, nennt sich der „spezifische Wärmeverlust“ des Gebäudes. In der Normung wird14) beschrieben, wie dieser sich aus den Wärmeverlustkoeffizienten, den Flächen der Außenbauteile, den Glasflächen und dem Luftaustausch berechnen lässt. Das kann z.B. für unser hier vorliegendes Gebäude mit dem PHPP berechnet werden; es ergeben sich etwa $ H_e $= 82 W/K im vorliegenden Fall15) . Rechnen wir beispielhaft die Gesamtwärmeverluste $ \dot{Q} $ in den letzten Tagen, bei um 3°C außen und 20,4°C innen aus:
$ \dot{Q}=H_e \cdot ( \theta_i - \theta_e ) = $ 82 W/K $ \cdot $ (20,4 - 3 ) K = 1427 W
Diese Wärmeverlustleistung ist bedeutend höher als die vom Splitgerät bereitgestellte Heizwärme von um 720 Watt. Der Rest der Verluste wird durch die von Personen und Geräten und Wasserleitungen16) abgegeben Wärme und durch den, wenn auch derzeit geringen, passiv solaren Beitrag durch die Fenster kompensiert.
In unserem Passivhaus muss die Heizanlage, in diesem Fall das Klima-Splitgerät, offensichtlich nur weniger als die Hälfte der Wärmeverluste kompensieren - der ganze Rest wird durch die Personen selbst, die Abwärme z.B. der Beleuchtung und der Computer sowie der durch die Fenster eingestrahlten Sonnenwärme gedeckt. Weil insbesondere heute, am 9. Dezember 2022, ein recht sonniger Tag war, werden wir morgen etwas zur Solarenergie - aktiv und passiv - berichten.
Passiv solare Gewinne: In Gebäuden mit gutem Wärmeschutz bedeutend
Heute (10. Dezember) ein kleiner Ausflug zum Thema solare Energie - mitten im Dezember, in Deutschland. Das ist der typischerweise strahlungsärmste Monat im Jahr in Mitteleuropa - aber auch dann ist die solare Einstrahlung nicht Null, sie liefert (ein wenig) Energie.
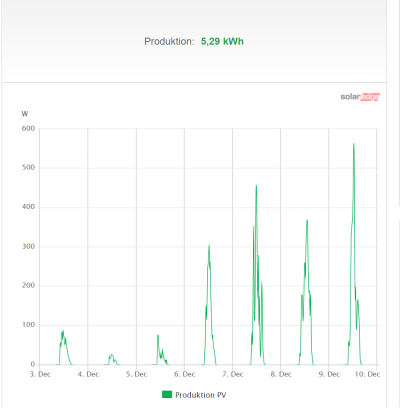 Abb. 5Um eine Vorstellung von den Energiemengen zu bekommen, werfen wir einen Blick auf die Aufzeichnungen der Photovoltaik-Anlage: Da wurde jeden Tag Strom produziert, Abb. 5 zeigt den Verlauf der erzeugten elektrischen Leistung. Die war vom 3. bis 5. Dezember nur sehr spärlich - das ist typisches bewölktes Winterwetter in Darmstadt. Am 10. Dezember dagegen, erreichte die PV-Stromerzeugung durchaus kurzzeitig 550 Watt. Diesen nicht ganz wolkenlosen, aber relativ strahlungsreichen Dezembertag werden wir jetzt genauer anschauen. Die Messdatenerfassung zeigt ein Strahlungsangebot auf die Südfassade von rund 1,2 kWh/(m²d) an diesem Tag17) . Das sind auf die rund 20 m² verglaste Fläche im Süden fast 24 kWhsolar. Allerdings, die kommen nicht alle wirklich „herein“ durch das Fenster; da gibt es Verschattung durch die Nachbargebäude, durch die Balkonbrüstung, es gibt eine Verschmutzung der Scheiben, Strahlung wird teilweise reflektiert, teilweise absorbiert18) - es kommen tatsächlich nur etwa 4,8 kWh wirklich im Innenraum an19) . Das sind aber für die gesamte Wohnung durchaus etwa 200 Watt über 24-Stunden gemittelte Dauerleistung. Ein messbarer Beitrag zur Energiebilanz, der bei insgesamt nur 1427 Watt Wärmeverlusten in dieser Wohnung20) mit gutem Wärmeschutz auch nennenswert etwas beiträgt, nämlich etwa ein Siebtel21) .
Abb. 5Um eine Vorstellung von den Energiemengen zu bekommen, werfen wir einen Blick auf die Aufzeichnungen der Photovoltaik-Anlage: Da wurde jeden Tag Strom produziert, Abb. 5 zeigt den Verlauf der erzeugten elektrischen Leistung. Die war vom 3. bis 5. Dezember nur sehr spärlich - das ist typisches bewölktes Winterwetter in Darmstadt. Am 10. Dezember dagegen, erreichte die PV-Stromerzeugung durchaus kurzzeitig 550 Watt. Diesen nicht ganz wolkenlosen, aber relativ strahlungsreichen Dezembertag werden wir jetzt genauer anschauen. Die Messdatenerfassung zeigt ein Strahlungsangebot auf die Südfassade von rund 1,2 kWh/(m²d) an diesem Tag17) . Das sind auf die rund 20 m² verglaste Fläche im Süden fast 24 kWhsolar. Allerdings, die kommen nicht alle wirklich „herein“ durch das Fenster; da gibt es Verschattung durch die Nachbargebäude, durch die Balkonbrüstung, es gibt eine Verschmutzung der Scheiben, Strahlung wird teilweise reflektiert, teilweise absorbiert18) - es kommen tatsächlich nur etwa 4,8 kWh wirklich im Innenraum an19) . Das sind aber für die gesamte Wohnung durchaus etwa 200 Watt über 24-Stunden gemittelte Dauerleistung. Ein messbarer Beitrag zur Energiebilanz, der bei insgesamt nur 1427 Watt Wärmeverlusten in dieser Wohnung20) mit gutem Wärmeschutz auch nennenswert etwas beiträgt, nämlich etwa ein Siebtel21) .
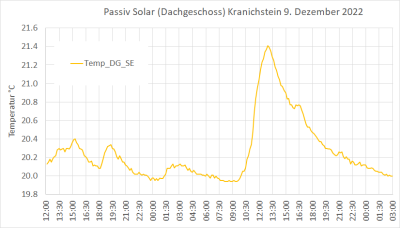 Abb. 6Dieser Beitrag der Sonne kann tatsächlich in den Temperaturaufzeichnungen gesehen werden. In Abb. 6 ist das für das östlichen Südzimmer dokumentiert; dort erkennbar ein „steiler“ Temperaturanstieg ab 10:30 um in der Spitze bis zu 1,4 °C. Da ist es jetzt richtig angenehm warm, durch gratis-Lieferung von der Sonne. Und weil die Verluste in diesem Gebäude so gering sind, hält das hier sogar bis 3:00 in der Folgenacht an! So lang liegt die Temperatur über dem gewählten Sollwert. 'Passiv solar' funktioniert, auch im Dezember! Vorausgesetzt werden muss allerdings, dass die Nutzer das auch zulassen, d.h., nicht etwa bei jedem Sonnenstrahl die außenliegende Jalousie schließen im Winter. Das setzt natürlich voraus, dass als Blendschutz22) ein alternatives, innen aufgestelltes System verfügbar ist. Das spart dann in so einem Gebäude immerhin ca. 17% der Heizwärme im Kernwinter ein; in schlecht gedämmten Gebäuden ist der absolute Beitrag (2 bis 5 kWh/(m²a)) gleich hoch, aber im Vergleich zu den hohen Verlusten relativ wenig bedeutend.
Abb. 6Dieser Beitrag der Sonne kann tatsächlich in den Temperaturaufzeichnungen gesehen werden. In Abb. 6 ist das für das östlichen Südzimmer dokumentiert; dort erkennbar ein „steiler“ Temperaturanstieg ab 10:30 um in der Spitze bis zu 1,4 °C. Da ist es jetzt richtig angenehm warm, durch gratis-Lieferung von der Sonne. Und weil die Verluste in diesem Gebäude so gering sind, hält das hier sogar bis 3:00 in der Folgenacht an! So lang liegt die Temperatur über dem gewählten Sollwert. 'Passiv solar' funktioniert, auch im Dezember! Vorausgesetzt werden muss allerdings, dass die Nutzer das auch zulassen, d.h., nicht etwa bei jedem Sonnenstrahl die außenliegende Jalousie schließen im Winter. Das setzt natürlich voraus, dass als Blendschutz22) ein alternatives, innen aufgestelltes System verfügbar ist. Das spart dann in so einem Gebäude immerhin ca. 17% der Heizwärme im Kernwinter ein; in schlecht gedämmten Gebäuden ist der absolute Beitrag (2 bis 5 kWh/(m²a)) gleich hoch, aber im Vergleich zu den hohen Verlusten relativ wenig bedeutend.
Bedeutung für die Energiebilanz
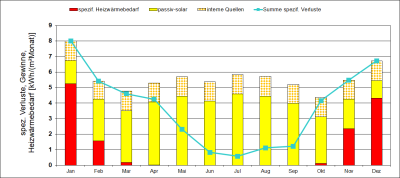 Abb. 7Mit dem Passivhaus-Projektierungspaket kann die Bilanz aus Wärmeverlusten und -Gewinnen monatsweise ermittelt werden. Abb. 7 zeigt das für derzeitiges mitteleuropäisches Durchschnittsklima23) . Sehr gut ist erkennbar, wie die solaren Gewinne24) insbesondere im Winter drastisch abnehmen - und dafür die Wärmeverluste stark zunehmen25) . Ausgerechnet im Dezember ist der Solareintrag am geringsten bei dann außerdem hohen Wärmeverlusten; gut, in unserem Fall sind diese gar nicht sehr hoch, denn das Gebäude ist sehr gut geschützt. In einem ungedämmten Bestandsgebäude können die Verluste 5 bis 10mal so hoch sein. Schon ab Februar nimmt das solare Angebot wieder zu - und deckt dann einen Großteil der Verluste.
Abb. 7Mit dem Passivhaus-Projektierungspaket kann die Bilanz aus Wärmeverlusten und -Gewinnen monatsweise ermittelt werden. Abb. 7 zeigt das für derzeitiges mitteleuropäisches Durchschnittsklima23) . Sehr gut ist erkennbar, wie die solaren Gewinne24) insbesondere im Winter drastisch abnehmen - und dafür die Wärmeverluste stark zunehmen25) . Ausgerechnet im Dezember ist der Solareintrag am geringsten bei dann außerdem hohen Wärmeverlusten; gut, in unserem Fall sind diese gar nicht sehr hoch, denn das Gebäude ist sehr gut geschützt. In einem ungedämmten Bestandsgebäude können die Verluste 5 bis 10mal so hoch sein. Schon ab Februar nimmt das solare Angebot wieder zu - und deckt dann einen Großteil der Verluste.
Fazit
- Passiv solar bringt's, auch im Winter; es setzt aber in Europa ein gut gedämmtes Gebäude voraus, wenn der Beitrag wirklich relevant sein soll.
- Voraussetzung ist, dass die Nutzer die Sonne auch „zulassen“ und nicht etwa aussperren.
- „Passiv solar“, das sind in unserem Fall an einem strahlungsreichen Dezembertag fast 200 W Heizungsbeitrag im 24-h-Mittel. Im Vergleich dazu liefert die 4-kW-peak-PV-Anlage am gleichen Tag etwa 50 Wattel Durchschnittleistung über den ganzen Tag. Das reicht auch bei uns nicht weit - kann aber immerhin z.B. den Betrieb der Lüftungsanlage26) abdecken.
Sonntag, 11. Dezember 2022: Sibirische Kälte angekündigt
 Abb. 8Gemerkt haben wir von der aber noch nicht viel: Gut heute Nacht waren die Wiesen in der Umgebung und das Gras auf dem Dach bereift: Diese Oberflächen mit nur geringen Wärmekapazitäten strahlen ihren Wärmeinhalt schnell in den kalten Nachhimmel ab und kühlen sich so sogar unter die Lufttemperatur ab27) . Deswegen sind übrigens auch die äußeren Oberflächentemperaturen vieler Bauteile im Winter oft28) kälter als die Außenluft - wir werden in einem späteren Beitrag das noch genauer darstellen. Die Bauteile sind auf der Innenoberfläche trotzdem warm - denn, wegen des guten Wärmeschutzes fließt kaum Wärme ab und alle Oberflächen zum Innenraum haben Temperaturen, die nur wenig von der Raumlufttemperatur abweichen (max. 3 K bei den Fenstern, weniger als 1 K bei Wänden und Dächern). Das sind sehr gute Voraussetzungen für gute thermische Behaglichkeit: solange das Temperaturniveau zur Kleidung und Aktivität passt.
Abb. 8Gemerkt haben wir von der aber noch nicht viel: Gut heute Nacht waren die Wiesen in der Umgebung und das Gras auf dem Dach bereift: Diese Oberflächen mit nur geringen Wärmekapazitäten strahlen ihren Wärmeinhalt schnell in den kalten Nachhimmel ab und kühlen sich so sogar unter die Lufttemperatur ab27) . Deswegen sind übrigens auch die äußeren Oberflächentemperaturen vieler Bauteile im Winter oft28) kälter als die Außenluft - wir werden in einem späteren Beitrag das noch genauer darstellen. Die Bauteile sind auf der Innenoberfläche trotzdem warm - denn, wegen des guten Wärmeschutzes fließt kaum Wärme ab und alle Oberflächen zum Innenraum haben Temperaturen, die nur wenig von der Raumlufttemperatur abweichen (max. 3 K bei den Fenstern, weniger als 1 K bei Wänden und Dächern). Das sind sehr gute Voraussetzungen für gute thermische Behaglichkeit: solange das Temperaturniveau zur Kleidung und Aktivität passt.
Apropos Temperaturniveau: Das hält sich jetzt im Intervall zwischen 19,7 und 21,3 °C; bis auf den Raum, den wir derzeit bewusst so wenig ankoppeln, wie es geht29) , da geht es dann schon zeitweise auf 19,2 °C herunter (Obergeschoss NO). Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes, unsere einzige Heizung derzeit, liegt dabei immer noch im 24-h-Durchschnitt unter 400 Watt.
Ganz entspannt heute: Die Sonne scheint!(12. Dezember)
Jetzt herrschen zwar draußen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt - aber das kann das Außenteil des Klimagerätes30) ohne weiteres ab. Natürlich sinken dann die Arbeitszahlen31) - immer noch bei Werten deutlich höher als 1 und die Leistung des Gerätes reicht nach wie vor mehr als aus, das ganze Haus warm zu halten. Auf der Südseite kommt unterstützend die Sonneneinstrahlung dazu, wie schon im Blog vom 10. Dez. beschrieben.
Sicher fragen sich gerade die, die von Heizungstechnik ein bisschen mehr verstehen, wie das denn überhaupt sein kann, dass ein 156 m² Reihenendhaus komplett aus einem Mini-Splitgerät mit maximal 3,6 kW Heizleistung, wandhängend in einem Erdgeschossraum (EG), komfortabel beheizt werden kann. Und Skepsis ist hier angebracht, denn solche Ansätze „Heizen aus nur einem Wärmeerzeuger mit Wärmeabgabe im EG“, das war doch historisch schon einmal gescheitert, nämlich mit dem in der Mitte des 19. Jahrhunderts oftmals eingebauten „Warmluftkachelofen“; abschließendes Urteil war dazu: Klar, im Haupt-Aufstellraum (meist Wohnzimmer) war es dann 'mollig warm', aber insbesondere in anderen Geschossen, gar im 2. OG, da kam regelmäßig nicht genug Wärme an und wenn, dann zog es ordentlich. Die wasserführende Zentralheizung mit Heizkörpern in jedem Raum trat dann auch in Deutschland den Siegeszug an - das war zuverlässig, bequem und komfortabel32) .
Wieso soll das jetzt auf einmal funktionieren? Und dann auch noch mit einer Mini-Wärmepumpe (3,6 kW maximal) statt einem Kachelofen mit über 10 kW? Der Schlüssel heißt hier: Erhebliche Reduktion der Wärmeverluste! Die sind in diesem Gebäude nur noch etwa ein Achtel (12,5%) so hoch wie in einem typischen Altbau zur Zeit der Kachelöfen. Deswegen wird schon einmal sehr viel weniger Heizleistung benötigt - weniger als ein Zehntel der früheren Werte, denn die frei verfügbare Wärme ist wegen der größeren Fenster ein bisschen höher geworden. Die verfügbare Leistung der Mini-Split-Wärmepumpe ist sogar doppelt so hoch wie die hier maximal auftretende Heizlast.
Dann bleibt aber immer noch die Frage: Wenn die gesamte Leistung aus einer Quelle in nur einem Raum im EG freigesetzt wird - wie kann es dann im ganzen Haus vernünftig warm werden?
Abb. 9 gibt die Auflösung: Entscheidend ist der sehr gute Wärmeschutz dieses Gebäudes. Nach außen fließt nur sehr wenig Wärme ab, wir hatten das in einem der letzten Blog-Beiträge schon behandelt33) . Von dieser Wärme wird nahezu die Hälfte dezentral durch Personen und Geräte und ein wenig Licht durch die Fenster ersetzt - der verbleibende „Rest-Verlust“ muss natürlich auch gedeckt werden, sonst wird es trotz allem irgendwann kälter als gewollt. Von der Leistung her kann das Mini-Split-Gerät das „locker“ - und, weil es im Erdgeschoss angebracht ist, kann sich diese Energie auf ganz natürlichem Weg im ganzen Haus ausbreiten. Über einen Mechanismus, der bei den Heizkörper-Raumheizungen als „Warmluftwalze“ bekannt ist; nur, dass das hier eine ganze „Hausluftwalze“ ist, vom EG bis in das zweite Obergeschoss, wie in der Abbildung illustriert. Entgegen kommt uns dabei, dass es sich bei diesem Entwurf um einen sogenannten „offenen Grundriss“ handelt: D.h., das zentrale Treppenhaus ist vollständig offen zum „Ein-Raum“-Erdgeschoss aus Ess- bis Wohnbereich mit zentral integrierter Küche. Wenn wir jetzt die Türen zum Treppenhaus in allen den Räumen offen stehen lassen, die wir mit beheizen wollen - dann funktioniert das!
Dass das tatsächlich funktioniert, kann in dieser Publikation nachgelesen werden: [Feist 2022]Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Es wird auch aus den hier im Blog dokumentierten diesjährigen Erfahrungen erkennbar, die Temperatur im EG ist in etwa 1 °C höher als z.B. im Dachgeschoss. Das ist gerade noch „wahrnehmbar“, je nach Priorität ist es dann im EG „etwas wärmer“34) oder im Dachgeschoss „ein wenig kühler“35) . Das Niveau, auf dem diese Temperaturspreizung 'aufsitzt', können wir uns noch aussuchen. In den vergangenen Jahren waren das komfortable 21 bis 23 °C im Winter. Im Erdgas-Krisen-Winter testen wir jetzt den Betrieb zwischen 19 und 21 °C.
Die „Hausluftwalze“ darf jetzt nicht so verstanden werden, dass da eine Art „Warmluft-Taifun“ durch das ganze Treppenhaus rauscht. Die Luftgeschwindigkeiten liegen überall unter 0,15 m/s (!!) und sind nicht wahrnehmbar36) . Dass es Schritt für Schritt wärmer wird, wenn ich die Treppe hinunter steige, das allerdings kann ich tatsächlich wahrnehmen.
Ganz entscheidend für eine Einschätzung: In einem solchen Objekt mit drei Ebenen kann das mit nur einem Gerät natürlich nur mit der sehr guten Dämmung eines Passivhauses funktionieren und auch das nur mit einem offenen Grundriss. In einem sanierten Altbau sind aber Lösungen mit zwei (oder auch drei) solchen Raumklima-Split-Geräten denkbar. Das ist dann immer noch eine recht kostengünstige Lösung. Überraschend mag sein, dass dennoch solche Raumklima-Split-Geräte als Ergänzung zu einer bestehenden Heizung einen ziemlich großen Anteil der Raumheizung übernehmen können, selbst in einem Altbau. Das ist ein ernst zu nehmender Ansatz in der Erdgas-Krise - denn, diese Geräte sind sehr kostengünstig, eine Installation ist weitaus leichter zu organisieren als eine Erneuerung der ganzen Heizanlage37) - und, evtl. können später weitere Geräte ergänzt werden. Oder aber, der Wärmeschutz wird verbessert, dann reicht das eine Gerät für einen immer größeren Anteil, bis die alte Heizung überflüssig geworden ist38) .
Frostig kalt (13. Dezember)
 Abb. 10Die Kälte ist angekommen.
Abb. 10Die Kälte ist angekommen.
Aber nur außen - denn innen bleibt es warm; würde es selbst dann, wenn wir jetzt nicht heizen könnten. Letzteres können wir aber, denn die Split-Wärmepumpe läuft, ganz problemlos, auch bei Minusgraden im Außenraum. Natürlich ist die Arbeitszahl dann geringer, aber immer noch deutlich 'über 1'. Und die elektrische Leistungsaufnahme liegt immer noch bei nur um 400 Watt; das ist weder für das regionale Netz noch für die Stromerzeugung ein Problem, auch dann nicht, wenn das „alle machen würden“.
Erstmal zurück zum Außenklima: Eisblumen wachsen! Auf der Innenseite unseres Glasvorbaus auf der Nordseite des Hauses. Auf der Innenoberfläche der Einscheibenverglasung. Woher kommt das Wasser? Aus der Luft im Glasvorbau. Warum gibt es da Wasser? Das kommt derzeit aus den im Vorbau gelagerten Materialien, die auch jetzt noch höhere Temperaturen haben (leicht über 0°C) - da wird Feuchtigkeit, die darin in Poren gebunden ist, verdunstet. Und: Von uns, immer wenn wir da durchkommen und als Personen natürlich Feuchtigkeit ausatmen. Die Innenoberfläche der Einfachverglasung hat aber Temperaturen unter 0°C. Die Luft aus dem Raum kühlt sich an der Oberfläche ab… und kann dann soviel Feuchtigkeit nicht mehr halten. Der Überschuss an Wasser - bleibt auf der Oberfläche, und in diesem Fall dann natürlich als Eis. Das Resultat: langsam wachsende Kristallstrukturen (Abb. 10). Wer genauer verstehen möchte, wie sich das erklärt, findet hier die Grundlagen dazu: Physik zur feuchten Luft, insbesondere: Was ist eigentlich relative Luftfeuchtigkeit.
Auch heute scheint hier die Sonne, und das ist in Mitteleuropa kein Zufall: Die Kälte kommt hier überwiegend durch einen Übergriff des (sibirischen) Kontinentalklimas (Hochdruckgebiet!) auf Europa. Das ist dann jedoch ziemlich trockene Luft - und daher ist der Himmel dann, abgesehen von Bodennebel, klar. Das macht es einerseits noch kälter39) und lässt andererseits der Sonne, auch wenn sie nur wenige Stunden über dem Horizont steht, eine Chance. In einem Gebäude mit gutem Wärmeschutz tankt das dann regelmäßig eine Menge passiv solar verfügbarer Energie. In den meisten Passivhäusern wird daher bei solch kalten Wetterlagen gar nicht mehr geheizt als an einem trüben Novembertag40) .
Nachtrag (um 14:00): Ein durchgehend klarer Wintertag! Und das bringt soviel Sonnenenergie in den Raum, dass ich jetzt im Arbeitszimmer schon seit Stunden über 22°C messe. Trotz einem Sollwert, der nur bei um 20° liegt. Klar, das erhöht auch (ein wenig) die Wärmeverluste, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm - ab und zu mal „Wärme zum auftanken“, und das bei dem ausgesprochen kalten Wetter. Das Haus tankt dabei auch Wärme, das merken wir dann in den folgenden Tagen, wenn trotz der Kälte nicht viel Strom für die Wärmepumpe gebraucht wird.
Erster Schnee? (3 mm :-) (14.12.2022)
 Abb. 11
Abb. 11 Abb. 12Erst ein Nachtrag zum „Sonne tanken“ am gestrigen Dienstag. Abb. 11 zeigt, wie das dann von außen aussieht. Das gibt auch die Stimmung gut wieder: Die Sonne steht tief, auch mitten am Tag41) . Die Strahlung kommt durch die Verglasungen, denn für den sichtbaren Teil des Spektrums sind die transparent42) . Und mit dem Licht kommt Energie ins Haus. Diese Strahlungsenergie wird an den Flächen, auf die sie innen auftritt, zum Teil reflektiert43) . Abb. 12 zeigt den „Lichtfleck“, der durch die Verglasung bis tief über die Mitte des Grundrisses hinaus in das Haus gelangt - 'passiv solar', das ist keinesfalls eine neuen Idee, das wird schon Sokrates im klassischen Altertum zugeschrieben („Sonnenhaus des Sokrates“).
Abb. 12Erst ein Nachtrag zum „Sonne tanken“ am gestrigen Dienstag. Abb. 11 zeigt, wie das dann von außen aussieht. Das gibt auch die Stimmung gut wieder: Die Sonne steht tief, auch mitten am Tag41) . Die Strahlung kommt durch die Verglasungen, denn für den sichtbaren Teil des Spektrums sind die transparent42) . Und mit dem Licht kommt Energie ins Haus. Diese Strahlungsenergie wird an den Flächen, auf die sie innen auftritt, zum Teil reflektiert43) . Abb. 12 zeigt den „Lichtfleck“, der durch die Verglasung bis tief über die Mitte des Grundrisses hinaus in das Haus gelangt - 'passiv solar', das ist keinesfalls eine neuen Idee, das wird schon Sokrates im klassischen Altertum zugeschrieben („Sonnenhaus des Sokrates“).
Bringt das Energie ins Haus? Sicher, und wieviel das ist, das lässt sich anhand von Abb. 13 ein wenig einschätzen. In der Spitze (11:00 bis 12:00) lag die Globalstrahlung auf der Südfassade durchaus bei über 800 W/m². Der helle Tag ist nur kurz - und in der Summe werden es dann 2 kWh/m²/d an so einem sonnigen Tag44) . Schön wäre es ja, wenn wir diese Energie komplett nutzen könnten; dazu ist aber selbst die modernste Passivhaus-Technik nicht vollständig in der Lage; es ist eher nur ein Viertel davon45) , das durch fast 20 m² Südverglasungsfläche „durchgereicht“ wird. 10 kWh am Tag ist die hier bewusst grob gehaltene Abschätzung. Diesen Anteil an den Verlusten müssen wir dann schon nicht heizen - wobei, wg. der Kälte, die Verluste eben insgesamt doch höher waren. Das Splitgerät dann aber weiterhin nicht wesentlich mehr zu tun hatte: 425 Wel am gestrigen Tag im Durchschnitt; und, ja, das ist jetzt mehr als nochmal so viel wie der sonst benötigte Haushaltsstrom. Das wird somit schon eine nennenswerte Gesamtlast im Stromnetz, wenn künftig überwiegend mit Wärmepumpen geheizt werden soll, selbst wenn es alles energiesparende Gebäude sind. Wenn sie das nicht sind, dann wird diese Last 5 bis 10mal so hoch - und das wird so schnell nicht ohne weiteres für alle verfügbar sein können: Effizienz und Erneuerbare ergänzen sich aber perfekt: Mit den geringen Lasten, die wir hier haben, ist das darstellbar.
 Abb. 13Nun aber zum „ersten Schnee“, wenn wir das so nennen wollen. OK, dafür, dass jetzt eine dünne Puderschicht auf den PV-Paneelen auf dem Dach liegt, hat's gereicht. Bei Einstrahlung wird die schnell wieder verschwinden, Einstrahlung gibt es heute aber nur wenig: Es sieht nach einem eher „dunklen Tag“ aus, die Außentemperaturen aber immer noch unter dem Gefrierpunkt. Ein wenig Wind kommt auf, das wird die erneuerbare Stromerzeugung heraufsetzen, so dass unsere Wärmepumpe ab jetzt mit weniger CO2-Vorbelastung aus dem Stromnetz betrieben wird46) .
Abb. 13Nun aber zum „ersten Schnee“, wenn wir das so nennen wollen. OK, dafür, dass jetzt eine dünne Puderschicht auf den PV-Paneelen auf dem Dach liegt, hat's gereicht. Bei Einstrahlung wird die schnell wieder verschwinden, Einstrahlung gibt es heute aber nur wenig: Es sieht nach einem eher „dunklen Tag“ aus, die Außentemperaturen aber immer noch unter dem Gefrierpunkt. Ein wenig Wind kommt auf, das wird die erneuerbare Stromerzeugung heraufsetzen, so dass unsere Wärmepumpe ab jetzt mit weniger CO2-Vorbelastung aus dem Stromnetz betrieben wird46) .
Das Innere des Hauses, die Wände und Decken, haben sich gestern so um etwa ein Drittel Grad durch die solare Gratiswärme erwärmt. Das konnten wir am Morgen feststellen - die Messwerte der Raumtemperaturen auf der Südseite lagen sogar um gut ein halbes Grad über denen des Vortages. Mit der Zeit verteilt sich die Wärme im Haus, sie reicht aber derzeit nicht, um die Wärmeverluste des ganzen Hauses zu kompensieren - auch in einem Passivhaus nicht. Da hilft dann, dass diese Verluste eben sehr viel geringer sind als bei schlecht gedämmten Gebäuden - diese um 1000 Watt, die gerade als Netto-Verlust bleiben, das ist auf vielen unterschiedlichen Wegen leicht nachhaltig zu decken; die Wärmepumpe ist ein Weg davon, richtig nachhaltig wird das aber auch erst, wenn die Stromversorgung aus erneuerbarer Energie wirklich ausgebaut sein wird.
Ein ganz anderes Thema: Durchbruch bei der Kernfusion (Blog 15.12.2022)
Wir sollten immer das Gesamtbild im Auge behalten: Wie wichtig die Energieversorgung für unseren heutigen Wohlstand ist, das sollte allen in den letzten Monaten angesichts der erneuten Energiekrise, diesmal ein Krise des fossilen Gases, klar geworden sein. Gerade wenn es draußen so richtig kalt ist - da weiß ich doch einen gut beheizten Raum zu schätzen. Wie das geht, auch ohne die letzten fossilen Kohlestoffatome in Form von CO2 wieder in die Atmosphäre zu versetzen, das ist der Kerngegenstand dieser Seiten auf Passipedia.
Die Fusion leichter Atomkerne (wie Wasserstoff, Deuterium oder Tritium) zu schwereren ist ein physikalischer Weg, Energie ohne Kohlenstoffverbrennung zu gewinnen47) . Dass die Kernfusion das kann, muss nicht mehr bewiesen werden: Die Sterne machen das jeden Tag und tatsächlich ist das heute die bei weitem überwiegende Energiequelle im gesamten Kosmos. Auch auf der Erde ist uns das schon gelungen: Edward Teller war derjenige, der es voran getrieben hat - es war bisher nur leider auf militärische „Anwendung“ begrenzt.
Die Erreichung einer positiven lokalen Energiebilanz durch das LLNL, das IST ein wichtiger Durchbruch. Und ich will da auch ganz ehrlich sein: Das ist eine erfreuliche zukünftige Perspektive, denn ich bin auch da sicher, schrittweise wird diese Technologie sich weiter entwickeln lassen und sie wird den Menschen ganz neue Möglichkeiten erschließen, z.B. die interstellare Raumfahrt.
Bis dahin wird wohl leider noch viel Zeit vergehen. Das haben die Wissenschaftler am LLNL selbst betont. Ich muss das nicht im Detail erläutern, denn das hat Anton Petrov in seinem Youtube-Video bereits sehr gut gemacht: Hier der ehrliche wissenschaftliche Hintergrund zum aktuellen Durchbruch bei der Kernfusion: Anton Petrov macht das sehr gut verständlich.
Ein Hinweis noch: Wenn Fusionsenergie z.B. in 30 Jahren in großem Maßstab verfügbar wird, dann wird sie zur Stromerzeugung verwendet.
Auch dann bleibt es also dabei: Die Heizung der Gebäude, unsere Fahrzeuge, … alles das muss dann auf Strom umgestellt werden. Etwas, was wir unabhängig von der gewünschten künftigen Primärenergiequelle ohnehin tun müssen.
Wir sind also gut beraten: auf Wärmepumpen umstellen, so, wie es z.B. mit dem hier im einzelnen beschriebenen Klima-Split-Gerät geht. Alles, was dazu gehört, damit das auch vernünftig funktioniert, das wird ebenfalls gebraucht - ob über Kernfusion oder über z.B. Windkraft betrieben. Damit die Netze das aushalten ist der Schlüssel dafür eine bedeutend verbesserte Effizienz. So, wie wir das hier beschreiben und über die Erfahrungen berichten.
Das wirklich Gute daran
Diese Technologie steht bereits zur massenhaften Anwendung zur Verfügung - sie ist erprobt und bewährt und extrem kostengünstig, sogar im Vergleich mit den immer noch billig verkauften fossilen Energieträgern. Sie kann überall angewendet werden und einen Einstieg kann jeder selbst vollziehen: Bauliche Maßnahmen zur Energieeffizienz.
Und wie sieht es im Haus gerade aus?
Für treue und neugierige Verfolger unseres Blogs aber auch noch die Daten des letzten Tages: Zwischen -2 und -8°C lagen die Außentemperaturen gestern - und es war durchgehend dicht bewölkt, im Maximum nicht einmal 50 W/m² auf der Außenseite der Südfassade. Es ist kälter als im Durchschnitt im Dezember, aber schon noch „typisches Dezemberwetter“. Die Temperaturen zwischen 19,2 und 21 °C wurden im Haus eingehalten, dafür war die Split-Wärmepumpe im Betrieb. 461 Wel hat sie dabei gezogen (aus dem Stromnetz, für die Heizung für alle 3 Personen zusammen), die solare Stromerzeugung lag dagegen bei nur 8,5 W im Durchschnitt. Und dazu im Vergleich der Bericht zum Durchschnitt in Deutschland: Etwa 880 W/Person wurde aus dem Stromnetz gezogen und das war leider überwiegend fossil erzeugte elektrische Energie 48) . Die Gasverbrauchswerte sind ebenfalls seit Tagen auf Spitzenniveau: So hoch, dass die Bundesnetzagentur wiederholt ein sparsameres Verhalten angemahnt hat: Es waren über 4 TWh am Tag49) , ziehen wir die 1 TWh/d temperaturunabhängigen Verbrauch (aus dem August) ab, so sind das auf 24 h gemittelt um 1500 W je Person in Deutschland50) . Wenn Erdgas ungefähr die Hälfte der Heizwärme deckt, sind es im Gesamten sogar 3 kW Heizlast je Person in einer solchen Kälteperiode im Dezember. Das summiert sich auf eine gewaltige Leistung, die die Dimension der Aufgabe transparent macht: Diese Heizwärmeverluste, das müssen erheblich weniger werden, wenn wir eine Chance haben wollen, das mit nachhaltigen Energieträgern zu decken. Immerhin: In einem typischen Passivhaus, wie hier dokumentiert, ist es nur ein Zwanzigstel; und dafür reichen auch im Winter Wind und Sonne sowie Backup durch Biomasse-Kraftwerke aus, auch „wenn das alle so machen“51) .
Schall? Nicht unwichtig für die Praxis einer Wärmepumpe (am 16.Dez.)
Bei unserer Wärmepumpe handelt es sich um ein „ganz normales“ Raumklimasplitgerät52) . Eines der „kleinsten“, die es zu diesem Zeitpunkt gab, unter dem Namen „Mini-Split“ beworben. Vielen in Deutschland sind Splitgeräte aus dem Mittelmeerurlaub bekannt - wo sie in nahezu jeder Eisdiele im Sommer für eine kühle Pause sorgen; oder aus manchen Chef-Büro-Etagen auch in Deutschland - dort allerdings werden die so häufig gar nicht oft betrieben, weil die Geräte älterer Bauart nämlich einen 'Höllenlärm' machen. Das ist einer der Gründe, warum sich diese Technik in Deutschland zunächst nicht besonders ausgebreitet hat: Die paar heißen Tage lassen sich zur Not ertragen, wenn nur die Wahl zwischen „zu warm“ und „zu laut“ besteht. Daher müssen wir uns mit der Frage der Schallbelästigung befassen.
Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Gute neue Geräte sind nicht mehr derart extrem laut. Das gilt auch schon für unser Gerät - und, es besteht durchaus die Chance, dass das in der künftigen Weiterentwicklung sogar noch besser wird. Allerdings: Es gibt ein breites Spektrum unterschiedlicher Geräte von verschiedenen Herstellen. Am besten ist es, wenn es unabhängig bestätigte Messwerte zur Schallleistung gib; in der PHI-Zertifizierung sind die beispielsweise enthalten.
Die modernen Geräte haben meistens auch einen sog. „Flüster-Modus“ mit bewusst reduzierten Luftvolumenströmen. Das setzt die Ventilationsgeräusche drastisch herab. Allerdings, der geringere Luftvolumenstrom erzwingt auch, dass für gleiche Wärmeleistung die Lufttemperatur erhöht werden muss. Und das geht nur bei höherer Kondensationstemperatur im Innenteil des Gerätes53) . Dadurch sinkt der COP des Gerätes - und der Strombedarf steigt. Das ist übrigens der wichtigste Grund, warum unser Gerät im Winterdurchschnitt keine wirklich hohe saisonale Arbeitszahl erreicht; wir lieben es leise - für konzentriertes Arbeiten ist das einfach angenehmer. Hier wird deutlich, warum Fortschritte beim Schallschutz54) zugleich auch Fortschritte bei der Energieeffizienz bedeuten.
Das Schallschutzlabor der Universität Innsbruck hat die Chance wahrgenommen, sowohl innen- als auch außenseitig an dem bei uns eingesetzten Gerät die Schalldruckwerte zu messen. Das war am 25. März 2017, als das Innengerät 'wie üblich' installiert war und der Messkanal für die genaue thermische Messung des Betriebsverhaltens noch nicht vorhanden war; der Kanal nimmt natürlich weiteren „Schall weg“ - denn die verwendeten Stützventilatoren sind ganz extrem leise55) . Das Messen der Schallwerte war weder innen noch außen „einfach“, weil es überall und immer Störgeräusche gab, die nur sehr schwer „abstellbar sind“. Z.B. musste die „Bahnhofsuhr“ im Esszimmer entfernt werden, deren Sekundenzeiger-Ticken sonst die Messung spürbar beeinflusst; und der Kühlschrank in der Küche für ein paar Stunden vom Netz getrennt, denn wenn der anspringt, wirkt sich das ebenfalls aus. Diese Bemerkungen zeigen auch bereits, dass die Schallleistung des Gerätes im „Flüsterbetrieb“ tatsächlich nicht extrem hoch ist; aber deutlich hörbar ist das Gerät dann schon noch - subjektiv würde ich da nicht von „Flüstern“ reden.
Nun aber zu den Messwerten:
^Betriebsweise ^ Messwert dB(A) ^Kommentar ^
| Referenz: Splitgerät aus, Wohnungslüftung auf „normal“ | 17(±1) | Unsere Lüftung ist extrem leise; auch die ist, wenn niemand redet und die Küchenuhr entfernt ist, gerade noch eben „hörbar“. Ein Unterschied zu „Lüftung aus“ lag innerhalb der Fehlergrenzen der Messung. Der Nachbar muss nur einen Stuhl verrücken, und es waren weitere 5 Min Messung nicht mehr auswertbar56) |
| Splitgerät „Quiet, Heating“ | 22(±1) | Das ist schon recht „leise“, aber es ist immer noch gut wahrnehmbar. Im Schlafzimmer würde das für manche immer noch einen Tick lauter sein, als sie es sich vorstellen können. |
| Splitgerät „Stufe 1, Heizen“ | 28(±1) | Das ist deutlich wahrnehmbar, es stört aber eine normale Unterhaltung nicht. |
Und das sind die Messwerte für das Außengerät, in dem auch der Kompressor der Wärmepumpe eingebaut ist:
| Betriebsweise | Messwert dB(A) | Kommentar |
|---|---|---|
| Splitgerät im Heizbetrieb | 40(±4) | Gemessen etwa 3 m entfernt vom Gerät auf gleicher Höhe über Grund, ohne abschirmende Gegenstände. Der normale Hintergrundpegel lag im Messzeitraum zwischen 30 und 42 dB(a); es muss aber nur ein Vogel zwitschern, dann gehen die Werte kurzzeitig auch mal auf 60 dB herauf. Der normale Hintergrund: Blätterrauschen und (weiter entfernter) Fahrzeugverkehr |
Wir sind somit bereits nahe dran an den extrem guten Werten der zertifizierbaren Passivhaus-Lüftung. Deren Werte um rund 20 dB(A) zeigen auch, dass gute Geräte tatsächlich außerordentlich leise sein können; tatsächlich gibt es sehr leise Geräte auch bereits am Markt - einziges Problem ist, welcher Verlass auf die Angaben in den Herstellerprospekten wirklich besteht.
Möchte jemand selbst eine Eindruck bekommen? Tonaufzeichnungen aus dem Innenraum bei um 20 dB(A) bringen da nichts, weil uns da einfach die „Referenz“ fehlt. Aber das Geräusch außen, nun allerdings aus nur 1 m Entfernung vom Gerät, davon kann ein gewisser Eindruck vermittelt werden. Es handelt sich tatsächlich im wesentlichen um das Rauschen des großen Lüfters. Um die „Ecke“ des Gebäudes, gleichgültig ob im Norden oder Süden dieser Westgiebelwand, ist das bereits beim besten Willen nicht mehr zu hören. Im Foto (Abb. 15) ist erkennbar, dass das Gerät (selbstverständlich!) schallentkoppelt aufgestellt ist; das ist überhaupt nicht schwierig, die zugehörigen Bauelemente sind leicht beschaffbar und auch nicht teuer, sie sind ihren Preis Wert. Bedenke: Die Akzeptanz solcher Geräte hängt ganz entscheidend daran, dass sie eben nicht störend laut sind - und das ist mit etwas Achtsamkeit und bei sorgfältiger Auswahl heute durchaus zu erreichen.
Abb. 14  Abb. 15
Abb. 15
Aktueller Bericht
 Abb. 16Jetzt liegt die Außenluft-Temperatur im Mittel schon um -6°C. Aber der 16. Dezember ist bisher in Darmstadt ein sonniger Tag - und die Temperaturen in unseren Südräumen sind bereits auf um 22 °C angestiegen. Da kann ich den Pullover wieder ausziehen! Die 24-gemittelte elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am gestrigen Tag (kalt aber ohne Sonne!) lag bei 462 W. Etwa 6 W/m² spezifische Heizleistung57) ist da das Ergebnis - und das innerhalb der 14 Tage des Jahres, in denen die Sonne am tiefsten steht58) . Wenn sich das Wetter so abwechselt - immer mal wieder ein sonnenreicher Tag zwischendurch - ist das geradezu Idealwetter für ein Passivhaus. In Deutschland normalerweise häufiger sind aber atlantische Dezember-Tiefdruckgebiete; da ist es dann trüb und nass - auch da bleiben die Heizleistungen in einem Passivhaus oder einer EnerPHit-Sanierung in Grenzen, aber für die Stimmung ist der Sonnenschein natürlich viel besser.
Abb. 16Jetzt liegt die Außenluft-Temperatur im Mittel schon um -6°C. Aber der 16. Dezember ist bisher in Darmstadt ein sonniger Tag - und die Temperaturen in unseren Südräumen sind bereits auf um 22 °C angestiegen. Da kann ich den Pullover wieder ausziehen! Die 24-gemittelte elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am gestrigen Tag (kalt aber ohne Sonne!) lag bei 462 W. Etwa 6 W/m² spezifische Heizleistung57) ist da das Ergebnis - und das innerhalb der 14 Tage des Jahres, in denen die Sonne am tiefsten steht58) . Wenn sich das Wetter so abwechselt - immer mal wieder ein sonnenreicher Tag zwischendurch - ist das geradezu Idealwetter für ein Passivhaus. In Deutschland normalerweise häufiger sind aber atlantische Dezember-Tiefdruckgebiete; da ist es dann trüb und nass - auch da bleiben die Heizleistungen in einem Passivhaus oder einer EnerPHit-Sanierung in Grenzen, aber für die Stimmung ist der Sonnenschein natürlich viel besser.
Habe ich es schon erwähnt? Praktische Schritte in Richtung auf so niedrige Verbrauchswerte können überall gegangen werden, mit ganz einfachen Dingen können alle anfangen:Eine gedämmte Heizkörpernische, eine Fensterfolie, ein paar verbesserte Heizleitungen,... oder auch so ein Split-Klimagerät.
Wie hältst Du's mit den Klimagasen? (17. Dez.)
Ziel der Umrüstung auf Wärmepumpen ist letztlich die Verringerung von Klimagas-Emissionen. Da die Wärmepumpe vor Ort mit Strom betrieben wird, entsteht beim Betrieb kein CO2, und so wird das gern oft kommuniziert. Natürlich ist es in Wahrheit etwas komplizierter - aber nicht so kompliziert, dass es nicht in unserem Blog verständlich gemacht werden kann. Wir machen das in „kleinen Schritten“, so dass transparent wird, welche Daten wo eingehen und wo sich Einschätzungen auch anders treffen ließen.
Der Strom kommt aus der Steckdose? Oder?
Ja, und das wird fast überall im Dezember in privaten Haushalten so sein - denn die PV-Eigenstromerzeugung im Dezember, auch bei einer sehr großen Anlage, wird in Mitteleuropa für den Betrieb einer Wärmepumpe nicht verfügbar sein - die reicht, selbst bei sehr sparsamen Verbrauch, noch nicht einmal für die Deckung des Verbrauchs von den ganzjährigen üblichen Haushaltsanwendungen59) . Für den Betrieb von Wärmepumpen muss somit von der verfügbaren Stromerzeugung im öffentlichen Netz ausgegangen werden.
Beginnen wir mit der Situation heute: Vom Strom im Netz wird derzeit etwa die Hälfte nicht aus fossiler Energie erzeugt, der erst noch immer in Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken - und diese setzen CO2 frei. Blenden wir die aktuelle Situation mit wieder erhöhtem Kohle-Anteil aus und gehen von den durchschnittlichen Emissionen des Jahres 2021 aus, so waren das im Resultat
420 g/kWhel .
Unsere Wärmepumpe kommt im Winter auf eine mittlere monatliche System-Arbeitszahl (inkl. aller Hilfsenergie) von 2,2560) . Damit kommen wir für die Emissionen im Betrieb je kWhtherm Heizwärme auf
Split-Geräte-Heizung wie gemessen: 187 g/kWhtherm .
Würden wir die Heizwärme weiter aus dem zentralen mit Erdgas betriebenen Brennwertkessel beziehen, dessen Gesamtsystemwirkungsgrad inkl. der Verteilung gemäß der Messergebnisse in den Jahren 2000-2015 bei rund 92% liegt, so ergeben sich bei einem GWP61) von 250 g/kWhErdgas
Erdgas-Brennwertkessel wie gemessen: 272 g/kWhtherm .
Das sieht immer noch gut aus! Die Wärmepumpe erlaubt damit nicht nur eine Umstellung auf einen höheren Anteil erneuerbarer Energie, sondern bereits heute eine CO2 Reduktion im Betrieb von rund 30%. Und selbstverständlich wird erheblich weniger Erdgas dafür gebraucht. Das sind gute Gründe, die Umstellung auf Wärmepumpen zu empfehlen.
Es gibt jedoch immer noch einen Tropfen Wasser in den Wein: Denn, die meisten heute eingebauten Wärmepumpen laufen mit klimaschädlichen Kältemitteln. Das ist solange kein „Riesenproblem“, solange diese Kältemittel nicht freigesetzt werden, deswegen muss bei Befüllung und auch bei der Außerbetriebnahme bzw. dem Ersatz von Wärmepumpen darauf geachtet werden, dass so wenig wie möglich Kältemittel freigesetzt wird.
Überschlagen wir es kurz im vorliegenden Fall: Da sind 1,05 kg R410A an Kältemittel eingefüllt, dieses hat einen GWP-Faktor von 2088 gegenüber CO2. Gehen wir von einer Betriebszeit von 12 Jahren und einem vollständigen Kältemittel-Verlust aus, so wären das immerhin ein Beitrag von 117 g/kWh auf jede Kilowattstunde erzeugte Heizwärme. Mit dieser Klimagas-Belastung wäre die Split-Wärmepumpe dann sogar ein wenig klimaschädlicher als der alternative Gaskessel. Was wir daraus erkennen: Es ist wirklich wichtig, dass wir auf umweltfreundlichere Kältemittel umsteigen. Schon mit R32 sieht es besser aus (nur noch +38 g/kWh) und letztlich können Wärmepumpen dieser Leistungsklasse auch mit Propan (R290) betrieben werden, denn unter 150 g Kältemittelmenge können bei nur 2 kW geforderter Leistung durchaus erreicht werden. Damit ist das Thema Treibhausgas bzgl. des Kältemittels „erledigt“, denn die beim einem GWP von 3,3 verbleibenden umgerechnet 0,026 g/kWh sind vernachlässigbar gering. Hier wird deutlich, warum wir empfehlen:
- Moderne Splitgeräte zur Heizungsunterstützung einsetzen: Ja, das ist schon heute sinnvoll,
- aber auf R32 als Kältemittel achten (oder, wenn möglich, gleich R290)
- und: erstmal nur ein solches Splitgerät für den „wichtigsten Raum“, damit können dann immerhin schon einmal 30 bis 40% der Energie aus Gas oder Öl eingespart werden, wenn ansonsten eine brennstoffbetriebene Zentralheizung läuft62) .
- … weitere Splitgeräte können nachgerüstet werden, wenn (hoffentlich in wenigen Jahren) die verbesserten Systeme mit klimafreundlicheren Kältemittel in großer Auswahl am Markt verfügbar sind. Die werden dann auch effizienter im Heizbetrieb sein, denn dafür sind die heutigen Systeme noch nicht wirklich optimiert.
- Vor allem immer darauf achten, dass Kältemittelverluste gering gehalten werden.
Nun wollen wir aber auch noch einen Blick in die Zukunft wagen: Denn, so wie heute wird die Situation bei der Stromerzeugung sicher nicht bleiben - der Kohleausstieg ist vereinbart und ein Zubau von erneuerbarer Stromerzeugung ist ziemlich sicher. Das wird insgesamt die mittlere äquivalente Klimagas-Emission von Wärmepumpenstrom auf rund
198 g/kWhel reduzieren,
im Durchschnitt des im Winter für den Betrieb entnommenen Stroms über die kommenden 30 Jahre; bei einem relativ 'optimistischen' Szenario für die künftige Stromerzeugung. Das ist nur etwa die Hälfte der heutigen Emissionen. Damit reduzieren wir künftig mit solchen Splitgeräte-Heizungen die Emissionen für die Raumwärmebereitstellung um etwa einen Faktor 3. Das ist der eigentliche Grund, warum wir das empfehlen. Dazu erforderlich ist aber
- Ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, insbesondere der Windkraft: Denn nur Windenergieanlagen können im Winter in der geforderten Menge erneuerbaren Strom direkt erzeugen63) .
- Ein engagiertes Gebäude-Modernisierungsprogramm: Denn bei den jetzt vorliegenden Heizlasten wäre die mittlere Last im Stromnetz allein durch die zusätzlichen Wärmepumpen im Winter mehr als verdoppelt; das wäre weder für das Netz noch für die Erzeugung noch für das ebenfalls erforderliche Backup leistbar. Bei einer Reduktion auf etwa 33 bis 40%, so wie das mit den Tipps für die schrittweise Verbesserung der Gebäude möglich ist, kann es aber alles gelingen, dann auch mit einem vertretbarem Aufwand für die Umstellung.
Bericht aus dem Haus
Nach dem sonnigen Tag gestern scheint auch heute wieder die Sonne und das zieht die Temperaturen im Haus nach oben. Die mittlere elektrische Leistung der Wärmepumpe lag gestern nur noch bei 422 Wattel 64) . Das hat in den dafür zu betreibenden Kraftwerken immerhin etwa 5,9 kg COäq freigesetzt. Heizung ist schon immer noch ein bedeutender Klimagas-Erzeuger, selbst in einem Passivhaus; daran ändert sich dann etwas, wenn erneuerbare Energie, insbesondere Windkraft, zügig ausgebaut wird - etwas Zeit benötigt das aber schon. Welcher Zeitmaßstab hier anzulegen ist, das werden wir in einem künftigen Beitrag auch noch beleuchten. Für heutige durchschnittliche Gebäude mit heute üblichen Heizungen lagen die Emissionen gestern gut 12mal so hoch! Es ist völlig klar, dass dies sich ändern muss: Es geht nicht lange gut, wenn wir nur für einen Tag Heizen in jeder Wohnung die Masse einer Person an Klimagasen freisetzen.
\\ ===== Verdampfer zugefroren? (18. Dezember) =====
 Abb. 17Abb. 17 zeigt das Außengerät heute Vormittag mit einer Reifschicht - die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht besonders dick und die Außenluft wird vom Gebläse da immer noch durchgezogen, das Kältemittel in den Rohren des Verdampfers zieht auch bei -9 °C65) immer noch Wärme aus dem Luftstrom heraus. Wird der Strömungswiderstand bei dicker werdender Eisschicht zu groß, dann schaltet das Gerät automatisch in den Abtaumodus; das hat es in der Nacht mehrmals getan, ohne dass wir davon irgendwie Notiz genommen haben. Ein Problem gab es deswegen noch nie - auftreten tut diese Situation dann, wenn die Luftfeuchtigkeit außen so hoch ist, dass die unterkühlte Fläche des Verdampfers die Taupunkttemperatur unterschreitet66) . Das kam in den 7 Jahren des Betriebes nur an einzelnen Tagen vor. Dass das derzeit passiert, kündigt einen Wetterwechsel an: Die relative Luftfeuchtigkeit ist gestiegen, feuchtere Luft eines atlantischen Tiefdruckgebietes ist auf dem Weg zu uns: Die Folgen, wenn das auf jetzt eiskalte Böden trifft, haben die Wetterdienste bereits seit Tagen angekündigt: Glatteis!
Abb. 17Abb. 17 zeigt das Außengerät heute Vormittag mit einer Reifschicht - die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht besonders dick und die Außenluft wird vom Gebläse da immer noch durchgezogen, das Kältemittel in den Rohren des Verdampfers zieht auch bei -9 °C65) immer noch Wärme aus dem Luftstrom heraus. Wird der Strömungswiderstand bei dicker werdender Eisschicht zu groß, dann schaltet das Gerät automatisch in den Abtaumodus; das hat es in der Nacht mehrmals getan, ohne dass wir davon irgendwie Notiz genommen haben. Ein Problem gab es deswegen noch nie - auftreten tut diese Situation dann, wenn die Luftfeuchtigkeit außen so hoch ist, dass die unterkühlte Fläche des Verdampfers die Taupunkttemperatur unterschreitet66) . Das kam in den 7 Jahren des Betriebes nur an einzelnen Tagen vor. Dass das derzeit passiert, kündigt einen Wetterwechsel an: Die relative Luftfeuchtigkeit ist gestiegen, feuchtere Luft eines atlantischen Tiefdruckgebietes ist auf dem Weg zu uns: Die Folgen, wenn das auf jetzt eiskalte Böden trifft, haben die Wetterdienste bereits seit Tagen angekündigt: Glatteis!
Eine Konsequenz hat die Reifschicht und die Notwendigkeit zum Abtauen schon: Das reduziert den COP67) unseres Gerätes; der liegt allerdings auch heute immer noch deutlich über eins: Es ist also sinnvoll, die Wärmepumpe zu betreiben, sie zieht nach wie vor einen bedeutenden Teil der benötigten Heizwärme aus der Außenluft. Auch bei dieser Kälte, und trotz des Energieaufwandes für das Abtauen von Zeit zu Zeit. Die Temperaturen lagen in der Nachts bei -1 bis -10 °C, es gab rasche Luftmassenwechsel; es ist, als ob der „atlantische Einfluss“ (feuchter, wärmer) mit dem „asiatischen Einfluss“ (kälter, klarer, trockener) „kämpft“. Der Stromverbrauch am gestrigen Tag lag bei 426 Watt im Durchschnitt für das Splitgerät, da ist der Aufwand für das Abtauen (von Zeit zu Zeit) bereits enthalten. Die Temperaturen im Innenraum wurden gehalten - bzw. in den Südräumen war es zeitweise sogar angenehm sonnig warm (bis über 22 °C).
Spiegelglatt heute (19. Dez.)
Das Wetter ist wie angekündigt: Feuchte atlantische Luft, die sich über und in die Kaltluft am Boden einmischt. Richtig geregnet hat es hier bisher noch nicht: Aber der Boden, durchgefroren von den vergangenen Tagen, hat eine spiegelglatte Eisoberfläche. Bedeckt von einer hauchdünnen Schicht aus flüssigem Wasser - das ist Spaß für die Kinder, da lässt sich schön „Schlittern“. Auf Beton, Asphalt oder Steinbelägen mit normalem Schuhwerk - keine Chance, das ist dann, wie wenn Dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Da muss ich dann wohl die Schuhspikes zum überziehen raussuchen, die wir für die Gletscherquerung einmal besorgt hatten. Das Splitgerät arbeitet weiter ohne Murren und einwandfrei; 10,33 kWhel waren es gestern insgesamt. Die Temperaturen im Haus halten sich auf dem gewünschten Niveau. Nach dem Wetterumschwung werde ich dann die Daten der sehr kalten Woche insgesamt auswerten und dokumentieren. Klar ist schon jetzt: Auch in einer solchen Wetterlage arbeitet das Splitgerät zuverlässig; und die Strombedarfswerte lagen immer in einem Bereich, der für das Netz und die (künftige) erneuerbare Erzeugung noch akzeptabel sind. Ebenso klar ist aber auch, dass dafür die Heizlast nicht so hoch bleiben darf wie im durchschnittlichen Bestand - und, dass dafür ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren Erzeugung erfolgen muss, insbesondere bei der Windenergie.
Die Kälteperiode: Aufgezeichnete Daten (20. Dez)
Abb. 18 zeigt den Verlauf von Solareinstrahlung und atmosphärischer thermischer Strahlung (sog. atmosphärische Gegenstrahlung) im Zeitraum des Hochdruckeinflusses. Sehr schön ist in Abb. 19 erkennbar, wie die Temperatur am 12. Dezember steil abfällt, dann typische Tag-Nachtgänge zeigt und wie die Kaltluftmasse ab 18. Dezember 8:00 wieder durch das atlantische Tief durch warme, feuchte Luft verdrängt wird. Nur zwei der 7 kalten Tage waren strahlungsarm (Nebel); sonst zeigt sich der typische Verlauf von Solarstrahlung auf die Südfassade (gelb), in Ostorientierung (rot) und von Westen (blau) sowie horizontal (grün) und nordseitig (grau), am 16. Dezember nahezu bilderbuchmäßig. Hier wird deutlich erkennbar, warum wir südorientierte Fenster empfehlen. Die solare Einstrahlung wirkt sich unmittelbar auf den Temperaturverlauf in den Südräumen aus, auch wieder am 16. Dezember am klarsten erkennbar: Im Dachgeschoss Südost (gelb) an diesem Tag auf über 23 °C - das Passivhaus ist in der Lage, die Gratiswärme lang im Gebäude „zurück“ zu halten, denn die Wärmeverluste sind nur gering; natürlich verteilt sich die Wärme mit der Zeit tiefer in die Bauteile (z.B. Decken) hinein und auch weiter bis in den Nordbereich des Hauses. Der Nordraum im Erdgeschoss („EG_Esszimmer, violett“) ist der Standort des Splitgeräte-Innenteil68) . Wärmer sind nur die Feuchträume in EG und OG (blau, das sind kleine Räume mit extrem geringem Wärmeverlust), weil hier die WW-Zirkulation endet. Alle Innentüren stehen offen, bis auf die zum Raum OG_Zi-NE (orangerot); diesen seltener genutzten Raum haben wir hier ganz bewusst „abgekoppelt“. Dort sind die Temperaturen dann auch tatsächlich bis auf rund 18,5 °C abgesunken. Überall sonst liegen die Temperaturen dauerhaft zwischen 19,2 °C und 21,4 °C, in dem für „sparsamen Heizbetrieb“ angestrebten Band. Die entsprechenden Verläufe in den Jahren 2017-2021 liegen im Durchschnitt gut 1 Grad höher, das Niveau ist allein eine Frage der Einstellung der Sollwerte an der Steuerung des Klima-Splitgerätes.
Wieviel Energie in der Kälteperiode? (Blog vom 21.12.2022)
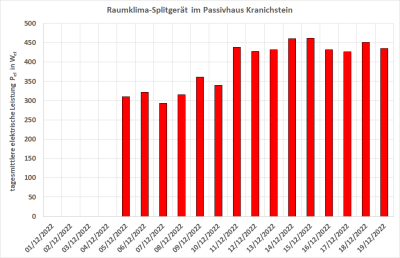 Abb. 20Zu den obigen Temperaturverläufen werden hier jetzt auch noch die „gezapften“ Energiemengen dokumentiert. Versorgt wird das Gerät aus dem deutschen Stromnetz; angegeben im Diagramm ist die gesamte elektrische Leistung (inkl. alle „Hilfsenergie“-Verbrauchswerte wie Ventilatoren, Regelung, Abtauprozesse u.a.m.) im Mittelwert über 24 h. Über die Kälteperiode insgesamt gemittelt sind es um 442 Wattel und das ist der Gesamtverbrauch für die Heizung in diesem Haus - womit die Temperaturen im Raumtemperaturdiagramm dargestellten Intervall gehalten werden konnten; das waren 19,2 bis 21,4 °C, ein Bereich, der mit angemessener Innenraum-Winterkleidung komfortabel ist. Mit rund 150 Wattel je Personen liegt dies um nur 50% über dem Energieumsatz der drei Personen in dieser Wohnung. Würden alle 84 Millionen69) so heizen, mit Gebäuden der hier vorliegenden Effizienz, so würde sich das auf 12,6 GWel summieren. Die in diesem Zeitraum tatsächliche mittlere Leistung aus Windkraft lag bei um 9 GW70) . In nur durchschnittlich wärmegedämmten Gebäuden wäre die betreffende in der Kälteperiode benötigte Leistung 5 bis 8 mal so hoch; das korrespondiert auch zu den Erdgasmengen, die im betreffenden Zeitraum in Deutschland gezapft wurden. Diese Analyse zeigt: Mit Wärmepumpen ist der überwiegende Teil der Gebäude gesichert im verfügbaren Stromnetz beheizbar, wenn der Wärmeschutz der Gebäude auf einem guten Niveau liegt71) .Auch dafür wird ein bedeutender Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung benötigt, insbesondere bei der Windenergie. Alle genannten Voraussetzungen sind erfüllbar:
Abb. 20Zu den obigen Temperaturverläufen werden hier jetzt auch noch die „gezapften“ Energiemengen dokumentiert. Versorgt wird das Gerät aus dem deutschen Stromnetz; angegeben im Diagramm ist die gesamte elektrische Leistung (inkl. alle „Hilfsenergie“-Verbrauchswerte wie Ventilatoren, Regelung, Abtauprozesse u.a.m.) im Mittelwert über 24 h. Über die Kälteperiode insgesamt gemittelt sind es um 442 Wattel und das ist der Gesamtverbrauch für die Heizung in diesem Haus - womit die Temperaturen im Raumtemperaturdiagramm dargestellten Intervall gehalten werden konnten; das waren 19,2 bis 21,4 °C, ein Bereich, der mit angemessener Innenraum-Winterkleidung komfortabel ist. Mit rund 150 Wattel je Personen liegt dies um nur 50% über dem Energieumsatz der drei Personen in dieser Wohnung. Würden alle 84 Millionen69) so heizen, mit Gebäuden der hier vorliegenden Effizienz, so würde sich das auf 12,6 GWel summieren. Die in diesem Zeitraum tatsächliche mittlere Leistung aus Windkraft lag bei um 9 GW70) . In nur durchschnittlich wärmegedämmten Gebäuden wäre die betreffende in der Kälteperiode benötigte Leistung 5 bis 8 mal so hoch; das korrespondiert auch zu den Erdgasmengen, die im betreffenden Zeitraum in Deutschland gezapft wurden. Diese Analyse zeigt: Mit Wärmepumpen ist der überwiegende Teil der Gebäude gesichert im verfügbaren Stromnetz beheizbar, wenn der Wärmeschutz der Gebäude auf einem guten Niveau liegt71) .Auch dafür wird ein bedeutender Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung benötigt, insbesondere bei der Windenergie. Alle genannten Voraussetzungen sind erfüllbar:
- Eine Umrüstung auf (weitgehend) Wärmepumpen innerhalb der nächsten ca. 25 Jahre
- Die Verbesserung des Wärmeschutzes auf EnerPHit-Niveau im etwa gleichem Zeitraum (Das entlastet dann auch die Gasversorgung, in den Objekten, die noch nicht auf Wärmepumpen umgerüstet sind)
- Der Ausbau der Windkraft, die allerdings zügiger und mit ehrgeizigeren Zielen (nämlich rund +10 GW/a Nennleistung) erfolgen muss.
- Für Flauten wird auch eine Backup-Leistung benötigt. Auch das ist bei gering bleibenden Gesamtlasten machbar, dafür könnten z.B. GUD-Kraftwerke bereit gehalten werden, die mit Gas aus erneuerbarer Energie, zwischengespeichert in den schon heute vorhandenen Methan-Speichern, betrieben werden können. Das ist der bei weitem teuerste Teil er Lösung. Bei zu hoher maximaler Gesamtheizlast würde dieser Teil des Konzeptes unbezahlbar. ===== Gute Nachrichten: Auch unsere selbst ausgeführten Innendämm-Maßnahmen in den Institutsräumen bewähren sich (22.12.) =====
 Abb. 21Dass die Wärmedämmung von Hüllflächen der Gebäude bedeutend den Verbrauch an Heizenergie reduziert, das wird an den Ergebnissen in diesem Blog zum „Heizen mit nur einem einzelnen Splitgerät“ für ein richtig gut gebautes Wohnhaus deutlich. Auch bestehende Gebäude können mit verbessertem Wärmeschutz nachgerüstet werden, das ist ein entscheidender Teil zum Gelingen der Energiewende. Auf den Seiten zu Energieeffizienz-Jetzt geben wir dazu konkrete Anleitungen, die auf dem gesammelten Know-how zehntausender realisierter Neubauten und Bestandsgebäude beruhen. Diese Anleitungen beruhen immer auf dem Stand der Erkenntnis der Bauphysik - dort sind die entscheidenden Fakten zur korrekten Ausführung zusammengefasst. Die Anleitungen betreffen immer solche Maßnahmen, die wir konkret selbst ausgeführt haben: D.h., auch die Erfahrung der praktischen Ausführbarkeit72) ist gegeben. Es lohnt sich in jedem Fall, sich diese Sammlung konkreter Maßnahmen an zu sehen. Dass diese ausgeführten Maßnahmen das leisten, das durch die Bauphysik von ihnen versprochen wird, ist durch wissenschaftlich begleitete Projekte, die z.T. schon Jahrzehnte erfolgreich in praktischer Nutzung sind, belegt. Dennoch nehmen wir die Gelegenheit war, die in der unmittelbaren Umgebung des Institutes ausgeführten Maßnahmen ebenfalls messtechnisch zu begleiten.
Abb. 21Dass die Wärmedämmung von Hüllflächen der Gebäude bedeutend den Verbrauch an Heizenergie reduziert, das wird an den Ergebnissen in diesem Blog zum „Heizen mit nur einem einzelnen Splitgerät“ für ein richtig gut gebautes Wohnhaus deutlich. Auch bestehende Gebäude können mit verbessertem Wärmeschutz nachgerüstet werden, das ist ein entscheidender Teil zum Gelingen der Energiewende. Auf den Seiten zu Energieeffizienz-Jetzt geben wir dazu konkrete Anleitungen, die auf dem gesammelten Know-how zehntausender realisierter Neubauten und Bestandsgebäude beruhen. Diese Anleitungen beruhen immer auf dem Stand der Erkenntnis der Bauphysik - dort sind die entscheidenden Fakten zur korrekten Ausführung zusammengefasst. Die Anleitungen betreffen immer solche Maßnahmen, die wir konkret selbst ausgeführt haben: D.h., auch die Erfahrung der praktischen Ausführbarkeit72) ist gegeben. Es lohnt sich in jedem Fall, sich diese Sammlung konkreter Maßnahmen an zu sehen. Dass diese ausgeführten Maßnahmen das leisten, das durch die Bauphysik von ihnen versprochen wird, ist durch wissenschaftlich begleitete Projekte, die z.T. schon Jahrzehnte erfolgreich in praktischer Nutzung sind, belegt. Dennoch nehmen wir die Gelegenheit war, die in der unmittelbaren Umgebung des Institutes ausgeführten Maßnahmen ebenfalls messtechnisch zu begleiten. 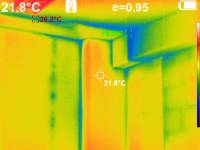 Abb. 22Eine besonders wirksamere Dämmung von Außenwänden erfolgt natürlich von der Außenseite - und bei Gelegenheit werden wir das hier noch einmal im Detail mit Messergebnissen darstellen. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist eine außenliegende Dämmung aber nicht überall möglich. In solchen Fällen ist - fast immer73) eine innenliegende Dämmung besser als gar keine Dämmung. Für diese Innendämmungen gibt es sogar eine Fülle unterschiedlicher Ausführungsmöglichkeiten, die alle gute Ergebnisse versprechen. Die beiden entscheidenden Merkmale sind: (1) Die Dämmschicht muss gegenüber der Raumluft luftdicht sein, damit konvektiv nicht große Mengen an Raumluftfeuchtigkeit an die dann kalte alte Oberfläche gelangen kann, und (2) schädliche Wärmebrücken mit zu niedrigen raumseitigen Innenoberflächen müssen entschärft werden - und wie das genau geht74) , das beschreiben wir detailliert in den jeweiligen Anleitungen. Sechs unterschiedliche Varianten zur Innendämmung haben wir konkret mit modernen Werkzeugen in den eigenen Räumlichkeiten im Jahr 2022 ausgeführt - und da wird auch jeweils nochmals gemessen und der Erfolg kontrolliert. Auch darüber wird noch im Einzelnen berichtet werden. Soviel kann allerdings schon jetzt verraten werden: Bisher, Messungen bis zum 20. Dezember berücksichtigt, funktionieren alle sechs Varianten genau wie zuvor erwartet. Abb. 22 zeigt das Wärmebild an einer Innenecke zur Geschossdecke; dabei waren es um 22°C Innentemperatur und um 0°C außen). Das Bild zeigt: Es gibt einen sicheren Abstand zur Taupunkttemperatur (die hier um 9°C liegt); keine Gefahr für erhöhte Feuchtigkeit und ohnehin kein Tauwasser; das geht somit auch mit Innendämmung - wenn die Randbereiche wie beschrieben mit Dämmkeilen 'entschärft' werden. So, wie beschrieben, kann das somit gemacht werden - und es spart jeweils eine Menge Energie, CO2 und Geld.
Abb. 22Eine besonders wirksamere Dämmung von Außenwänden erfolgt natürlich von der Außenseite - und bei Gelegenheit werden wir das hier noch einmal im Detail mit Messergebnissen darstellen. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist eine außenliegende Dämmung aber nicht überall möglich. In solchen Fällen ist - fast immer73) eine innenliegende Dämmung besser als gar keine Dämmung. Für diese Innendämmungen gibt es sogar eine Fülle unterschiedlicher Ausführungsmöglichkeiten, die alle gute Ergebnisse versprechen. Die beiden entscheidenden Merkmale sind: (1) Die Dämmschicht muss gegenüber der Raumluft luftdicht sein, damit konvektiv nicht große Mengen an Raumluftfeuchtigkeit an die dann kalte alte Oberfläche gelangen kann, und (2) schädliche Wärmebrücken mit zu niedrigen raumseitigen Innenoberflächen müssen entschärft werden - und wie das genau geht74) , das beschreiben wir detailliert in den jeweiligen Anleitungen. Sechs unterschiedliche Varianten zur Innendämmung haben wir konkret mit modernen Werkzeugen in den eigenen Räumlichkeiten im Jahr 2022 ausgeführt - und da wird auch jeweils nochmals gemessen und der Erfolg kontrolliert. Auch darüber wird noch im Einzelnen berichtet werden. Soviel kann allerdings schon jetzt verraten werden: Bisher, Messungen bis zum 20. Dezember berücksichtigt, funktionieren alle sechs Varianten genau wie zuvor erwartet. Abb. 22 zeigt das Wärmebild an einer Innenecke zur Geschossdecke; dabei waren es um 22°C Innentemperatur und um 0°C außen). Das Bild zeigt: Es gibt einen sicheren Abstand zur Taupunkttemperatur (die hier um 9°C liegt); keine Gefahr für erhöhte Feuchtigkeit und ohnehin kein Tauwasser; das geht somit auch mit Innendämmung - wenn die Randbereiche wie beschrieben mit Dämmkeilen 'entschärft' werden. So, wie beschrieben, kann das somit gemacht werden - und es spart jeweils eine Menge Energie, CO2 und Geld.
Innenraumqualität im Passivhaus Kranichstein: relative Luft-Feuchtigkeit (23. Dezember)
Das war ein enormer Temperatursprung im Außenbereich: Von nur um -8°C auf deutlich über 9°C, verbunden mit einer Zunahme der relativen Feuchtigkeit der Außenluft auf nahezu 100%; jetzt, da es regnet, sehr nahe dran. Wie wirkt sich das auf den Innenraum aus? Nun, die Temperaturen haben sich kaum geändert, dafür ist das thermostatisch geregelte Split-Heizgerät ja da; weniger als ein halbes Grad macht der Außeneinfluss auch in den entlegenen Räumen im Dachgeschoss aus. Der Verbrauch dafür geht, wie zu erwarten, spürbar zurück, nur noch um 300 Wattel nimmt das Gerät jetzt im Durchschnitt auf; dabei unterstützt auch noch, dass bei kleineren Leistungen die Temperaturdifferenzen an den Wärmeübertragern geringer werden und die Wärmequelle der Wärmepumpe, die Außenluft, soviel wärmer ist: auch das „Abtauen“ kommt jetzt nicht mehr vor. Ein wenig deutlicher werden die Unterschiede durch das Außenklima bei den Messwerten zu den Raumluftfeuchten: Die lagen in der Kälteperiode zwischen 36% und 43% (jeweils immer noch ideal für die Bedürfnisse der Menschen und völlig unproblematisch bzgl. potentieller Feuchtebelastungen der Bauteile), sie liegen jetzt zwischen 45% und 51% (weiter im optimalen Bereich für uns Menschen - und weiter unkritisch für die Bausubstanz); diese Unterschiede sind aber in den Messergebnissen klar zur verfolgen. Auch 100% relative Feuchte Außenluft hat, bei 10° Frischluftemperatur, hereingeholt als Zuluft75) nur noch eine relative Feuchtigkeit von 52,5%. Wen das verwundert - diese Zusammenhänge sind leicht zu verstehen und können z.B. hier: "Grundlagen feuchte Luft" nachgelesen werden.
Heiligabend (24. Dez. 2022)
Die traditionelle Feier eines Festes der Freude: Schon die Alten wussten sehr wohl, dass es der Frieden ist, der den Menschen gut tut - der großen Mehrheit der Menschen zumindest. Wir wünschen allen Lesern ein friedliches Fest - und die Besinnung auf die Schönheit und Einzigartigkeit der uns umgebenden Natur. Wir Menschen sind ein Teil dieser Natur - und unser Leben hängt mit den Bedingungen unseres Ökotops untrennbar zusammen. Diese haben unsere Art seit Beginn ihrer Existenz eine beispiellose Entwicklung ermöglicht. Wir müssen bedenken, dass nicht wir es sind, die diese Bedingungen geschaffen haben - und wir sollten uns nicht anmaßen, diese Bedingungen so zu verändern, dass es nicht nur für uns, sondern für viel zu viele mit uns in Synergie lebende Arten ungemütlich wird auf dem Planeten. Lassen Sie mich aus Carl Sagans „Kosmos“ zitieren: „…Es gibt vielleicht keine bessere Veranschaulichung der Torheit der menschlichen Überheblichkeit als das ferne Bild unserer winzigen Welt. Für mich unterstreicht es unsere Verantwortung, freundlicher miteinander umzugehen und den blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu schätzen.“
Carl Sagan: "The Pale blue dot"
\\ \\ ===== Zielführend: Verlustreduktion auf nahe Null; hier die Außenwand (26. Dezember) =====
In den bisherigen Berichten wurde deutlich, wie extrem gering der Energieverbrauch für die Heizung auch bei strenger Kälte in diesem Gebäude noch ist - und das bei Innentemperaturen, die im Komfortbereich liegen. Dass das hier so möglich ist, dahinter steckt kein Geheimnis: der Grund ist offensichtlich. Es ist der bereits im Blog vom 9. Dezember erwähnte sehr niedrige spezifische Wärmeverlust durch die Hülle des Hauses in die kalte Umgebung: wir hatten diesen schon mit um 82 W/K76) angegeben; bei den um -8 °C mittleren Außentemperaturen in der Frostperiode aber immer noch um 20°C innen sind es $ \dot{Q} = H \cdot \left( \theta_i - \theta_e \right) = $ 82 W/K ( 20 - (-8) ) K = 2296 W Ein bedeutender Beitrag zu diesen Verlusten ist auch in diesem Gebäude immer noch der Wärmestrom durch die Außenwände - einfach weil diese die weit überwiegende Fläche für den Wärmeaustausch darstellen (etwa 140 m²). Dabei sind unsere Außenwände tatsächlich sehr gut wärmegedämmt - mit einer Gesamtdämmstärke von rund 27,5 cm und einem konventionellen Dämmstoff77) . 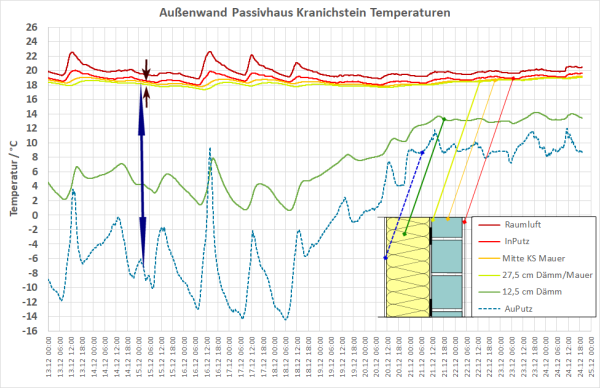 Abb. 23Abb. 23 zeigt die gemessenen Temperaturen an den Oberflächen und im Inneren der westlichen Außenwand in der gerade vergangenen Periode vom 13 bis zum 25.12.2022. Die Lage der hier verwendeten Temperatursensoren78) gehen aus dem mit dargestellten Querschnitt hervor. Wir konzentrieren und zunächst auf drei Sensoren: Den an der inneren Oberfläche des Innenputzes79) , den an der Außenseite im Außenputz80) und den an der Grenzfläche des gemauerten tragenden Teils der Wand zum Dämmstoff81) . Die Temperaturen der Innenoberfläche sind nur ganz wenig verschieden von denen der Raumluft im betreffenden Raum82) . Das allein zeigt schon, dass über die Wand nur wenig Wärme abfließt. Aber wir können das noch klarer durch den Vergleich der Verläufe bei den drei ausgewählten Sensoren sehen: Wie die beiden schwarzen Pfeile zeigen, ist die Temperaturdifferenz zwischen der Innenoberfläche und der Grenzfläche zwischen der gemauerten Wand und der außenliegenden Dämmung nur gering; im Mittel über den gesamten Zeitraum sind es gerade 0,66°C83) . Dagegen ist die Temperaturdifferenz zwischen der Grenzfläche Mauer/Dämmung und dem Außenputz hoch, nämlich im zeitlichen Mittel 18,5°C. Es ist also so, dass fast der gesamte Abfall der Temperatur innerhalb der Dämmschicht stattfindet. Dort allerdings ist Wärmeleitfähigkeit gering, so wird der Wärmeabfluss begrenzt. Der Temperaturabfall über der tragenden Mauer ist nur ca. ein 29stel der gesamten Temperaturdifferenz. Ohne die Dämmschicht müsste die Temperatur fast vollständig über der Mauer abgebaut werden. Entsprechend der sehr viel höheren Wärmeleitfähigkeit des dort verwendeten Kalksandsteins ergibt sich dann ein um nahe am Faktor 29 liegender höherer Wärmeverlust. Abb. 23 macht die enorme Wirkung dieses verbesserten Wärmeschutzes unmittelbar erkennbar. In unserer Nachuntersuchung zum 25jährigen Jubiläum dieses Hauses haben wir aber auch die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes noch einmal im Labor nachgemessen. Das hatte auf einen Wert von 0,0412(12) W/(mK) geführt84) . Ein Ergebnis, das im Rahmen der Messgenauigkeit den Literaturwerten für das Material im Neuzustand entspricht. Der volle Bericht zu dieser Nachuntersuchung kann hier auf Passipedia nachgelesen werden [Feist, Pfluger 2016][Feist 2022].
Abb. 23Abb. 23 zeigt die gemessenen Temperaturen an den Oberflächen und im Inneren der westlichen Außenwand in der gerade vergangenen Periode vom 13 bis zum 25.12.2022. Die Lage der hier verwendeten Temperatursensoren78) gehen aus dem mit dargestellten Querschnitt hervor. Wir konzentrieren und zunächst auf drei Sensoren: Den an der inneren Oberfläche des Innenputzes79) , den an der Außenseite im Außenputz80) und den an der Grenzfläche des gemauerten tragenden Teils der Wand zum Dämmstoff81) . Die Temperaturen der Innenoberfläche sind nur ganz wenig verschieden von denen der Raumluft im betreffenden Raum82) . Das allein zeigt schon, dass über die Wand nur wenig Wärme abfließt. Aber wir können das noch klarer durch den Vergleich der Verläufe bei den drei ausgewählten Sensoren sehen: Wie die beiden schwarzen Pfeile zeigen, ist die Temperaturdifferenz zwischen der Innenoberfläche und der Grenzfläche zwischen der gemauerten Wand und der außenliegenden Dämmung nur gering; im Mittel über den gesamten Zeitraum sind es gerade 0,66°C83) . Dagegen ist die Temperaturdifferenz zwischen der Grenzfläche Mauer/Dämmung und dem Außenputz hoch, nämlich im zeitlichen Mittel 18,5°C. Es ist also so, dass fast der gesamte Abfall der Temperatur innerhalb der Dämmschicht stattfindet. Dort allerdings ist Wärmeleitfähigkeit gering, so wird der Wärmeabfluss begrenzt. Der Temperaturabfall über der tragenden Mauer ist nur ca. ein 29stel der gesamten Temperaturdifferenz. Ohne die Dämmschicht müsste die Temperatur fast vollständig über der Mauer abgebaut werden. Entsprechend der sehr viel höheren Wärmeleitfähigkeit des dort verwendeten Kalksandsteins ergibt sich dann ein um nahe am Faktor 29 liegender höherer Wärmeverlust. Abb. 23 macht die enorme Wirkung dieses verbesserten Wärmeschutzes unmittelbar erkennbar. In unserer Nachuntersuchung zum 25jährigen Jubiläum dieses Hauses haben wir aber auch die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes noch einmal im Labor nachgemessen. Das hatte auf einen Wert von 0,0412(12) W/(mK) geführt84) . Ein Ergebnis, das im Rahmen der Messgenauigkeit den Literaturwerten für das Material im Neuzustand entspricht. Der volle Bericht zu dieser Nachuntersuchung kann hier auf Passipedia nachgelesen werden [Feist, Pfluger 2016][Feist 2022].
Nicht nur die Außenwände sind in dieser Weise gut wärmegedämmt: Das gilt auch für das Dach, die Kellerdecke und selbst die Fensterrahmen. Das „Einpacken in verpackte Luft“ funktioniert an allen Bauteilen so wie geplant85) und reduziert uns die Verluste des Hauses um eine Größenordnung eines Faktors 4. Da aber die inneren Wärmequellen und die passiv solare Gratisenergie auf nahezu dem gleichen Niveau bleiben wie in einem durchschnittlichen Gebäude, reduzieren sich dadurch die noch erforderlichen Heizleistungen sogar um Faktoren 8 bis 12 (je nach Wetterlage). Das also ist das (gar nicht so geheime!) Geheimnis für den Erfolg. Die gute Nachricht: Auch in bestehenden Gebäuden lassen sich die Wärmewiderstände der Bauteile nachträglich bedeutend reduzieren - in einer Reihe von Fällen ist das sogar bis zum Passivhaus-Standard gelungen. Oft wäre es zu aufwändig, das für alle Bauteile und Anschlüsse auch im Bestand um zu setzen - hier greift dann „EnerPHit“-Standard, eine auf die vorgefundene Situation bei Bestandsgebäude angepasste Methodik, nach der auch dort sehr geringe Verbrauchswerte erreicht werden können; Faktoren 3 bis 8 gegenüber dem ursprünglichen Zustand sind auch dann möglich. Und damit nahezu alle Vorteile, die sich aus den hier beschriebenen Erfahrungen ergeben.
Erneuerbare Energie für alle (27. Dezember)
Heute früh mit einer kurzen Periode Sonnenschein verwöhnt. Die Außentemperaturen sind aber nach wie vor sehr mild, die Wärmeverluste daher weiterhin gering. In den vergangenen Tagen lag die elektrische Aufnahmeleistung der Split-Wärmepumpe wieder bei nur rund 270 W. Jetzt kommt der Strom auch bereits überwiegend aus erneuerbarer Erzeugung, dafür sorgt das jetzt hohe Windenergie-Angebot. Eine rückblickende Betrachtung zur Frostperiode: Da lag die elektrische Leistung zum Betrieb der Wärmepumpe bei um 430 Watt. Würde jede in Deutschland ansässige Person eine dem entsprechende Leistung86) zusätzlich aus dem Stromnetz beanspruchen, dann kämen dabei etwa 12 GW87) Dauerleistung über die 10 Tage88) dazu. Das ist in etwa ein Sechstel (17%) mehr als die tatsächlich in diesem Zeitraum über das Stromnetz verteilte Leistung. Im gleichen Zeitraum wurden durchschnittlich etwa 9 GW Windstrom erzeugt, der natürlich an anderer Stelle wirklich gebraucht wurde. Allein für die Deckung des nur noch sehr geringen Heizwärmebedarfs von Passivhäusern wäre für eine vollständige Deckung in einer solchen 10-Tages-Flaute mehr als die heutige Windkraftleistung zusätzlich erforderlich. Das illustriert, dass ein vollständig erneuerbares Energiesystem selbstverständlich ein „Backup“ durch in solchen Zeiten einsetzbare gespeicherte Energie benötigt. Im folgenden Abschnitt beschrieben wir eine Möglichkeit, wie das klappen kann - es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, uns erscheint die dargestellte als die naheliegendste. Biomasse ist ein leicht lagerfähiger Energieträger - dieser wird auch heute schon für die Stromerzeugung eingesetzt, allerdings bisher überwiegend in der sog. Grundlast. Biomasse lässt sich z.B. als Biogas erzeugen und dann problemlos so wie heute das Erdgas in den schon vorhandenen Erdgas-Speichern aufbewahren. Wir erzeugen heute etwa 5,5 GWel „Strich“ das ganze Jahr hindurch. Die Stromerzeugung daraus ließe sich in der Zukunft mehr und mehr auf die Monate November bis Februar konzentrieren; die Leistung von Gas-Kraftwerken dafür steht sogar bereits zur Verfügung: etwa 24 GWel lieferten diese zeitweise in diesem Dezember bereits: Für die tatsächlich von Flauten beherrschten Zeiträume würde schon das auch für den Leistungsbedarf von Wärmepumpen - auf dem Niveau der Passivhaus-Effizienz - ausreichen. Anders, wenn die nachgefragte elektrische Durchschnittsleistung das 8fache des Wertes im Vergleich zur Passivhaus-Effizienz wäre (so, wie das derzeit etwa für konventionelle Altbauten im Durchschnitt zutrifft). Die dann allein für die Haushalte für die Wärmepumpen benötigte Backup-Leistung läge dann bei etwa 100 GWel; das ist in etwa die Höhe der heutigen gesamten verfügbaren Leistung zur Stromerzeugung in Deutschland. Diese würde einerseits als zusätzlich installierte Windleistung (für die Zeiten außerhalb der Flauten) und zusätzlich mit Backup-Erzeugern benötigt. Solche Ausbaupläne liegen bisher nicht vor und sie würden auch ziemlich teuer werden. 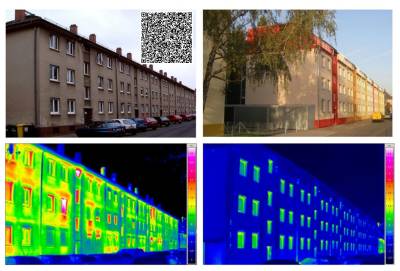 Abb. 24Das heißt aber nicht, dass eine erneuerbare Zukunft schwierig oder gar unmöglich wäre: Denn, die erforderlichen Leistungen lassen sich auch in den bestehenden Gebäuden stark reduzieren, denn die Techniken der Passivhaus-Effizienz haben sich bereits im Einsatz bei der Gebäudemodernisierungbewährt - sie führen dort regelmäßig zu einer Verringerung der Heizlast um etwa einen Faktor 4 [Bastian 2022]. Dann treffen sich die erforderliche Leistung für die Wärmepumpen (dann noch um +25 GW Durchschnittsleistung in einer Frostperiode) mit den Windkraft-Ausbauzielen und einem leicht ausgebauten Backup an mit Biomethan89) betriebenen GUD-Kraftwerken90) . Die Energiewende kann so funktionieren - und, so wie gerade beschrieben, sogar mit nahezu ausschließlich in Mitteleuropa gewonnener erneuerbarer Energie. Ein ganz entscheidender Beitrag dazu ist die erheblich verbesserte Energie-Effizienz, vor allem im Bestand der Gebäude. Dass das geht, wurde durch bereits vorliegende tausendfache Umsetzung belegt. Es kann sogar schrittweise angegangen werden, wie unsere detaillierten Beschreibungen unter „Energieeffizienz JETZT“ zeigen. Das ermöglicht nicht nur die künftige nachhaltige Versorgung für alle, es spart auch heute bereits umfassend fossile und teure Energie; und die Emissionen, die bei deren Verbrennung entstehen. Es gibt somit Perspektiven der erneuerbaren Energie Versorgung für alle - und die sind sogar innerhalb weniger Jahrzehnte realisierbar, sogar mit bereits heute verfügbarer kostengünstiger Technik.
Abb. 24Das heißt aber nicht, dass eine erneuerbare Zukunft schwierig oder gar unmöglich wäre: Denn, die erforderlichen Leistungen lassen sich auch in den bestehenden Gebäuden stark reduzieren, denn die Techniken der Passivhaus-Effizienz haben sich bereits im Einsatz bei der Gebäudemodernisierungbewährt - sie führen dort regelmäßig zu einer Verringerung der Heizlast um etwa einen Faktor 4 [Bastian 2022]. Dann treffen sich die erforderliche Leistung für die Wärmepumpen (dann noch um +25 GW Durchschnittsleistung in einer Frostperiode) mit den Windkraft-Ausbauzielen und einem leicht ausgebauten Backup an mit Biomethan89) betriebenen GUD-Kraftwerken90) . Die Energiewende kann so funktionieren - und, so wie gerade beschrieben, sogar mit nahezu ausschließlich in Mitteleuropa gewonnener erneuerbarer Energie. Ein ganz entscheidender Beitrag dazu ist die erheblich verbesserte Energie-Effizienz, vor allem im Bestand der Gebäude. Dass das geht, wurde durch bereits vorliegende tausendfache Umsetzung belegt. Es kann sogar schrittweise angegangen werden, wie unsere detaillierten Beschreibungen unter „Energieeffizienz JETZT“ zeigen. Das ermöglicht nicht nur die künftige nachhaltige Versorgung für alle, es spart auch heute bereits umfassend fossile und teure Energie; und die Emissionen, die bei deren Verbrennung entstehen. Es gibt somit Perspektiven der erneuerbaren Energie Versorgung für alle - und die sind sogar innerhalb weniger Jahrzehnte realisierbar, sogar mit bereits heute verfügbarer kostengünstiger Technik.
Mildes Wetter zum Jahresausklang (28. Dezember 2022)
Die Außentemperaturen sind außergewöhnlich hoch für den Kernwinter in Mitteleuropa (zwischen 4 und 12 °C). Das führt natürlich zu niedrigen Wärmeverlusten - das gilt für gewöhnliche Gebäude ebenso wie für unser Passivhaus. Für die vielen schlecht gedämmten Gebäude im Bestand bedeutet es, dass wir ziemliches Glück haben diesen Winter nach den enormen Preiszunahmen beim Heizöl und Erdgas - aus denen immer noch der weit überwiegende Teil der Heizwärme gewonnen wird91) . Im Passivhaus liegt die mittlere elektrische Leistung zum Betrieb unseres Splitgerätes seit Tagen im Bereich von etwa 260 Watt; und dabei haben die Temperaturen in den Innenräumen jetzt sogar wieder leicht zugenommen, sie liegen im Durchschnitt sogar etwas über 20 °C; immer, wenn die Sonne einmal hinter den Wolken herausschaut, erfüllen sich die Räume zusätzlich mit Licht und Wärme.
Nachrichten aus der Realität - die Lösungen sind gar nicht so schwer (am 30. Dez. 2022)
Wissen wir eigentlich wirklich "sicher", dass es ein Klimaproblem gibt?
Ja, das ist wissenschaftlich mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit belegt. Ist das absolut sicher? Aussagen über die reale Welt können in einem mathematisch strengen Sinn niemals absolut sicher sein; im praktischen Leben würde dennoch kaum ein Mensch einen Pfad wählen, der mit 99,8% Wahrscheinlichkeit zum Absturz führt. Ich werde hier auf spezielle Einwände und Details nicht eingehen, weil das Klimawissenschaftler an anderer Stelle unübertreffbar gut machen (z.B. Prof. Stefan Rahmstorf). Einen generellen Umstand bei dieser Frage will ich aber erwähnen: Die historisch verfolgbaren Belege für eine weltweite Veränderung des Klimas sind unabhängig voneinander in verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft aufgefallen; ob das der Rückgang der Gletscher, das Ansteigen der Meeresspiegel, die Abnahme des Meereises, die Zunahme von Waldbränden, die Abnahme des PH-Wertes von Meerwasser, die Wanderung von Arten oder die Chemie der Atmosphäre ist(hier gibt es ein kurzes Video (englisch) mit einer Zusammenstellung der wissenschaftlich belegten Entwicklung: "Is there any evidence of climate change?").
Alle diese Auswirkungen sind jeweils auf die klimatischen Veränderungen zurückführbar - und dass diese Auswirkungen vorliegen, davon kann sich jede Person leicht selbst überzeugen. Ich habe meine Studenten in Innsbruck z.B. zu einer Gletschertour eingeladen; vielmehr einer Tour durch das, was von den „Fernern“ in Tirol noch übrig ist. Einige konnten von ihren Großeltern alte Fotos bekommen - auf denen gut zu sehen ist, wie weit die Ausdehnung des Eises vor einigen Jahrzehnten noch war92) .
Wissen wir eigentlich wirklich, dass es die Kohlendioxid-Emissionen sind?
Ja, auch das weiß die Wissenschaft mit hoher Zuverlässigkeit. Es ist nicht allein das CO2, CH4 (Methan) hat ebenfalls einen sehr hohen Anteil. Wieder ist das im Grundsatz leicht nachvollziehbar93) . Die Absorptionsbanden des CO2 im Infraroten sind seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, die Strahlungsdurchlässigkeit der Atmosphäre lässt sich messen, und sogar die thermische Abstrahlung können wir inzwischen aus dem Weltall messen.
Wissen wir eigentlich wirklich, dass das zusätzliche CO2 aus der Verbrennung fossiler Energiequellen kommt?
Ja, das ist mit außerordentlich hoher Zuverlässigkeit bekannt94) : Die Mengengerüste stimmen95) , keine andere Emissionsquelle kann derzeit Mengen in dieser Höhe erreichen96) . Der entscheidende Beleg ist, dass die Isotopenzusammensetzung stimmt. Fossiler Kohlenstoff hat ein wohlbekanntes anderes Isotopengemisch97) als der Kohlenstoff aus dem biologischen Kreislauf. Es ist die Verbrennung und es ist der fossile Kohlenstoff (auch dazu gibt es ein kurzes Video (englisch) mit einer Zusammenstellung der wissenschaftlich belegten Entwicklung: "Is it really the CO2 from fossil fuels?"; ein weiteres, etwas längeres Video erklärt einige der Details: "Is Climate Change Man Made? The Surprising Data!"(Arvin Ash).)
Ist die Verbrennung fossiler Energie nicht unverzichtbar, wenn wir den Wohlstand halten wollen?
Das ist ein sehr weit verbreiteter Mythos. Der auf einem konkreten Kern beruht: Denn, dass wir innerhalb weniger Jahrzehnte eine sehr hohe Steigerung des Wohlstandes erreicht haben, das ist tatsächlich von einem massiv gesteigerten Einsatz von fossiler Energie begleitet worden. Ein Irrtum ist aber, dass der Wohlstand nur auf diesem Weg erreichbar oder gar nur so zu halten wäre. Vielmehr liegen in allen Anwendungsbereichen bereits heute gut gangbare alternative Lösungen vor - sei es die Elektrotraktion beim Straßenverkehr oder die photovoltaische Stromerzeugung. Richtig ist allerdings, dass wir in vielen Jahrzehnten technische Strukturen aufgebaut haben, von denen das ökonomische System in seiner Normalfunktion entscheidend abhängt: So lässt sich ein Verlust von 600 TWh Erdgas-Lieferung nicht innerhalb weniger Monate durch neue dezentrale Erzeugung aufwiegen - der Aufbau dieser Strukturen hat Jahrzehnte benötigt, die 'normal' ablaufende Umstellung auf andere Strukturen benötigt Zeiträume in der gleichen Größenordnung. Das lässt sich rein technisch gesehen etwas beschleunigen - dann stellt sich aber die Frage nach der vorzeitigen Aufgabe von vorhandenen ökonomischen Werten. Gebäude (und zwar deren Energieverbrauch im Betrieb) machen gut ein Drittel dieser Struktur aus. Wir haben auf den Seiten von Passipedia.de umfassend dokumentiert, wie sich der fossile Verbrauch der Gebäude systematisch auf nahe Null reduzieren lässt - auch schrittweise, wenn die Umstände so liegen. Einen Wohlstandsverzicht gibt es dabei nicht - im Gegenteil, der Komfort wird dadurch sogar verbessert und die Gesamtkosten reduzieren sich. Ein erheblich höherer Anteil der Wertschöpfung würde dadurch in Europa liegen. Welcher technologische Pfad von einer Gesellschaft eingeschlagen wird, hängt von vielen psychologischen, sozialen, ökonomischen und politischen Randbedingungen ab; diese Pfade sind keinesfalls (z.B. durch die Technologieentwicklung) vorgezeichnet. Nehmen wir ein Beispiel, Individualfahrzeuge: Das erste Auto (https://de.wikipedia.org/wiki/Benz_Patent-Motorwagen_Nummer_1) baute gut erkennbar auf Fahrradtechnologie auf. In der weiteren Entwicklung wurden die Autos dann aber immer größer und schwerer - der „Entwicklungsdruck“ in diese Richtung kam von gesellschaftlichen Prioritäten, nicht aus technischer Notwendigkeit. Ermöglicht wurde es durch die Überzeugung, dass der Treibstoff (aus Erdöl) extrem billig ist und auch so billig bleibt und auch ansonsten keinerlei ernste Probleme bereitet. Schon 1881 gab es Prototypen ähnlicher Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb; eine Alternative, die ebenfalls wegen des vermeintlich billigen Erdöls mit nur wenig Nachdruck verfolgt wurde.
Ist das alles vor allem ein Verbrauch der Industrie?
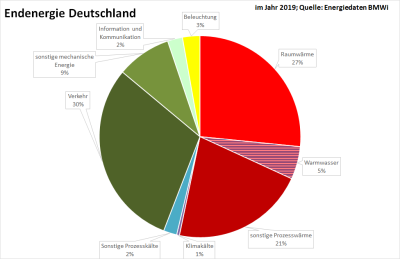 Abb. 24Das ist ein ebenfalls sehr weit verbreiteter Mythos. Natürlich verbraucht die Industrie nennenswerte Energiemengen, in Deutschland sind das rund 28% des Energieverbrauchs. Weit entscheidender für die Lösungen ist, wofür die Energie genau eingesetzt wird - da liegt die Prozesswärme in der Summe bei rund 21%98) . Der größte Brocken ist inzwischen der Energieverbrauch im Verkehr mit 30%; ganz überwiegend ist das Kraftstoff für Personenkraftwagen. Dicht gefolgt vom Verbrauch für die Raumheizung99) mit 27%. Ohne eine bedeutende Reduktion der Verbrauchswerte bei den höchsten Brocken kann die Energiewende nicht gelingen. Auch für die anderen Anwendungsfelder ist die Erhöhung der Effizienz vorrangig - und in weiten Bereichen möglich, so dass eine Versorgung aus erneuerbaren Quellen möglich wird. Ein geringerer Verbrauch an nicht aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen Materialien100) kann ebenfalls zur Zielerreichung beitragen. Dabei stehen längere Nutzungsdauern, verbesserte Wiederverwendung und Umstellung auf weniger energieintensive Materialien im Vordergrund. Der bei weitem überwiegende Teil der fossilen Energie wird aber gar nicht für die Rohstoffumwandlung eingesetzt, sondern, wie schon ausgeführt, für Verkehr, Heizung, Warmwasser, Klimatisierung und viele weitere Anwendungen, deren Verbrauchswerte sich aufaddieren. So ist eine Verbesserung bei dem oft „graue Energie“ genannten Teil ein wichtiger Beitrag - jedoch nicht der entscheidende und schon gar nicht ausreichend für eine Lösung der Krise.
Abb. 24Das ist ein ebenfalls sehr weit verbreiteter Mythos. Natürlich verbraucht die Industrie nennenswerte Energiemengen, in Deutschland sind das rund 28% des Energieverbrauchs. Weit entscheidender für die Lösungen ist, wofür die Energie genau eingesetzt wird - da liegt die Prozesswärme in der Summe bei rund 21%98) . Der größte Brocken ist inzwischen der Energieverbrauch im Verkehr mit 30%; ganz überwiegend ist das Kraftstoff für Personenkraftwagen. Dicht gefolgt vom Verbrauch für die Raumheizung99) mit 27%. Ohne eine bedeutende Reduktion der Verbrauchswerte bei den höchsten Brocken kann die Energiewende nicht gelingen. Auch für die anderen Anwendungsfelder ist die Erhöhung der Effizienz vorrangig - und in weiten Bereichen möglich, so dass eine Versorgung aus erneuerbaren Quellen möglich wird. Ein geringerer Verbrauch an nicht aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen Materialien100) kann ebenfalls zur Zielerreichung beitragen. Dabei stehen längere Nutzungsdauern, verbesserte Wiederverwendung und Umstellung auf weniger energieintensive Materialien im Vordergrund. Der bei weitem überwiegende Teil der fossilen Energie wird aber gar nicht für die Rohstoffumwandlung eingesetzt, sondern, wie schon ausgeführt, für Verkehr, Heizung, Warmwasser, Klimatisierung und viele weitere Anwendungen, deren Verbrauchswerte sich aufaddieren. So ist eine Verbesserung bei dem oft „graue Energie“ genannten Teil ein wichtiger Beitrag - jedoch nicht der entscheidende und schon gar nicht ausreichend für eine Lösung der Krise.
Perspektiven der Hoffnung: Doch, es ist immer noch lösbar
Zu oft höre ich, von verschiedenen Seiten, dass es „jetzt ja zu spät sei“ daran noch etwas ändern zu wollen. Diese Einschätzung ist grundfalsch. Wir Menschen sind es, die die Probleme aktiv erzeugen - und an vielen Stellen würde es einfach ausreichen, wenn wir solche Aktivitäten, die eigentlich wirklich niemand braucht, einfach einstellen würden. Ja, das fällt oft wegen der Macht der Gewohnheiten schwer. Aber: Das ist leistbar, denn für die wirklich essentiellen Dinge des Lebens versorgen uns die Sonne und der Planet Erde mit allem, was wir brauchen. Es ist an vielen Stellen sogar noch einfacher: Die Dienstleitung, die uns so wichtig ist (wie z.B. das Kühlen von Nahrungsmitteln) können sogar auf gleichem Niveau mit nur einem Viertel des bisherigen Aufwandes gewährleistet werden - und die Umstellung solcher Infrastruktur ist, wenn wir das gezielt angehen, in weniger als einer Dekade zu leisten101) . Alle können zu einer solchen Umstellung beitragen, auch und insbesondere „in den eigenen vier Wänden“. Der zweite Beitrag, von der Versorgungsseite her, ist durchaus ebenfalls schon ein wenig in Gang gekommen - wenn auch die heutigen Neuinstallationen von Photovoltaik und Windgeneratoren bei weitem nicht ausreichen, um schnell genug von fossiler Energie los zu kommen. Auch in diesem Bereich muss erheblich mehr geschehen und das ist auch möglich. Ein dritter Bereich ist der verschwenderische Materialumlauf: Längere Nutzungsdauern von z.B. Fahrzeugen, Möbeln, Elektronik - das ist kein technisches Problem, sondern allein eine Frage des bewussteren Umgangs. Selbst bei der Ernährung102) ist die Umstellung bei weitem nicht so schwer, wie es manchmal vermittelt wird: Im Grunde kommt es nur darauf an, Schritt für Schritt weniger tierische Nahrung zu konsumieren und zugleich die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu vermeiden (eine gute Zusammenfassung dazu findet sich hier: https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food).
Ja, das sind durchaus bedeutende Umstellungen - interessanterweise viel weniger bedeutend für unser tägliches Leben, bei dem es auch nach der Umstellung für alle alles gibt, was Menschen für ein gutes Leben wünschen, sondern vor allem für die Art, wie wir uns diese Annehmlichkeiten aus der Umwelt „besorgen“: Räuberisch 'ohne Rücksicht auf Verluste', so wie es jetzt viele Jahrzehnte lang ausgebaut wurde ODER durch Eingliederung in ökologische Kreisläufe, die in der Lage sind, uns dauerhaft alles zu liefern, was wir für ein gutes Leben benötigen. Eine der Ängste scheint zu sein, dass das ja auf eine „Stagnation“ hinaus liefe103) . Das ist aber nicht so: Denn, die Effizienz unserer Techniken des Eingliederns in bestehende Kreisläufe, ohne diese zu schädigen, hat über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte sehr stark zugenommen - das ist der Fortschritt, den wir hatten und den wir auch künftig haben können. Künftig kann in dem Ausmaß, indem diese 'Eingliederungs'effizienz gesteigert wird, durchaus auch der materielle Wohlstand104) jeweils im nachhaltigen Maß weiter zunehmen. „Wohlstand“ besteht aber auch nicht nur aus materiellen Gütern; Kunst und Erkenntnis sind Teile der Kultur, sogar ganz zentrale Teile. Deren Wachstum ist nahezu unbegrenzt möglich105) . Die Aussichten sind gar nicht so trübe, wie es mancherorts dargestellt wird. Nur eines ist allerdings klar: Einfach „weiter so wie bisher“, das kann nicht funktionieren. Die erforderlichen Änderungen müssen aber letztlich nicht wirklich schmerzhaft sein106) .
31. Dezember; es ist vereinbart, dass da das Jahr 2022 zu Ende geht
Jahresrückblicke und Reflexionen sind jetzt überall zu lesen. Häufig sind es Versuche, mit dem oftmals Unfassbaren umzugehen, das uns 2022 begegnet ist. Längst vergessene (oder verdrängte?) Zeiten scheinen zurückgekehrt. Es ist schon richtig: Wir waren, zumindest gefühlt, schon einmal weiter. Weiter in der Erkenntnis, dass die Gewalt die Lage nicht verbessert. Weiter in der Erfahrung, dass es 'keine Probleme gibt' sondern Aufgaben, die es zu lösen gilt. Bei Letzterem wollen wir bleiben, zumindest hier auf http://passipedia.de.
Da ging es konkret konstruktiv zu: Zig Seiten kamen hinzu, die beschreiben, wie wir konkret zumindest die aktuelle Energiekrise abmildern können: Energieeffizienz Jetzt. Und auch die Seiten zum Hintergrund konnten erweitert werden, z.B. mit leicht verständlichen Erklärungen zum Thema Luftfeuchtigkeit und Taupunkt. Das wird im nächsten Jahr fortgesetzt - das ist unser Verständnis von offener Wissenschaft: Diese muss verständlich sein für alle, die sie anwenden. Es geht nicht allein um praktische Anleitungen, sondern auch darum, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen. Denn, das ist nicht so schwierig, wie es oft angenommen wird. Menschen mit solchem Verständnis - denen können so leicht auch keine Scheinlösungen angeboten werden; denn, natürlich lässt sich das alles107) relativ einfach nachrechnen. Zu oft wurde ich in den vergangenen Jahren mit dem Argument konfrontiert: „Das ist ja alles schön - aber das kommt doch jetzt sowieso alles zu spät“. Kaum eine Aussage ist so grundfalsch wie diese! Die dargestellten Maßnahmen zur Energie-Effizienzverbesserung sind, jede für sich, in wenigen Stunden bis maximal Tagen im eigenen Umfeld umsetzbar. Vieles kann selbst gemacht werden - und wer das nicht kann oder dafür keine Zeit hat, kann sich kompetente Hilfe holen. 'Lohnen' werden sich diese Maßnahmen auch, in aller Regel mindestens dreifach: 1) Es werden Energiekosten gespart. 2) Es bleibt der Komfort erhalten oder er wird sogar verbessert. 3) Die Belastung für die Umwelt nimmt ab, und zwar dramatisch. Werden alle alles schon im nächsten Jahr machen? Sicher nicht; aber Schritt für Schritt und Jahr für Jahr kann es nahezu überall umgesetzt werden. Dazu ist vor allem wichtig, dass die Ergebnisse dokumentiert und berichtet werden - auch dazu wird es noch mehr auf diesen Seiten zu lesen geben; es ist aber auch schon einiges da, wie z.B. die dokumentierte Nachuntersuchung zu einer Innendämmung aus dem Jahre 1986: Innendämmung 36 Jahre erfolgreich.
Allen Interessierten ein gutes Jahr 2023; die gemeinsame Hoffnung, dass wir es schaffen werden, die Krisen zu überwinden.
Übrigens: So warm wie heute war es im Dezember seit langem nicht mehr. Wir haben heute sogar zusammen auf der Terrasse gefrühstückt. Der Heizwärmeverbrauch ist unter solchen umständen gering: um 5 kWh$_{el}$ wurde für das Splitgerät nur gebraucht und die Temperaturen in den Südräumen waren eine Zeit lang um 22 °C. Wenngleich das eine schöne Pause mit Sonne im Winter darstellt - es erinnert doch daran, wie wir seit Jahrzehnten mit dem Planeten, insbesondere seiner Atmosphäre, umgehen. Es wird wirklich Zeit, dass sich das ändert - noch ist es dafür nämlich nicht zu spät, siehe oben.
2. Januar 2023: Immer noch extrem warm für die Jahreszeit
Seit 2 Wochen ist es in Deutschland mehr als 10 Grad wärmer als typisch für diese Jahreszeit. Die Medien diskutieren die spektakulären Dezember-Höchst-Temperaturen. Das wirklich Ungewöhnliche aber ist dieser lange Zeitraum mit erheblich überhöhten Temperaturen. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Periode ist im mitteleuropäischen Klima gering; ohne Klimaveränderungen müssten wir damit kaum rechnen. Subjektiv freut uns das in der gegenwärtigen Situation sogar: Denn, da wird sehr viel weniger Heizwärme gebraucht, nicht nur in einem Passivhaus108) . Die hohen Temperaturen lassen z.B. den Bedarf an fossilem Gas stark einbrechen - die Gasspeicher füllen sich jetzt sogar wieder und die Preise für das Gas purzeln. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, dass solche Wetterlagen von nun an die „neue Normalität“ werden. Es handelt sich hier um ein Extrem-Wetter-Ereignis. Diese Extrem-Ereignisse nehmen in einer Welt mit höherem CO2-Gehalt der Atmosphäre zu; das ist eine einfache Folge der höheren Inneren Energie. Wie der arktische Lufteinbruch in den USA zeigt, kann extremes Wetter auch in genau die andere Richtung gehen: So, wie wir uns derzeit auf dem Planeten verhalten, verstärken wir die Extreme. Das ist keine neue Erkenntnis, es ist schon seit Jahrzehnten aus den Berichten des IPCC bekannt. Oft wird gesagt: „Was soll's. Wir müssen uns einfach an die neuen Bedingungen anpassen“. Das ist sicher nicht im biologisch-genetischen Sinn gemeint, denn solche Anpassungen dauern viel zu lang. Gemeint ist wohl, dass wir unsere Infrastruktur, z.B. die Straßen, Energiesysteme und Häuser anpassen müssen. Dazu sind dann aber grundlegende Änderungen an diesen Systemen erforderlich: Gebäude müssen dann gegen stärkere Stürme, kälteres und heißeres Wetter und Starkregen besser geschützt werden. Das bedeutet vor allem Änderungen an den Gebäudehüllen; und den Einbau von Klimaanlagen, über die bisher nur wenige Gebäude in Deutschland verfügen. Das alles benötigt Zeit - denn die Arbeitskraft dafür ist begrenzt ebenso wie die Verfügbarkeit der dafür benötigten Komponenten; die Umstellzeit misst sich in Jahrzehnten. Doch, ja, das würde für die meisten von uns schon immer noch rechtzeitig gehen. Eben genau solche Verbesserungen der Gebäudehüllen und der Einbau wärmepumpenbasierter Systeme würde uns gerade auch dabei helfen, die Ursachen für die Klimaveränderungen zu reduzieren: Mit etwas besserem Wärmschutz lassen sich sowohl winterliche Wärmeverluste als auch sommerliche Hitzelasten verringern - und, wenn wir sowieso schon dran sind, am betreffenden Bauteil, dann ist das noch nicht einmal teuer109) . Natürlich „dauert“ auch das die eben aufgeführten Jahrzehnte - bei gutem Willen geht es vielleicht umfassend in 15 Jahren. Es würde überdies erlauben, auch die vorbeugenden Schutzmaßnahmen schneller einzuführen - denn, der bessere Wärmeschutz kostet ja kaum zusätzliche Investitionen, er erlaubt aber permanente Einsparungen bei den Betriebskosten. Damit „rechnen“ sich viele der Maßnahmen, die sonst einfach nur Zusatzkosten darstellen würden. In den Anleitungen werden wir auf einige dieser Mehrfach-Nutzen-Verbesserungen eingehen. Damit lässt sich, in einem Zug,
- Geld sparen
- Energie sparen
- CO2-Emission sparen
- Komfort verbessern
- der Schutz vor Extremwetter verbessern.
Es ist eben nicht richtig, dass es für all das 'ohnehin schon zu spät' sei. Jeder fossile Kohlenstoff, den wir damit nicht mehr verbrennen müssen, reduziert die globale Temperaturerhöhung; doch, 1,7°C mehr wäre leichter zu ertragen als 2°C mehr; und 2°C immer noch leichter als 3°C - bei letzteren Werten wird es dann allmählich fragwürdig, ob das überhaupt noch erträglich sein kann. Bericht aus dem Haus: In meinem 'Homeoffice'-Zimmer liegen die Temperaturen jetzt schon seit Tagen zwischen 20,6 und 22,2 °C, ohne Heizung. Ist das sehr aufwändig, so ein Betriebsverhalten zu erreichen? Inzwischen haben Zehntausende ihre Gebäude so gebaut und Tausende bereits Bestandsgebäude so nachgerüstet; Passivhaus-Komponenten zu verwenden, das ist weit weniger ungewöhnlich, als oft gedacht wird. Nehmen wir die Fenster als Beispiel: Gute Passivhausfenster unterscheiden sich äußerlich kaum von gewöhnlichen Komponenten, die Verbesserungen liegen in der dritten Scheibe, dem nicht-mehr-Aluminium-Randverbund und dem besseren inneren Rahmenaufbau. Das macht diese Fenster nicht bedeutend teurer als die oft eingesetzten Billig-Komponenten. Dafür halten die wirklich tauwasserfreien Fenster auch länger, bieten zusätzlich verbesserten Komfort und exzeptionellen Schallschutz. 'Nebenbei' zahlen sich evtl. Mehrinvestitionen rasch durch eingesparte Energiekosten zurück; bei den gerade extremen Energiepreisen sowieso - und auch künftige Energiekrisen braucht der Nutzer nicht mehr zu fürchten; denn eingespart wird ja nicht nur „ein bisschen was“, vielmehr sind Passivhaus-Fenster in den meisten Himmelsrichtungen „Netto-Wärmegewinn-Fenster“. Sie helfen auch in der kalten Jahreszeit mit, die Verluste anderer Hüllflächen auszugleichen. Dass wir auch diese umfassend verbessern können sei nochmals angemerkt.
6.Januar 2023 und eine Bemerkung zum sogenannten "Rebound"
Die Außentemperaturen liegen weiter zwischen 5 und 12°C; und weiter lugt ab und zu die Sonne zwischen den Wolken hervor. Unter diesen Umständen ist der Verbrauch für die Heizung im Passivhaus extrem niedrig: um die 160 Watt wurde im Durchschnitt für die Split-Wärmepumpe eingesetzt. Dabei wurde es im Haus deutlich wärmer: zwischen 21,5 und 22,5°C liegen die Raum-Temperaturen jetzt; wir könnten die Wärmepumpe also auch ausschalten. Weil der Strom derzeit aber weit überwiegend aus Windkraft kommt und wegen der hohen Lufttemperaturen auch die Verdampfertemperatur der Wärmepumpe und damit der COP110) hoch sind, tanken wir ein wenig Wärme für eine angekündigte kältere Periode ein.
Und eine bittere Erfahrung aus der menschengemachten Umgebung: Das Bestehen auf der Ausweitung der Braunkohlenutzung spaltet die Gesellschaft. Immerhin ist in der Wahrnehmung etwas passiert: Immer mehr Menschen verstehen, dass wir mit dem Verbrennen von Kohlenstoff Probleme erzeugen. Irrtümlich halten viele die aber für wenig bedeutend. Denn die Gründe, die für das immer längere Fortsetzen der Verbrennung angeführt werden, sie kommen nicht entfernt an die Probleme heran, die wir uns durch den fortgesetzten Betrieb einhandeln. Welche Alternativen dazu bestehen, ist allerdings vielerorts ebenfalls nicht verstanden: Es ist schon richtig, dass der Umbau der Versorgungsseite Zeit benötigt - aber es ist ebenso richtig, dass das bei gutem Willen deutlich schneller gehen könnte. Die zusätzliche Nutzung der seit Jahrzehnten brach liegenden Effizienzpotentiale würde uns noch schneller von der fossilen Energie unabhängig machen. Das ist aber offensichtlich noch viel weniger verstanden und auch da werden Scheinprobleme kommuniziert, wie z.B. der Mythos des „Rebound-Effektes“.
Der besteht darin, dass in einem Markt Waren, die günstiger werden111) sozusagen automatisch dafür in höherem Umfang konsumiert werden. Für manche Waren dürfte das auch zutreffen; nur sehr wenig allerdings bei Dienstleistungen, die wir ohnehin schon in der Nähe der Sättigung oder des Überflusses konsumieren. Wenn ich meine Räume im Winter dann über 23°C beheizen sollte, fängt der Komfort sogar an, wieder abzunehmen. Zusätzlichen Wohnraum könnte ich beheizen - müsste den dafür aber erstmal schaffen. Unsere Erfahrungen in messtechnisch begleiteten Projekten zeigen, dass ein Rebound-Effekt hier kaum wirksam wird. In den Messergebnissen der Passivhaus-Siedlungen112) liegen die Verbrauchswerte immer um 15 kWh/(m²a)113) und das enthält jeden evtl. vorhandenen Mehrverbrauch durch Mehrkomfort bereits mit. Mehr Wohnfläche pro Kopf114) gibt es insbesondere in den Sozialwohnbauprojekten bei den Passivhäusern auch nicht. Die Bewohner haben deutlich geringere Ausgaben für Heizenergie und damit mehr von ihrem Einkommen verfügbar, das sie wahrscheinlich alternativ ausgeben werden; wofür, dazu können wir nur Annahmen machen - von denen die wahrscheinlichste das „Durchschnitts-Konsumverhalten“ darstellt. Das erzeugt je Euro erheblich weniger CO2-Emissionen als die eingesparte Heizung; bei dieser handelt es sich nämlich um nahezu 100% fossilen Energieverbrauch. Hinweis: Unter folgenden Link wird der Rebound-Effekt für eine andere Dienstleistung, nämlich 'Kunstlicht' diskutiert: Rebound-Effekt bei der Beleuchtung. Bei dieser Anwendung ist der Effekt tatsächlich von einer etwas größeren Bedeutung; allerdings bliebt auch da der weit überwiegende Teil des Einspareffektes erhalten.
16. Januar: Die erste Januarhälfte war viel zu warm
Derzeit sind die Außentemperaturen etwas gefallen, liegen aber immer noch über dem langjährigen Mittel. Bei derart hohen Temperaturen ist der Wärmeverlust stark reduziert. Die mittlere elektrische Leistungsaufnahme der Split-Wärmepumpe lag bei um 160 Wel, für die Beheizung der gesamten Wohnung; und dabei liegen die Raumtemperatruen jetzt tagsüber über 21 °C.
21. Januar: Die zweite Frostperiode in diesem Winter - Thema: Dauerlast der Wärmepumpen
 Jetzt ist Winter: Die Temperaturen messen derzeit (na ja, wenig) unter 0°C; aber: es liegt sogar ein bisschen Schnee(Foto). Weil aber die Solarstrahlung wegen der länger werdenden Tage schon wieder etwas höher ist als im dunklen Dezember, liegt die elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe jetzt bei nur rund 300 Wattel. weniger als die Maximallast, die bei rund 450 Wattel lag. Um es nochmal zu wiederholen: Das ist die Leistung für die ganze Wohnung, für 3 Personen mit akzeptablem Innenklima (20°C). Wenn das alle so machen, wir hatten es schon mal behandelt, wären das in ganz Deutschland etwa 12,6 GW (Gigawatt) und das wäre auch im Winter überhaupt kein Problem; das gibt der angekündigte Wind- und PV-Ausbau ohne weiteres auch noch zusätzlich zum heutigen Stromverbrauch her.
Jetzt ist Winter: Die Temperaturen messen derzeit (na ja, wenig) unter 0°C; aber: es liegt sogar ein bisschen Schnee(Foto). Weil aber die Solarstrahlung wegen der länger werdenden Tage schon wieder etwas höher ist als im dunklen Dezember, liegt die elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe jetzt bei nur rund 300 Wattel. weniger als die Maximallast, die bei rund 450 Wattel lag. Um es nochmal zu wiederholen: Das ist die Leistung für die ganze Wohnung, für 3 Personen mit akzeptablem Innenklima (20°C). Wenn das alle so machen, wir hatten es schon mal behandelt, wären das in ganz Deutschland etwa 12,6 GW (Gigawatt) und das wäre auch im Winter überhaupt kein Problem; das gibt der angekündigte Wind- und PV-Ausbau ohne weiteres auch noch zusätzlich zum heutigen Stromverbrauch her.
Nun sehen unsere bestehenden Gebäude aber ganz anders aus. Die haben im Durchschnitt in etwa den 8fachen (in Worten: acht) Wärmeverlust wie das hier dokumentierte Passivhaus. Weil es auch nicht nur Wohnungen sind, kommt insgesamt pro Kopf sogar etwa ein Faktor 10 mehr heraus - das sind dann insgesamt (zum mitrechnen):
- Der Heizwärme- und Warmwasserverbrauch in Deutschland beträgt etwa 620 TWh/a (Quelle: Energiedaten BMWi, Blatt7, Terawattstunden pro Jahr)
- aus den Volllaststunden von rund 1500h für die Durchschnitts-7-Tage-Kälteperiode, ergibt sich
- eine Heizwärmelast von 413 GW (Gigawatt)115) )lt;nowiki> </nowiki> cdot $ Vollbenutzungsstunden))
- wovon nur 80% letztlich mit Wärmepumpen gedeckt werden müssen (es bleiben andere Heizquellen, z.B. Fernwärme), das macht dann
- 330 GWtherm thermische Leistung116) .
- Zum Vergleich: Das allein ist mehr als die gesamte derzeitige Kraftwerkskapazität (fossil,nuklear &erneuerbar).
Hieran wird deutlich: Diese Last wäre sowohl für das Netz, als auch für die primären Erzeuger119) als auch für das notwendige Backup zu hoch120) . Diese Last muss runter, und das geht mit besserem Wärmeschutz auch und gerade im Bestand. Wie wir zu Anfang gesehen haben, geht das - im Passivhaus ist es nämlich nur ein Zehntel dieser Leistung. Freilich, so gut werden nicht alle Altbauten letztendlich werden - es bleiben sogar rund 10% der Bauten, bei denen z.B. wegen Denkmalschutz immer noch hohe Lasten übrigbleiben. Wenn wir im Schnitt auf eine Größenordnung von 40 GW runter wollen, dann müssen die meisten übrigen Gebäude auf etwa ein Drittel des heutigen Wärmeverlustes verbessert werden. Mit schrittweisen EnerPHit-Konzepten geht das. Das kommt aber nur dann rechtzeitig, wenn wir mit den Maßnahmen jetzt anfangen; das kann eben nicht alles innerhalb von ein paar Jahren ausgeführt werden - innerhalb von ca. 15 Jahren schon.
24. Januar: Schnee-Thermographie
 Abb. 26 Eine so schöne Gelegenheit, Thermographie zu machen OHNE Thermographie-Kamera gibt es nicht oft: Wir haben Tauwetter; der Schnee schmilzt, aber er schmilzt dort natürlich schneller, wo ihm von oben (Warmluft) und unten (Wärmeleitung) Wärme zugeführt wird. Daher stellen sich jetzt Unterschiede in der Dämmwirkung sehr schön dar. In Abb. 26 sehen wir das Gründach einer Nachbar-Reihenhauszeile. Das ist ein durchaus recht gut gebautes Objekt, es ist eine der ersten Niedrigenergiehaussiedlungen in Deutschland, gebaut Ende der achtziger Jahre. Diese Häuser sind vom Wärmeschutz her sogar etwas besser121) als es der heutigen Verordnungslage entspricht. Die Wärmebrücken, die hier erkennbar sind, werden üblicherweise auch heute noch so realisiert: Der Beton-Ringanker ist aus Brandschutzgründen bis unter die Dachhaut geführt. Natürlich „müsste“ das nicht Beton sein, für den Brandschutz würde es auch eine Lage Porenbetonsteine tun - und die Wärmebrücke ist dann praktisch weg. Teurer wird das auch nicht - das Einzige, das dafür gebraucht wird, ist das Know-how. Das scheint aber den meisten am Bau zu lästig zu sein, sich damit zu befassen.
Abb. 26 Eine so schöne Gelegenheit, Thermographie zu machen OHNE Thermographie-Kamera gibt es nicht oft: Wir haben Tauwetter; der Schnee schmilzt, aber er schmilzt dort natürlich schneller, wo ihm von oben (Warmluft) und unten (Wärmeleitung) Wärme zugeführt wird. Daher stellen sich jetzt Unterschiede in der Dämmwirkung sehr schön dar. In Abb. 26 sehen wir das Gründach einer Nachbar-Reihenhauszeile. Das ist ein durchaus recht gut gebautes Objekt, es ist eine der ersten Niedrigenergiehaussiedlungen in Deutschland, gebaut Ende der achtziger Jahre. Diese Häuser sind vom Wärmeschutz her sogar etwas besser121) als es der heutigen Verordnungslage entspricht. Die Wärmebrücken, die hier erkennbar sind, werden üblicherweise auch heute noch so realisiert: Der Beton-Ringanker ist aus Brandschutzgründen bis unter die Dachhaut geführt. Natürlich „müsste“ das nicht Beton sein, für den Brandschutz würde es auch eine Lage Porenbetonsteine tun - und die Wärmebrücke ist dann praktisch weg. Teurer wird das auch nicht - das Einzige, das dafür gebraucht wird, ist das Know-how. Das scheint aber den meisten am Bau zu lästig zu sein, sich damit zu befassen.  Abb. 27 Abb. 27: So sieht es auf dem Dach des Passivhauses Darmstadt Kranichstein (Baujahr 1990) aus. Auch das ist ein Reihenhaus, zwei Oberansichten von Trennwänden sind hier im Bild - aber halt, da sehen wir ja gar nichts. Wie kann das sein? Gut, wir wussten das schon damals bei der Planung und haben eine brandschutztechnische Trennung mit Mineralwolle erreicht. Mehrinvestition dadurch: Null (klar, weil das ein Massivbau ist, gibt es einen Ringanker trotzdem; der ist nur unwesentlich „billiger“ (weil weniger hoch). Zudem ist auch gut erkennbar, dass insgesamt weniger Schnee abgeschmolzen ist, als beim Nachbarhaus. Das liegt an der insgesamt dickeren Dämmung - der U-Wert des Daches liegt im Passivhaus bei um 0,1 W/(m²K). Hier ist der Dachaufbau beschrieben, es handelt sich um Einblas-Dämmstoff. Investitionskosten: Das sind etwa 15 cm mehr als üblich, bei um 80 €/m³ Einblaskosten summiert sich das auf 12 €/m² zusätzliche bauliche Investition. Pro Jahr und m² spart das etwa 1 € ein und 'halten' wird das - Jahrhunderte. Es hat sich schon jetzt längst zurückgezahlt, auch ohne fossile Gaspreiskrise. Noch zwei Bemerkungen:
Abb. 27 Abb. 27: So sieht es auf dem Dach des Passivhauses Darmstadt Kranichstein (Baujahr 1990) aus. Auch das ist ein Reihenhaus, zwei Oberansichten von Trennwänden sind hier im Bild - aber halt, da sehen wir ja gar nichts. Wie kann das sein? Gut, wir wussten das schon damals bei der Planung und haben eine brandschutztechnische Trennung mit Mineralwolle erreicht. Mehrinvestition dadurch: Null (klar, weil das ein Massivbau ist, gibt es einen Ringanker trotzdem; der ist nur unwesentlich „billiger“ (weil weniger hoch). Zudem ist auch gut erkennbar, dass insgesamt weniger Schnee abgeschmolzen ist, als beim Nachbarhaus. Das liegt an der insgesamt dickeren Dämmung - der U-Wert des Daches liegt im Passivhaus bei um 0,1 W/(m²K). Hier ist der Dachaufbau beschrieben, es handelt sich um Einblas-Dämmstoff. Investitionskosten: Das sind etwa 15 cm mehr als üblich, bei um 80 €/m³ Einblaskosten summiert sich das auf 12 €/m² zusätzliche bauliche Investition. Pro Jahr und m² spart das etwa 1 € ein und 'halten' wird das - Jahrhunderte. Es hat sich schon jetzt längst zurückgezahlt, auch ohne fossile Gaspreiskrise. Noch zwei Bemerkungen:
- Ja, so etwas lässt sich kostengünstig praktisch nicht nachrüsten. Mit den so geplanten und ausgeführten Wärmebrücken werden wir somit leben müssen - in alle Zukunft. Das ist einer der Gründe122) , warum im Bestand nachträglich Passivhausstandard meist nicht erreichbar ist; wir empfehlen da den EnerPHit-Standard, und der lässt sich überall erreichen, mit vertretbarem Aufwand (wird dann so um 25 bis 35 kWh/(m²a) liegen; das ist immer noch weniger als ein Viertel des derzeitigen Durchschnittswertes der deutschen Bausubstanz123) , es gibt also ein sehr großes Potential).
- Wegen der Nicht-Nachrüstbarkeit kommt es beim Neubau daher umso mehr darauf an, diese Dinge von Anfang an besser zu machen („Wenn schon, denn schon“). Am Anfang kostet das nämlich sehr wenig (ja, eine etwas aufmerksamere Planung). Dieser Typ von Detail kommt bei jedem massiven Neubau auch noch an anderen Stellen vor: Beim Mauerwerksfußpunkt z.B.. Und auch da kann die Wärmebrücke ohne besonderen Aufwand nahezu vollständig vermieden werden, wenn die Planer nur gelernt haben, wie. Das sind dann übrigens alles CO2-Reduktionskosten von unter Null €/Tonne - denn, diese Maßnahmen lohnen sich durch die Energiekosteinsparung, ihre Lebenszykluskosten sind geringer als die der durchgezogenen Betonwand. ===== 25. Januar: Minimale Wärmeverluste des Daches =====
 Abb. 28 Weil mir das heute beim Spaziergang aufgefallen ist: Da liegt doch tatsächlich immer noch Schnee auf dem Dach unseres Passivhauses124) - während der Schnee sonst überall (z.B. das Dach links im Bild) nahezu vollständig weggetaut ist. Hier zeigt sich wieder die ausgezeichnete Wärmedämmung dieses Daches - es strömt von unten nur sehr wenig Wärme nach, daher erfolgt der Auftauprozess nur von „oben“, von der jetzt wärmeren Außenluft. Führt die längere Zeit der Schneebedeckung zu einer längeren Temperatur-Absenkung auf um 0°C (Bereich des Gefrierpunktes) und so zu einem höheren Wärmeverlust? Ja, das ist tatsächlich so - über ca. einen Tag ist die Temperatur auf dem Dach auf um 0°C quasi stabilisiert, während andernorts hier wohl eher um 1°C herrschen. Wegen der kleinen Differenz (weniger als ein Grad) und der Kürze der Zeit (24 h) ist der quantitative Einfluss auf den Wärmeverlust allerdings völlig unbedeutend. Dazu kommt, dass der Effekt, dass auf den anderen Dächern ein höhere Anteil der Schmelzwärme des Schnees vom Dach her (also mit Heizenergie) aufgebracht wird, das überkompensiert. Diese Details sind alle nicht besonders bedeutend; sie zeigen aber, wie komplex die Vorgänge an solchen Außenoberflächen letztlich doch sein können - übliche Simulationsprogramme für die Gebäude-Simulation berücksichtigen Schneefall, Schneeauflage und Abtauen von Schnee in aller Regel nicht; auch nicht die durch den Schnee geringere Absorption von Himmelsstrahlung. Daraus resultieren bei gut gedämmten Bauteilen keine bedeutenden Fehler für die Jahres-Energiebilanzen; aber: Abweichungen zwischen den Temperaturverläufen an den Dachoberflächen an Tagen wie dem heutigen im Bereich von einigen Kelvin können dadurch schon auftreten. Stresstests mit besonders hoch auflösenden Algorithmen für diese Art Vorgänge wurden aber durchaus durchgeführt: Dabei stellte sich heraus, dass der Einfluss aller solchen Effekte (Auch z.B. „Regen auf die Dachhaut“) die Verluste im zeitlichen Integral alle immer noch zusätzlich ein wenig erhöhen; der Gesamteffekt liegt aber deutlich unter 1% der „wie normativ eingeführt“ berechneten Wärmeverluste125) . Zurück zu Praxis bzgl. der Wärmedämmung von Dächern: Unsere Schnee-Thermographie illustriert sehr anschaulich, wie stark die Wärmeverluste eines Daches durch eine wirklich gute Wärmedämmung reduziert werden; bei U-Werten um 0,1 W/(m²K) sind die noch verbleibenden Verluste vernachlässigbar gering. Derart gute U-Werte sind heutzutage bei jedem Neubau leicht und ohne hohe zusätzliche Baukosten erreichbar und auch bei einer Sanierung im Bestand ist das meist kein Problem, es sei denn, Regelungen bzgl. maximaler Firsthöhe stehen dem im Weg; das wäre dann aber wohl ein starker Hinweis, dass solche Regeln geändert werden sollten. 15 cm mehr Höhe für einen dadurch beachtlich reduzierten Wärmeverlust sollten in den allermeisten Fällen schwer genug wiegen: Schließlich geht es bei der CO2-Reduktion um eine für uns Menschen existentielle Aufgabe. Die Regelungsänderung könnte evtl. sogar noch viel weiter gehen: Vielerorts wären auch Aufstockungen um ein oder sogar zwei Geschosse möglich - das spart dann nicht nur Energie, sondern es würde es auch erlauben, Wohnraum zu schaffen ohne neue Flächen versiegeln zu müssen; das ist sehr oft Wohnraum in den Lagen, in denen dieser auch knapp ist. Die Stadt Zürich hat auf diesem Weg schon seit Jahrzehnten „Bauen im Bestand“ ermöglicht - mit enormen Vorteilen in vielerlei Hinsicht.
Abb. 28 Weil mir das heute beim Spaziergang aufgefallen ist: Da liegt doch tatsächlich immer noch Schnee auf dem Dach unseres Passivhauses124) - während der Schnee sonst überall (z.B. das Dach links im Bild) nahezu vollständig weggetaut ist. Hier zeigt sich wieder die ausgezeichnete Wärmedämmung dieses Daches - es strömt von unten nur sehr wenig Wärme nach, daher erfolgt der Auftauprozess nur von „oben“, von der jetzt wärmeren Außenluft. Führt die längere Zeit der Schneebedeckung zu einer längeren Temperatur-Absenkung auf um 0°C (Bereich des Gefrierpunktes) und so zu einem höheren Wärmeverlust? Ja, das ist tatsächlich so - über ca. einen Tag ist die Temperatur auf dem Dach auf um 0°C quasi stabilisiert, während andernorts hier wohl eher um 1°C herrschen. Wegen der kleinen Differenz (weniger als ein Grad) und der Kürze der Zeit (24 h) ist der quantitative Einfluss auf den Wärmeverlust allerdings völlig unbedeutend. Dazu kommt, dass der Effekt, dass auf den anderen Dächern ein höhere Anteil der Schmelzwärme des Schnees vom Dach her (also mit Heizenergie) aufgebracht wird, das überkompensiert. Diese Details sind alle nicht besonders bedeutend; sie zeigen aber, wie komplex die Vorgänge an solchen Außenoberflächen letztlich doch sein können - übliche Simulationsprogramme für die Gebäude-Simulation berücksichtigen Schneefall, Schneeauflage und Abtauen von Schnee in aller Regel nicht; auch nicht die durch den Schnee geringere Absorption von Himmelsstrahlung. Daraus resultieren bei gut gedämmten Bauteilen keine bedeutenden Fehler für die Jahres-Energiebilanzen; aber: Abweichungen zwischen den Temperaturverläufen an den Dachoberflächen an Tagen wie dem heutigen im Bereich von einigen Kelvin können dadurch schon auftreten. Stresstests mit besonders hoch auflösenden Algorithmen für diese Art Vorgänge wurden aber durchaus durchgeführt: Dabei stellte sich heraus, dass der Einfluss aller solchen Effekte (Auch z.B. „Regen auf die Dachhaut“) die Verluste im zeitlichen Integral alle immer noch zusätzlich ein wenig erhöhen; der Gesamteffekt liegt aber deutlich unter 1% der „wie normativ eingeführt“ berechneten Wärmeverluste125) . Zurück zu Praxis bzgl. der Wärmedämmung von Dächern: Unsere Schnee-Thermographie illustriert sehr anschaulich, wie stark die Wärmeverluste eines Daches durch eine wirklich gute Wärmedämmung reduziert werden; bei U-Werten um 0,1 W/(m²K) sind die noch verbleibenden Verluste vernachlässigbar gering. Derart gute U-Werte sind heutzutage bei jedem Neubau leicht und ohne hohe zusätzliche Baukosten erreichbar und auch bei einer Sanierung im Bestand ist das meist kein Problem, es sei denn, Regelungen bzgl. maximaler Firsthöhe stehen dem im Weg; das wäre dann aber wohl ein starker Hinweis, dass solche Regeln geändert werden sollten. 15 cm mehr Höhe für einen dadurch beachtlich reduzierten Wärmeverlust sollten in den allermeisten Fällen schwer genug wiegen: Schließlich geht es bei der CO2-Reduktion um eine für uns Menschen existentielle Aufgabe. Die Regelungsänderung könnte evtl. sogar noch viel weiter gehen: Vielerorts wären auch Aufstockungen um ein oder sogar zwei Geschosse möglich - das spart dann nicht nur Energie, sondern es würde es auch erlauben, Wohnraum zu schaffen ohne neue Flächen versiegeln zu müssen; das ist sehr oft Wohnraum in den Lagen, in denen dieser auch knapp ist. Die Stadt Zürich hat auf diesem Weg schon seit Jahrzehnten „Bauen im Bestand“ ermöglicht - mit enormen Vorteilen in vielerlei Hinsicht.
4. Februar 2023. Kommentar zur Lage der Gasversorgung: Glück gehabt!
Noch ist der Winter nicht vorbei - der Kernwinter vermutlich schon und (normalerweise um diese Zeit des Jahres) auch der überwiegende Teil des Heizwärmeverbrauchs. Die richtig gute Nachricht, die ist derzeit auch auf allen Kanälen: „Unsere Erdgasspeicher sind immer noch ziemlich voll“, nämlich um 78% derzeit. Das ist an der Obergrenze der optimistischsten Szenarien für die Gasversorgung. Objektiv gesehen bedeutet das tatsächlich, dass auch für den Rest dieses Winters eine Mangellage selbst dann ausgeschlossen werden kann, wenn es noch mal so richtig kalt wird und die (bisher tadellose) Versorgungslage mit fossilem Gas aus dem Ausland doch noch nennenswert einbrechen sollte. Auch objektiv richtig ist aber, dass der erwartbare jahresdurchschnittliche Netto-Import an fossilem Gas im Durchschnitt seit dem Ausbleiben der Lieferungen aus Russland bei etwa 2,2 TWh/d liegt. Das sind rund 18% weniger als im Durchschnitt der vorhergehenden Jahre. Das bedeutet: Die bis April sich weiter leerenden Speicher können im Jahr 2023 keinesfalls so rasch wieder nachgefüllt werden, wie das 2022 durch zunächst forcierten Bezug (eben noch aus Russland) geschah. Genau darauf weist die Bundesnetzagentur hin, wenn sie warnt, dass eine Mangellage für den kommenden Winter nicht ausgeschlossen werden kann. Wie bei vielen Fragen, so sind diese objektiven Fakten Gegenstand mannigfacher, meist politisch motivierter Interpretationen. Das geht von „Aha, war doch alles nur falscher Alarm, es gab nie ein Problem, 'man' wollte uns nur frieren lassen, lasst uns jetzt alles wieder voll aufdrehen.“ bis „Das dicke Ende kommt ganz schnell. Wir müssen die Gasleitungen in der Ostsee reparieren und rasch wieder in Betrieb nehmen.“ Manchmal kommen diese Extrempositionen aus der gleichen Quelle mit nur wenigen Tagen Abstand. Beide Behauptungen sind falsch, wir werden im folgenden Abschnitt aus objektiver Perspektive darstellen, wie die Lage tatsächlich aussieht. Die verfälschten Extrempositionen werden über einige Medien mit viel 'Gedöns' verbreitet - das wohl in der Absicht, gesellschaftliche Spannungen zu verstärken. Denn, die intendierten Folgen, im ersten Fall „Übermut“, im zweiten Fall „Angst“ sind jeweils geeignet, den Zusammenhalt zu schwächen. Genau diesen Zusammenhalt braucht die Gesellschaft aber jetzt am notwendigsten - denn, wir können diese Krise meistern, wenn wir uns vernünftig verhalten. Wir können das aber auch ganz leicht immer noch völlig vermasseln, wenn Übermut oder Angst in großen Teilen der Bevölkerung überhand nehmen - oder wir gar über solche Fragen auch noch endlose und nutzlose Streiterei vom Zaun brechen. Das genau würde uns vom notwendigen vernünftigen Handeln abhalten - das nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Bereichen jetzt wirklich wichtig ist: Denn, wir haben vor allem ein Klimaproblem - die jeweils aktuellen 'Not'lagen lassen das zu gern in den Hintergrund treten.
Analyse Teil I: Der Spar-Erfolg in DE
Wir vergleichen für den ersten Schritt die von der Bundesnetzagentur veröffentlichten wöchentlichen Gesamt-Verbrauchsdaten von Ende Juli126) bis zum heutigen Stand Anfang Februar 2023: Der Tagesmittelwert für die Jahre 2018 bis 2021 beträgt in diesem Zeitraum 2,69 und für den aktuellen Zeitraum 2,13 TWh/d. Somit beträgt die Reduktion 0,56 TWh/d oder rund 21% des vorherigen Verbrauchs. Das sieht jetzt nach einem nahezu perfekten „Match“ zwischen dem reduzierten Verbrauch (minus 21%) und der geringeren Lieferung (minus 18%) aus.
Objektives Fakt ist damit: Wenn wir die jetzt erreichten Reduktionen in der tatsächlich erreichten Höhe genau so auch in den Folgejahren durchhalten können, dann würde es tatsächlich zu keinen ernsthaften Problemen kommen können. Damit können wir schon an dieser Stelle die Extremposition „Angst vor dem nahen Niedergang des Abendlandes“ widerlegen. Zugleich aber auch die Extremposition: „Es gibt und gab nie das geringste Problem, lasst uns jetzt endlich zum 'Normalbetrieb' zurückkehren und fleißig alle Verbrauchshähne wieder voll öffnen“ ist damit widerlegt: Denn, das müsste nach diesem Winter eigentlich allen unmittelbar anschaulich vor Augen stehen: Weiterhin dauerhaft die etwa 20%ige Reduktion im Gasverbrauch aufrecht zu erhalten, dazu braucht es eben doch einiger fortgesetzter Anstrengung. Etwas Wasser in den Wein: Sogar bedeutend mehr Anstrengungen als bisher, und das geht aus der weiteren Analyse im folgenden Abschnitt hervor.
Analyse Teil II: Worauf beruht der Sparerfolg in DE?
Das lässt sich tatsächlich bereits auf der Basis der jetzt vorliegenden Daten abschätzen:
- Zum Ersten hat tatsächlich der Gasverbrauch von Industrie und Kraftwerken um ca. 0,24 TWh/d gegenüber den Vorjahren abgenommen. Dieser Teil der Reduktion ist vor allem durch Umstellungen bei den Brennstoffen erreicht worden; diese Umstellungen können nach meiner Einschätzung durchaus längerfristig gehalten werden. Allerdings: Diese Umstellungen addieren zum Konto der CO2-Emissionen. Wirklich dauerhaft nachhaltig sind diese Notfallmaßnahmen daher nicht, auch wenn sie stark dazu beitragen, einen aktuellen Notfall vermeiden zu helfen.
- Zum Zweiten war der Herbst und Winter 2022/23 in ganz außerordentlichem Umfang wärmer als zuvor. Dadurch konnte der Beginn der Heizzeit schon einmal lang hinausgeschoben werden und der Heizwärmebedarf auch im Dezember und Januar war dadurch deutlich gegenüber dem früheren Durschnitt reduziert. Wir werden diesen Beitrag nach dem Ende der Heizzeit noch genauer quantitativ bemessen, eine grobe Abschätzung zeigt, dass das allein (bei sonst gleichbleibendem Verhalten) den Heizwärmebedarf um rund 22% reduziert hat, das ist dann ein Beitrag von rund 0,24 TWh/d zur im letzten Abschnitt ausgewiesenen gesamten Reduktion. Das genau ist der Beitrag des milden Wetters am Erfolg - der Beitrag des „haben wir aber ein Glück gehabt“, daher die Überschrift dieser Ausführungen im Blog vom heutigen Tag. Inwieweit dieses Glück wiederholbar ist, werden wir später diskutieren.
- Zum Dritten haben ganz offensichtlich sehr viele Verbraucher sich doch stark angestrengt, ihren Verbrauch bei der Heizung durch sparsamen Betrieb und Temperaturabsenkungen zu senken. Es gab geradezu einen Wettbewerb, wie lange die Inbetriebnahme der Heizung hinausgezögert werden kann; und ich habe Freunde, die wirklich nur die wichtigsten Räume und die auch nur auf Temperaturen unter 20° beheizt haben. Diese Anstrengungen waren aber unterschiedlich hoch - es gab auch völlig unsolidarisches Verhalten nach dem Motto „jetzt gerade, Notlage herbeiführen, geil, dann geht da mal was ab“. Die bisherigen groben Abschätzungen deuten auf eine mittlere Absenkung der Raumtemperaturen im Durchschnitt der beheizten Gebäude von etwas weniger als rund 1°C hin. Die so erreichte Einsparung liegt dann bei 5 bis 6% des Heizwärmebedarfs oder einem 0,08 TWh/d-Beitrag zur zuvor bestimmten Gesamtreduktion. Dieser Beitrag, die Einsparung durch sparsames Nutzerverhalten, wurde zumindest in dem mir zugänglichen Umfeld überall als die „ausnahmsweise in so einem Notfall gerade noch zumutbare“ Einschränkung erlebt. Objektiv, von der Seite der Fanger'schen Komfortgleichung her, wären deutlich höhere Einsparungen durchaus erreichbar 127) . Im Durchschnitt über alle Gebäude ist aber mit dem wahrgenommenen Notfall des heurigen Winters ein guter Bezugspunkt dafür gegeben, wie weit solche Einsparungen in unserer Gesellschaft kurzfristig mobilisierbar sind. Ob solche Einsparungen über Zeiträume von mehreren Jahren durchhaltbar sind, ist fraglich; bei früheren Energiepreiskrisen war das immer nicht der Fall: Die Verbrauchsgewohnheiten haben sich nach dem wahrgenommenen 'Ende der Krise' normalisiert, die mittleren Raumtemperaturen haben zwischen 1990 und 2021 sogar zugenommen128) .
- Zum Vierten gibt es eine gewisse 'Flucht aus dem Gas' auch bei der Heizung. Holz- und sogar Kohleöfen wurden teilweise129) in Betrieb genommen, und einige Verbraucher haben es doch auch 2022 noch geschafft, auf Wärmepumpen umzusteigen. Der Beitrag zur gesamten Reduktion des Gasverbrauchs für die Heizung schätzen wir hier zu 16 GWh/d ein130) . Dieser Beitrag kann zumindest als teilweise stabil (Wärmepumpen) angesehen werden und er kann, durch Verstärkung des Trends zum Umsteigen „weg vom Gas“ und „hin zur Wärmepumpe“ in diesem und den folgenden Jahren verstärkt werden.
- Zum Fünften wurden Wärmeschutzmaßnahmen an den Gebäudehüllen vorgenommen, die üblichen „Vollsanierungen“131) , aber auch die übliche mitgenommene Verbesserung von Bauteilen132) und ein paar Maßnahmen, die auf spontan ergriffene Initiativen zurückzuführen sind 133) . Richtig ins Volle gegangen sind diese Maßnahmen allerdings 2022 (noch?) nicht, denn gerade diese Ansätze wurden kaum und wenn, dann unzureichend konkret, kommuniziert. Der im letzten Jahr erreichte Einspareffekt durch verbesserte Effizienz der Gebäude wird von uns ebenfalls bei rund 16 GWh/d eingeschätzt. Auch dieser Beitrag ist (automatisch) stabil, denn ein einmal ausgetauschtes oder verbessertes Fenster bleibt dauerhaft bei der höheren Qualität, das gleiche gilt für jede gedämmte Geschossdecke. Bei diesen Maßnahmen ist eine ganz erhebliche Steigerung bei der Umsetzung möglich, nämlich bereits dann, wenn deren Praktikabilität nur fachgerecht kommuniziert wird. Hier liegt erwiesenermaßen das höchste Potential, das allerdings bisher weiterhin weitgehend brach liegt.
Analyse Teil III: Was lässt sich fortschreiben?
Arbeiten wir die Punkte aus dem letzten Abschnitt ab:
- Der Gasverbrauch von Industrie und Kraftwerken kann auf dem geringeren Niveau gehalten werden, es sind sogar weitergehenden Reduktionen möglich - wenn z.B. vermehrt auf andere Energieträger umgestiegen wird. Bei der Stromerzeugung müssen das natürlich erneuerbare Energieträger sein, hier spielt vor allem der zügige Ausbau von Windenergie eine entscheidende Rolle. Dieser Teil scheint auch in Politik und Gesellschaft (weitgehend) verstanden zu sein, auch wenn es immer noch Versuche der Blockade aus politischen und wirtschaftspolitischen Gründen gibt. Nicht wirklich verstanden ist bisher das volle Ausmaß der hier erforderlichen Anstrengungen: Die jetzt 2022 zugebauten gerade mal rund 2,4 GW können rund 4 TWh Strom jährlich zusätzlich produzieren, das sind durchschnittlich rund 12 GWh am Tag. Bei diesem Tempo würde es viele Jahrzehnte benötigen, bis so der notwendige Beitrag zur Reduktion auch beim fossilen Gas erreicht werden kann. Leider sind selbst die bisherigen Ausbauziele der neuen Bundesregierung (hochfahren auf etwa den dreifachen Zuwachs ab 2025) immer noch unzureichend. Hier ist unbedingt ein erheblich höheres Engagement unverzichtbar!
- Der „Klimaeinfluss“: Es ist richtig, das Klima in Mitteleuropa verschiebt sich in Richtung „wärmere Winter“, im Durchschnitt in etwa 1,5°C höhere Temperaturen als noch vor 15 Jahren sind zu erwarten - das ist allerdings selbst für den Durchschnitt bei weitem nicht so mild, wie es jetzt 2022/23 war. Der Klimawandel räumt auch nicht mit den Schwankungen der Wetterbedingungen zwischen unterschiedlichen Jahren auf. Ganz im Gegenteil: der Klimawandel verstärkt, über verschiedene Mechanismen, die Extreme. Es sind sogar bisher nicht dagewesene sehr kalte Episoden möglich, wie die Extrembedingungen im Norden der USA und in Kanada im Januar 2023 (Temperaturen in Ontario bei -30°C) zeigen. Auf „wärmeres Wetter“ im Winter ist somit auch künftig keinesfalls Verlass. Es kann sogar in einzelnen Wintern spürbar kälter werden.
- Das Benutzerverhalten ist nach den vielen Messungen, die unser Institut in zahlreichen Wohngebieten im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt hat, sehr starken Schwankungen unterworfen. Verschieden Familien verhalten sich ganz unterschiedlich und es gibt Veränderungen über die Jahre; letztere waren in der Vergangenheit immer in Richtung höhere Raumtemperaturen gerichtet, zum einen, weil wir älter und Komfort-anspruchsvoller wurden, zum andren, weil leichtere Bekleidung auch im Winter zur Norm wurde. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass eine Motivation für ein dauerhaft sparsameres Heizverhalten nicht einfach ist, die Menschen im Gegenteil oft sehr ungehalten reagieren, wenn sie in diese Richtung angesprochen werden. Vor diesem Hintergrund schätze ich das Potential in diesem Bereich als gegenüber dem Erfolg von 2022/23 kaum steigerbar ein, eher müssen wir davon ausgehen, dass mit abnehmendem Krisenbewusstsein die Temperaturen im Durchschnitt wieder anziehen werden.
- Das Umsteigen auf Wärmepumpen könnte künftig durch entsprechende Programme deutlich erleichtert und forciert werden. Dazu bedarf es sowohl direkter Anreize, als auch der Schaffung von mehr Kompetenz bei den Heizungsbaubetrieben und der Mobilisierung zusätzlicher Installationsoptionen (z.B. die Raumklima-Splitgeräte). Das Umsteigen auf Wärmepumpen ist auch aus energiewirtschaftlicher und klimapolitischer Sicht notwendig. Die dabei bisher anvisierten Umrüstquoten (um und unter 1%/a) sind unzureichend. Bei Licht betrachtet müsste eigentlich bereits in wenigen Jahren nahezu jede Heizungserneuerung nur noch mit einer Wärmepumpe erfolgen134) . Dabei muss allerdings auch bedacht werden, dass der Wärmepumpen-Ausbau zu einer bedeutenden Steigerung der Stromlasten im Kernwinter führt. das unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit für einen noch stärker gesteigerten Windkraftausbau. Es unterstreicht zudem, dass parallel auch die Heizlasten der Gebäude konsequent gesenkt werden müssen, immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet - weil sonst die Zusatzleistungen für das Netz, für den Windradausbau und für den ebenfalls unverzichtbaren Backup (mit jeweils um 80 GW Dezembermittelwert zusätzlich) zu hoch sein werden.
- Die Verbesserung der Gebäudehüllen im Gebäudebestand stand seit 2008 so gut wie nicht mehr auf der Agenda. Wir haben in "Brach liegende Potentiale" systematisch dargestellt, wie durch diese Maßnahmen rund 5,2 kWh/(m²a) jährlich reduziert werden können135) . Das entspricht rund 20 TWh zusätzliche Heizenergieeinsparung jedes Jahr - und liegt tatsächlich in der gleichen Größenordnung wie das Potential zu einem maximale Ausbau der Windkraft. Diese beiden Ansätze stehen übrigens keinesfalls in Konkurrenz zueinander, im Gegenteil, sie unterstützen sich gegenseitig. Nur mit beidem zusammen kann die nahezu vollständige Elektrifizierung des Raumwärmebereichs gelingen, so, dass die Wärmepumpen-Umrüstung bezahlbar bleibt, die durchschnittlichen Lasten in den Netzen im Dezember und Januar beherrschbar und der Zubau an zusätzlichem Backup von Stromerzeugern für die etwa 10 Tage anhaltenden Flauten vertretbar136) . Dieses Potential muss jetzt dringend verstärkt mobilisiert werden.
Fazit
Die Mangellage im heurigen Winter wurde bisher vermeiden und wird auch in den Monaten Februar bis April nicht mehr eintreten. Die Analysen zeigen aber, dass wir dabei ein ganz gehöriges Maß Glück hatten, vor allem durch das sehr milde Winterwetter, für das es in den Folgejahren keine Garantie gibt. Ein Teil des „Erfolgs“ war das kurzfristige137) Umsteigen auf andere, allerdings weit weniger klimafreundliche Energieträger. Das kann auf Dauer keine Lösung sein, daher bedarf es eines erheblich forcierten Ausbaus der Windkraft, einer beherzten Umstellung auf Wärmepumpen138) und einer engagierten Mobilisierung der Energieeffizienzpotentiale bei den Gebäudehüllen, eine Aufgabe, die seit etwa 12 Jahren sträflich vernachlässigt wurde. Später hinzugefügter Hinweis: nach dem Vorliegen der gesamten Zeitreihen und einer sorgfältigen Analyse musste ich Teile der oben gegebenen Einschätzungen korrigieren, die neue Analyse findet sich unter Neubewertung der Strenge des Winters. Die oben im „Fazit“ gegebenen Schlussfolgerungen ändern sich durch diese Neubewertung allerdings nicht: Was sich etwas ändert, ist die Einschätzung der verschiedenen Beiträge zur Reduktion des Gasverbrauchs im Winter 2022/23: Da war dann wohl doch ein weit größerer Anteil an verhaltensbedingten Einsparungen im Spiel, ein bedeutendes Lob für die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland.
19. März: Heizbetrieb des Splitgerätes abgeschaltet
Die lange Pause im Blog hatte gleich zwei Gründe: Zum einen ist nicht viel am Betrieb des Systems passiert, außer dass die Stromverbräuche zuletzt von Tag zu Tag immer mehr abnahmen; das Temperaturniveau im Haus ist aber zeitgleich sogar angestiegen. Zum anderen musste ein Forschungsbericht fertiggestellt werden, dazu in einem späteren Eintrag mehr.
Der Anlass dieses Eintrages: Heute wurde beschlossen, dass es nun 'genug sein muss' mit dem Heizbetrieb im Haus. Bei schon wieder über 23 °C im Arbeitszimmer auf Grund eines relativ sonnigen Tages in Darmstadt und weiter in der Wettervorschau angekündigten milden Tagen müsste der Ladezustand der Gebäude-Wärmekapazität jetzt in der Lage sein, auch vielleicht noch kommende Kälteeinbrüche ohne große Komfortbeeinträchtigung im Haus zu überbrücken - und 'notfalls' kann das Splitgerät ja auch wieder eingeschaltet werden, sollte das wirklich erforderlich sein.
Zum Verbrauch in dieser Heizzeit und zu weiteren Details wird später berichtet: Eines ist aber schon klar, weniger als im Durchschnitt vergangener Winter war es schon, wenn auch nicht soviel weniger, wie wir uns eigentlich zugetraut hätten: Insbesondere in der zweiten Winterhälfte war das Wetter bisher wahrgenommen 'unfreundlicher' und kühler als gewohnt und die Bewohner fallen auch bereits wieder in den üblichen Trott von gewohnt sehr hohen Komfortansprüchen zurück.
24. März: Wieviel Strom war es denn 2022/23?
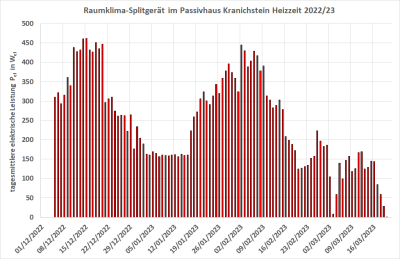 Das Diagramm zeigt den Verlauf der tagesmittleren elektrischen Leistungsaufnahme des Raumklima-Gerätes für den Winter 2022/23:
Das Diagramm zeigt den Verlauf der tagesmittleren elektrischen Leistungsaufnahme des Raumklima-Gerätes für den Winter 2022/23:
Zwischen 5.12.2022 und 19.3.2023 war das Gerät in Betrieb. Davon war nur an einem Tag die Wärmeabgabe praktisch null (3.3.2023). Die Spitzenleistung lag bei 461 Wattel, der Mittelwert bei 252 Wattel. Die Summe des Heizstromverbrauchs zum Betrieb des Gerätes war 635 kWhel /a oder
4,07 kWhel /(m²a).
Das ist der gesamte Energieverbrauch für die Heizung in diesem Haus. Zum Vergleich: Im Durchschnitt werden in deutschen Wohngebäuden 128 kWh/(m²a) verbraucht. Das ist das 32fache. Dieses Haus139) , beheizt mit der Split-Wärmepumpe, spart also fast 97% der Energie im Vergleich zum üblichen ein. Dieser 3% Rest ist problemlos durch Windkraft verfügbar; würden es „alle so machen“140) , hätten wir schon heute genug Windenergie für alle dafür. Im Durchschnitt der früheren Betriebsjahre lag der gemessene Stromverbrauch des Splitgerätes für die Heizung bei 833 kWhel. Gegenüber diesem Durchschnitt wurden somit rund 24% Stromeinsparung erreicht. Eine genaue Analyse zu den klimatischen Randbedingungen steht noch aus; da der Februar eher durchschnittlich und der März sogar bisher etwas kälter als üblich war, sind trotz des warmen Januars die Heizgradsummen nicht bedeutend verschieden vom Durchschnitt der Vorjahre. Die erzielte Einsparung ist damit tatsächlich überwiegend dem bewusst sparsameren Nutzerverhalten mit abgesenkten Temperaturen zu verdanken. Das werden wir später noch genauer analysieren. Rechnen wir mit dem mittleren CO2-Emissionsfaktor141) für Strom von 434 g/kWh, so hat der bezogene Netzstrom in der Summe rund 276 kg CO2äqui Emissionen zur Folge gehabt. Für 3 Personen sind das rund 92 kg/(Person$\cdot$a), das wären allein ca. 9% des Ausstoßes, der angesichts der Klimakrise heute akzeptabel wäre. Würde das Haus weiter mit Erdgas über das Brennwertgerät geheizt, läge die Gesamtemission bei rund 355 kg oder 118 kg/(Person$\cdot$a). Der Unterschied durch den Übergang zur Mini-Wärmepumpenheizung lag somit im vergangenen Winter bei rund 22% oder 80 kg/a und ist gegenüber der Einsparung, die der bessere Wärmeschutz des Gebäudes bewirkt142) , derzeit noch nicht beeindruckend. Mit zunehmender erneuerbarer Stromerzeugung vor allem durch Windkraft und Reduktion vor allem der Stromerzeugung durch Kohle wird sicher der Emissionsfaktor für den Strom jedoch künftig stark reduziert143) . Auf lange Sicht wird sich der Betriebsstrom so für die Splitgeräte nahezu vollständig auf erneuerbare Energiequellen umstellen lassen - wenn der Strombedarf so gering ist, wie im hier beschriebenen Beispiel, dann würde das sogar schon in wenigen Jahren gelingen.
26. März: Projektabschluss "Messung und Simulation - ein konkreter Vergleich"
Es war eine wirkliche Herausforderung: Können Ergebnisse für das Temperaturverhalten eines bewohnten Gebäudes mit einer thermischen Simulation verglichen werden? Die meisten Bauphysik-Nerds werden spontan sagen: Viel zu chaotisch - und nicht nur komplex. Tatsächlich ist das wirklich anstrengend:
- Natürlich vor allem, weil Bewohner eben „machen was sie wollen“ bzw. „was denen gerade einfällt“; und wenn das eine offen stehen gelassene Haustür ist, nachdem der Briefträger geklingelt hatte und wir dem noch hinterherlaufen mussten. Tatsächlich ist uns sowas selbstverständlich in vergangenen Jahren vorgekommen. Nicht jedoch in den zwei Heizperioden, in denen dieses Messprojekt durchgeführt wurde. Und das war wohl das Anstrengendste daran…
- …abgesehen von der Notwendigkeit, den Aufenthaltsraum im Haus zu protokollieren. Was wir in der ersten der Heizprioden noch ziemlich ernst genommen haben, dann aber doch an Motivation verloren haben. Die Genauigkeit solcher Aufenthaltsprotokolle hat von daher Grenzen.
- Aber auch die konventionell messbaren Größen kennen so ihre Tücken: Welcher Anteil der beim Duschen gezapften Warmwasserenthalpie (die wir mittels Temperatur- und Volumenstrommessung durchaus relativ genau erfassen konnten) ist wirksam für die Erwärmung im Badezimmer? Wo wird die Wärme des Kochendwassergerätes im Haus eigentlich freigesetzt (die Tasse mit dem Tee nehme ich mir regelmäßig mit an den PC-Arbeitsplatz)?
Trotz hoher Komplexität konnten wir einen Datensatz für die internen Wärmequellen mit einer Messabweichung von rund 32 W (rund 0,2 W/m²)144) für zwei Betriebsjahre zusammenstellen. Die Wetterstation auf dem Dach war erneut kalibriert worden - und alle relevanten Raumtemperaturen (sogar die in Nachbarräumen) wurden ebenfalls im Bereich von ±0.3 K genau gemessen. Das ist dann schon einmal der Teil 1 der erforderlichen Daten für einen solchen Realitätscheck.
Teil 2 ist nicht weniger herausfordernd: Die geometrischen Daten145) ) und die thermischen Eigenschaften der Bauteile müssen zuverlässig bekannt sein. Hier kam uns das Projekt „25 Jahre Passivhaus Darmstadt Kranichstein“ zur Hilfe: Dort waren z.B. Wärmeleitfähigkeiten der relevanten Bauteilschichten im Labor nachgemessen worden [Feist, Pfluger 2016]. Noch wichtiger als diese stellte sich die Berücksichtigung von Wärmebrücken-Auswirkungen heraus; auch diese können bei der einfachen Geometrie diese Objektes, der präzisen Detailplanung und der Überwachung und Dokumentation während des Bauprozesses genauer als üblich quantifiziert werden. Auch im Simulationsmodell werden die dadurch resultierenden Wärmeströme durch ein Modellbauteil (sog. Wärmebrücken-Ersatzdarstellung) abgebildet.
Unter diesen Voraussetzungen sind sowohl die Modelldaten als auch die Randbedingungen für die Temperaturentwicklung gut genug bekannt, um diese Entwicklung zwischen dem physikalischen Modell (Simulation) und der Messung am Objekt vergleichen zu können. Bevor wir dies im Einzelnen genauer beleuchten, hier zwei erste Eindrücke:
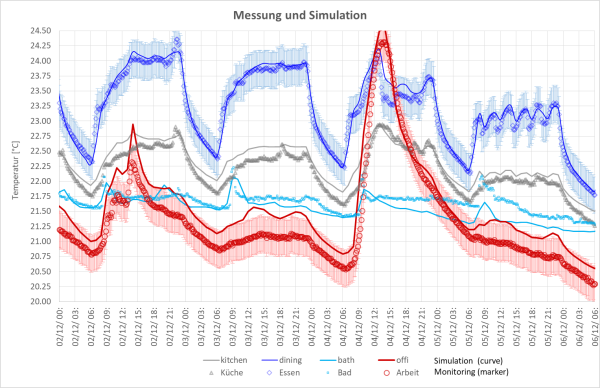 Der Verlauf für die Raumlufttemperatur in Zone 4 (Esszimmer, Aufstellort der einzigen Raumwärmequelle, Gebläsekonvektor an der Westwand) zeigt typische Anheizvorgänge jeweils startend um 6:00 und steil abfallend ab 23:00. Dies ist die Betriebszeit der Split-Luft/Luft-Wärmepumpe. Im beheizten Raum steigen die Luft-Temperaturen bis zum Einsetzen der Regelung auf ca. 24°C an; am sonnenreichen Tag (4.12.) kann das Gerät durch passiv solare Gewinne bereits gegen Mittag zurückregeln. Am 5.12. schwingt das Splitgerät um den Betriebspunkt der niedrigsten Stufe. Dadurch sind Schwankungen der Temperatur im Zehntel-Grad-Bereich bedingt. Insgesamt ist die Übereinstimmung zwischen der Simulation (Linie) und der Messung (Rhombus) in diesem Zeitabschnitt ausgezeichnet. Das gilt sowohl für das Niveau (0. Ordnung) als auch für den Tagesgang (1. Ordnung), die zugehörigen Abklingvorgänge nach der Nachtabschaltung und die kurzzeitigen Schwankungen durch Takten des Gerätes. Es gibt andere Zeiträume, in denen die Übereinstimmung nicht so perfekt ist. Die roten Kurven für das Arbeitszimmer liegen in diesem Intervall dauerhaft um etwa 0.3 K verschoben (Simulation über der Messung), die Simulationskurve folgt den Messungen jedoch qualitativ sehr schön. In diesem Südraum im 2. Obergeschoss direkt unter dem Dach mit großen Fenstern ist der Einfluss passiv solarer Gewinne besonders hoch. Das ist sowohl am 2.12. mit einer kurzen Solarspitze gegen 15:00 als auch am klaren Tag (4.12.) in Messung und Simulation gleichermaßen erkennbar. Am klaren Tag steigt die Temperatur im Arbeitszimmer von 20.6°C am Ende der Nachtabschaltung auf 24.3 °C zwischen 12:20 und 14:30 an. Die Jalousien im Homeoffice wurden bewusst nicht geschlossen, um diese Vorgänge genauer studieren zu können; in diesem Raum wurde im Zeitraum der Solarspitze am Computer gearbeitet – eine direkte Blendung wurde durch einen internen Blendschutz vermieden. Die erreichten Temperaturen werden von den Nutzern gerade im Winter als angenehme Abwechslung empfunden. Auch an trüben Tagen reicht der interne Luftaustausch aus, um das Arbeitszimmer vor der Nachtabschaltung im Komfortbereich zu halten. Die Simulationslinie zeigt eine geringfügig stärker ausgeprägte Dynamik; dies kann an Ansätzen für die Personenwärme, aber auch an der genauen Platzierung und der thermischen Trägheit der Messfühler liegen. Der Temperaturgang in der Küche folgt dem des Esszimmers – bedingt durch intensiven Luftaustausch zwischen diesen Räumen. Die Simulation liegt hier meist etwa um ein Zehntel Kelvin über den Messwerten, die Amplituden der dynamischen Vorgänge werden gut getroffen. Für das Bad (blaugrün) sind die Abweichungen am auffälligsten. Trocknungsvorgänge und Duschspitzen sind in ihren Leistungen sowohl bei den Messungen als auch in der Simulation erkennbar. Sie erscheinen in der Messung ausgeprägter. Auch hier liegt die Übereinstimmung aber weiterhin innerhalb der Fehlermargen, sie spiegeln aber zwei Unsicherheiten wieder: Die Enthalpie-Freisetzung im Raum durch einen Duschvorgang hängt von Randbedingungen wie z.B. der Einstellung des Duschkopfes und dessen Einsatz ab; diese Details wurden zum Ersten nicht protokolliert; zum Zweiten würde uns ein Protokoll aber auch nicht viel nützen, solange nicht zuverlässig bestimmte Verdunstungsraten für die jeweilige Betriebsweise vorliegen. Angesichts des nicht überwältigend hohen Einflusses solcher Daten auf das Simulationsergebnis für das Gesamtgebäude z.B. in einem Wochenzyklus wurde aber eine Ausliterung solcher Bilanzen hier nicht spezifisch durchgeführt. Das könnte z.B. für Duschen in Hallenbäder o.ä. interessant sein, so dass sich hier evtl. Gelegenheiten ergeben, solche Vorgänge noch genauer zu studieren.
Der Verlauf für die Raumlufttemperatur in Zone 4 (Esszimmer, Aufstellort der einzigen Raumwärmequelle, Gebläsekonvektor an der Westwand) zeigt typische Anheizvorgänge jeweils startend um 6:00 und steil abfallend ab 23:00. Dies ist die Betriebszeit der Split-Luft/Luft-Wärmepumpe. Im beheizten Raum steigen die Luft-Temperaturen bis zum Einsetzen der Regelung auf ca. 24°C an; am sonnenreichen Tag (4.12.) kann das Gerät durch passiv solare Gewinne bereits gegen Mittag zurückregeln. Am 5.12. schwingt das Splitgerät um den Betriebspunkt der niedrigsten Stufe. Dadurch sind Schwankungen der Temperatur im Zehntel-Grad-Bereich bedingt. Insgesamt ist die Übereinstimmung zwischen der Simulation (Linie) und der Messung (Rhombus) in diesem Zeitabschnitt ausgezeichnet. Das gilt sowohl für das Niveau (0. Ordnung) als auch für den Tagesgang (1. Ordnung), die zugehörigen Abklingvorgänge nach der Nachtabschaltung und die kurzzeitigen Schwankungen durch Takten des Gerätes. Es gibt andere Zeiträume, in denen die Übereinstimmung nicht so perfekt ist. Die roten Kurven für das Arbeitszimmer liegen in diesem Intervall dauerhaft um etwa 0.3 K verschoben (Simulation über der Messung), die Simulationskurve folgt den Messungen jedoch qualitativ sehr schön. In diesem Südraum im 2. Obergeschoss direkt unter dem Dach mit großen Fenstern ist der Einfluss passiv solarer Gewinne besonders hoch. Das ist sowohl am 2.12. mit einer kurzen Solarspitze gegen 15:00 als auch am klaren Tag (4.12.) in Messung und Simulation gleichermaßen erkennbar. Am klaren Tag steigt die Temperatur im Arbeitszimmer von 20.6°C am Ende der Nachtabschaltung auf 24.3 °C zwischen 12:20 und 14:30 an. Die Jalousien im Homeoffice wurden bewusst nicht geschlossen, um diese Vorgänge genauer studieren zu können; in diesem Raum wurde im Zeitraum der Solarspitze am Computer gearbeitet – eine direkte Blendung wurde durch einen internen Blendschutz vermieden. Die erreichten Temperaturen werden von den Nutzern gerade im Winter als angenehme Abwechslung empfunden. Auch an trüben Tagen reicht der interne Luftaustausch aus, um das Arbeitszimmer vor der Nachtabschaltung im Komfortbereich zu halten. Die Simulationslinie zeigt eine geringfügig stärker ausgeprägte Dynamik; dies kann an Ansätzen für die Personenwärme, aber auch an der genauen Platzierung und der thermischen Trägheit der Messfühler liegen. Der Temperaturgang in der Küche folgt dem des Esszimmers – bedingt durch intensiven Luftaustausch zwischen diesen Räumen. Die Simulation liegt hier meist etwa um ein Zehntel Kelvin über den Messwerten, die Amplituden der dynamischen Vorgänge werden gut getroffen. Für das Bad (blaugrün) sind die Abweichungen am auffälligsten. Trocknungsvorgänge und Duschspitzen sind in ihren Leistungen sowohl bei den Messungen als auch in der Simulation erkennbar. Sie erscheinen in der Messung ausgeprägter. Auch hier liegt die Übereinstimmung aber weiterhin innerhalb der Fehlermargen, sie spiegeln aber zwei Unsicherheiten wieder: Die Enthalpie-Freisetzung im Raum durch einen Duschvorgang hängt von Randbedingungen wie z.B. der Einstellung des Duschkopfes und dessen Einsatz ab; diese Details wurden zum Ersten nicht protokolliert; zum Zweiten würde uns ein Protokoll aber auch nicht viel nützen, solange nicht zuverlässig bestimmte Verdunstungsraten für die jeweilige Betriebsweise vorliegen. Angesichts des nicht überwältigend hohen Einflusses solcher Daten auf das Simulationsergebnis für das Gesamtgebäude z.B. in einem Wochenzyklus wurde aber eine Ausliterung solcher Bilanzen hier nicht spezifisch durchgeführt. Das könnte z.B. für Duschen in Hallenbäder o.ä. interessant sein, so dass sich hier evtl. Gelegenheiten ergeben, solche Vorgänge noch genauer zu studieren.
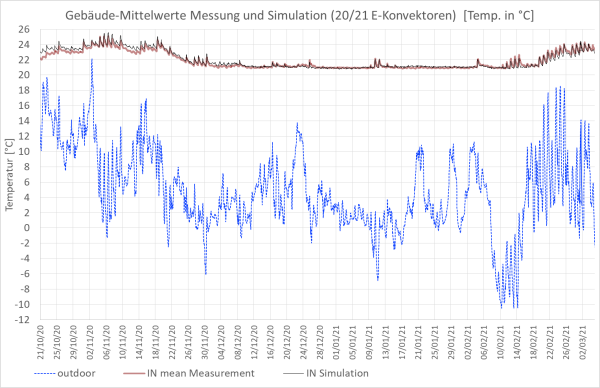 Mittelwerte (mean) von Messung und Simulation (alle Raumtemperaturen in der Wohnung gemittelt) über den Gesamtzeitraum der zweiten Heizzeit (Heizung durch Raumthermostat-geregelte Elektrokonvektoren) zusammen mit den Außentemperaturen. Hier wird die gute Zeitkonstanz der verwendeten Regelung sichtbar: Die mittlere Gebäudetemperatur sinkt über den gesamten Betrachtungszeitraum nie unter 20,83 °C; so, wie das von einem halbseitigen Regler mit etwa 0.2 K Messgenauigkeit erwartet werden kann146) . Die Maximalwerte liegen z.B. im Dezember und Januar bei rund 22,2 °C - Abweichungen nach oben erlaubt der halbseitige Regler; nach Komfortkriterien sind diese unproblematisch, solange etwa 25 °C nicht überschritten werden. Das kommt aber nicht einmal im März vor147) . Es ist sehr schön erkennbar, wie das Gebäude von Mittelwerten um 23 °C148) im November auf rund 21 °C über die gesamte Heizperiode149) durch Heizen abgefangen wird, um Mitte März die 23 °C wieder zu erreichen. Das liegt genau im erwarteten Bereich für die heute übliche Kleidung, wenn die gültige internationale Komfort-Norm angewendet wird (ISO 7730).Deutlich erkennbare Abweichungen, ganz am Anfang und um den 12.11., beruhen überwiegend auf Auswirkungen bewusst geöffneter Fenster - die zwar protokolliert, aber in der Simulation bisher nicht abgebildet wurden150) . Der gesamte Bericht findet sich in der Literaturquelle [Feist 2023].
Mittelwerte (mean) von Messung und Simulation (alle Raumtemperaturen in der Wohnung gemittelt) über den Gesamtzeitraum der zweiten Heizzeit (Heizung durch Raumthermostat-geregelte Elektrokonvektoren) zusammen mit den Außentemperaturen. Hier wird die gute Zeitkonstanz der verwendeten Regelung sichtbar: Die mittlere Gebäudetemperatur sinkt über den gesamten Betrachtungszeitraum nie unter 20,83 °C; so, wie das von einem halbseitigen Regler mit etwa 0.2 K Messgenauigkeit erwartet werden kann146) . Die Maximalwerte liegen z.B. im Dezember und Januar bei rund 22,2 °C - Abweichungen nach oben erlaubt der halbseitige Regler; nach Komfortkriterien sind diese unproblematisch, solange etwa 25 °C nicht überschritten werden. Das kommt aber nicht einmal im März vor147) . Es ist sehr schön erkennbar, wie das Gebäude von Mittelwerten um 23 °C148) im November auf rund 21 °C über die gesamte Heizperiode149) durch Heizen abgefangen wird, um Mitte März die 23 °C wieder zu erreichen. Das liegt genau im erwarteten Bereich für die heute übliche Kleidung, wenn die gültige internationale Komfort-Norm angewendet wird (ISO 7730).Deutlich erkennbare Abweichungen, ganz am Anfang und um den 12.11., beruhen überwiegend auf Auswirkungen bewusst geöffneter Fenster - die zwar protokolliert, aber in der Simulation bisher nicht abgebildet wurden150) . Der gesamte Bericht findet sich in der Literaturquelle [Feist 2023].
5. April: Neubewertung der "Strenge des Winters 2022/23"
Im Blog-Beitrag vom 4. Februar war ich zu dem Schluss gekommen, dass die Einsparungen in diesem aktuellen Winter überwiegend auf 'Glück mit dem Wetter' zurückzuführen waren. In der sehr warmen Kernwinterperiode (20.12.2022 bis 18.01.2023) war das auch zutreffend. Die umfassende Analyse des Wetterverlaufs in der vergangenen Heizperiode151) zeigt sich jedoch, dass im Mittel von Anfang November bis Ende März die Bedingungen auch nicht erheblich milder waren, als in den vorausgehenden 3 Jahren. So liegen die Heizgradstunden z.B. nur rund 0,5% unter denen des Winters 2019/20, der sich als „Vor-Corona-Zeitraum“ gut zum Vergleich eignet. Freilich lagen alle diese Winter schon ca. 8% unter dem langjährigen vorausgehenden Mittel, das den immer noch verwendeten Klimadaten für Gebäude-Energiebilanzen zugrunde liegt. Diese 8% sind das jetzt bereits erreichte Niveau aus der Veränderung des Klimas. Im Durchschnitt der künftigen Jahre wird das somit mit einiger Sicherheit so bleiben oder sogar noch milder werden.
Richtig bleibt, dass es aber durchaus auch Extremwinter mit lausiger Kälte geben kann: Wie sich das im nördlichen Bereich in Nordamerika gerade im vergangenen Winter gezeigt hat.
Genauer analysieren werde ich die quantitativen Auswirkungen für einen später folgenden Blog-Beitrag. Das wird uns einen weiter verbesserten Einblick in die Potentiale und die Umsetzungswahrscheinlichkeiten von durch Suffizienz-Maßnahmen erreichbaren Energieeinsparungen erlauben, denn die Randbedingungen dafür waren im vergangenen Winter stark verändert: Eine ernsthafte Verknappungssituation stand realistisch bevor, das wurde auch offiziell genau so kommuniziert, die Energiepreise waren massiv sprunghaft nach oben gegangen und die Bereitschaft zumindest eines großen Teils der Gesellschaft, sich dabei konstruktiv zu verhalten, war so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist vor diesem Hintergrund tatsächlich spannend zu ergründen, welche quantitativen Veränderungen vor einem solchen Hintergrund wirklich eintreten. Grob einschätzen lässt sich das anhand des bisher aufgelaufenen Gesamt-Gasverbrauchs der Heizgaskunden: der liegt rund 15% unter dem der Vorjahre. Ein Teil davon ist das mildere Klima152) , ein weiterer Teil die vermehrte Umstellung auf andere Energieträger153) und ein dritter Teil sind Fortschritte beim Dämmniveau der Gebäude; die gibt es, trotz der Vernachlässigung dieser Potentiale durch Wirtschaft und Politik, durchaus immer noch, wenngleich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau als eigentlich notwendig und empfehlenswert.
6. April: Kein Aprilscherz - Harald Lesch zu E-Fuels
Muss dazu noch etwas ergänzt werden? Kaum, es sei denn, die grundlegenden Erkenntnis in der Thermodynamik, die der Kollege Harald Lesch ein paarmal anspricht. Übrigens: Dazu finden sich hier auf Passipedia tatsächlich einige leicht verständliche Seiten; die sich noch erweitern lassen, bei Gelegenheit: "Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik". Allerdings: Das ist eher etwas mehr, als es für ein Verständnis dieses Videos notwendig ist. Das Notwendige steht nämlich in jedem Physik-Lehrbuch, sogar in denen für die Physik der Mittelstufe.
„E-Fuels: Die sind nur dann besser als Erdöl-Fuels, wenn der Kohlenstoff für die Gewinnung AUS DER ATMOSPHÄRE stammt.“ (klar, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn, denn sonst können wir auch gleich (billiger!) mit dem konventionellen Sprit weiterfahren).
„Wasserstoff wird freigesetzt aus Wasser durch Elektrolyse“ - dazu benötigen wir bereits viel elektrische Energie. „Dieser Strom muss von Erneuerbaren Energien kommen.“ >(conditio sine qua non - es benötigt einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie. Ergänzung: es gibt gleich drei hohe Strom-Inputs: (1) CO2 aus der Atmosphäre holen (das ist bereits ziemlich energieintensiv); (2) H2 O -Elektrolyse zu H2 (Das ist bereits allein schlechter als 1:1); (3) chemischer Prozess (Sabatier) um daraus Sprit-geeignete Verbindungen zu synthetisieren). Der größte Energieverlust folgt aber erst dann, nämlich wieder im Fahrzeug, in dem ein Verbrennungsmotor einen Wirkungsgrad von deutlich unter 50% aufweist. Der Motor erzeugt mechanische Antriebsenergie - die ein Elektromotor, gespeist aus einer Batterie mit über 90% Wirkungsgrad bereitstellen kann.
4. Juni: Seit 76 Tagen nur rein passiver Gebäudebetrieb und Grundsätzliches zur "Nuklearbatterie"
Ein kurzer 'Sachstandsbericht' - weil ich so lange nichts mehr eingestellt habe: Seit dem Abschalten der Wärmepumpe am 19. März gab es keinerlei aktive Wärmezufuhr und auch keine aktive Kühlung: Das Gebäude wurde in dieser Zeit rein durch einen adäquaten Umgang mit Fensteröffnungen und evtl. Schließen von Jalousien dauerhaft auf komfortablen Temperaturen (d.h. zwischen 21 und 24 °C in Aufenthaltsbereichen) gehalten.
Wie das in den 'Übergangszeiten' funktioniert, ist auch in diesem Papier zum Betrieb des Hauses genauer geschildert: Heizen und Kühlen, insbesondere in verschiedenen Jahreszeiten.
Die 'nukleare Batterie„ wird gerade in den Medien hochgespielt (Im hier behandelten Gebäude werden solche bisher nicht verwendet). Wie oft, in Wikipedia findet sich die seriöse grundlegende Information dazu: Nuclear Diamond Battery. Das entscheidende Faktum: um 100 µW = 1/10000 Watt liefert eine solche typischerweise. Ja, das genau passt zum physikalischen Prinzip (Nutzung der Elektronen aus einem $\beta$-Zerfall. Dies kann dann durchaus dauerhaft über 100 Jahre lang laufen. Das lässt sich durchaus gebrauchen, nämlich: Für den Dauerbetrieb von hoch-Energie-effizienten Feldsensoren, z.B. in Raumschiffen, aber auch für eine dauerhafte Datenerfassung (z.B. tief im Erdreich). Ein Ersatz für Erneuerbare Energie oder z.B. Fahrzeug-Akkus ist das natürlich nicht, mit sehr großem Abstand nicht. Die brauchen eine fast milliardenfache Leistung: einige zig kW.
Viele Mess- und Regelaufgaben können durchaus mit µW-Leistungen durchgeführt werden. Auch heute schon - das erleichtert auch die erneuerbare Versorgung, evtl. reicht eine kleine Solarzelle und es muss keine Leitung zum Netz verlegt werden. Das bringt's! Es ist ein typischer Fall für Effizienz-Technik.
Für Fahrzeuge, WP u.ä.: Da wird es fast immer eher um einige 100 Watt oder kW gehen. Auch das geht aber mehr oder weniger effizient: Energieeffizienz im Verkehr. Der Schlüssel ist immer die Effizienz-Technologie. Dann geht es mit der Elektrifizierung ganz einfach - und auch der Betrieb wird einfach, weil dann nicht ständig Batterien gewechselt oder die Versorgung sichergestellt werden muss. Und diese nukleare Batterie - die kann überhaupt nur in einem hocheffizienten Kontext von Bedeutung sein.
14. Juni: Wie ist das mit der Sommerhitze? immer noch kein Kühlbetrieb notwendig im Passivhaus
Oft gefragt: Wenn ein Gebäude so gut wärmegedämmt wird, wird es dann nicht im Sommer viel zu heiß? Für viele ist die Antwort wahrscheinlich überraschend: „Nein, ganz im Gegenteil, Wärmedämmung schützt nicht nur vor Kälte – sie schützt auch vor Hitze.“ Das wird im nächsten Abschnitt noch grundlegend beleuchtet. Die Physik dahinter: Durch Wärmedämmung wird keine Wärme erzeugt, auch keine Kälte; das Prinzip ist allein, die Wärme weniger leicht in einen geschützten Bereich hinein-zu-lassen (oder heraus-zu-lassen). Ganz präzis: Es gibt einen geschützten Bereich (da denken wir z.B. an unser Wohnzimmer), in dem wir gern komfortable Temperaturen haben möchten. Wenn nun aber ein bedeutender Teil der Umgebung (z.B. die Außenluft) viel heißer ist als es der Komfort erlaubt – dann wollen wir den geschützten Bereich von der zuströmenden Wärme aus der heißen Umgebung möglichst wenig beeinflusst sehen. Das genau macht Wärmedämmung: Indem eine Schicht von wenig wärmeleitendem Material zwischen den geschützten Bereich und die unkomfortable Umgebung angebracht wird. Im Konkreten ist das meist ein Material mit viel Luft154) ; z.B. Stroh ist hier geeignet, aber auch viele andere Materialien mit hohem Luftanteil155) . Das funktioniert auch bei einem anderen „Vorzeichen“: Wenn es in der Umgebung zu kalt ist, dann reduziert die Wärmedämmung auch den Wärmestrom von innen nach außen und lässt das Wohnzimmer weniger auskühlen156) . Ein anderes Beispiel ist die Thermoskanne: Schon mal Eistee mit Eis im Sommer serviert? Na ja, das Eis schmilzt natürlich mit der Zeit, weil Wärme aus der Umgebung des Trinkgefäßes nachströmt. Auch das ist leicht zu verringern, denn das Umfüllen in eine Thermoskanne hilft: Durch die Vakuum-Schicht zwischen der äußeren und der Inneren Flaschenoberfläche fließt nur noch extrem wenig Wärme nach: Das Eis im Gefäß hält so viel länger vor: Wärmeschutz schützt eben auch vor zu viel Wärme.
Wie sieht das nun konkret in unserem Passivhaus aus?
Wir haben gerade die erste „Hitzewelle“ des Sommers 2023 bei durchwegs sehr komfortablen Bedingungen im Innenraum ‚überstanden“, obwohl es außen über 30 °C heiß war – und zwar bisher ohne jede aktive Kühlung. Übrigens: aktiv Kühlen können wir mit unserer Luft/Luft-Wärmepumpe, wenn das denn nötig wird, auch; und zwar dann mit sehr geringem Stromverbrauch: Sehr viel weniger, als unsere PV-Anlage im Sommer regelmäßig liefert. Überraschend hier: Der evtl. Stromverbrauch für die Kühlung ist im Passivhaus in Mitteleuropa überhaupt kein Problem – aber das werden wir hier dann behandeln, wenn es soweit ist. Bisher jedenfalls wurde das aktive System gar nicht benötigt. 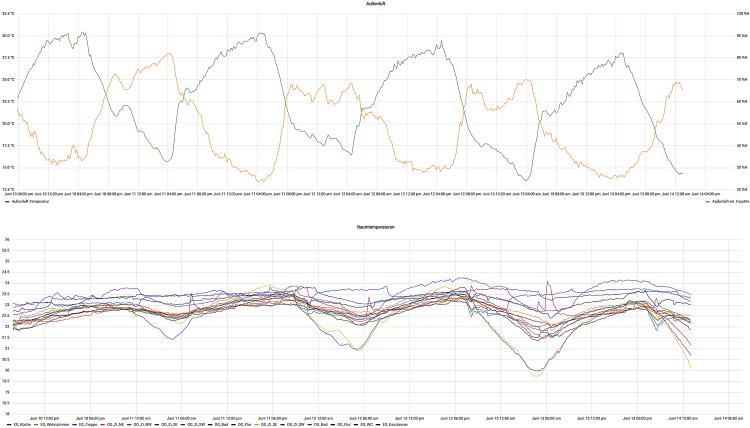
Messergebnisse vom 10. bis 14. Juni 2023: Dieses Diagramm zeigt, dass die Temperaturen überall im Haus im Bereich von 22 bis 24,2 °C bleiben, auch in der heißen Periode mit Außentemperaturen über 30°C. In der Kühle der Nacht wird in den beiden Räumen im Dachgeschoss durch die dort geöffneten Fenster die Temperatur bis auf rund 20 bis 21 °C abgekühlt. Ab ca. 9:00 steigen die Temperaturen aber auch dort wieder – nach dem Schließen der Fenster gegen die Mittagszeit aber nur noch wenig; jetzt ist die Außenluft spürbar wärmer als der Innenraum – es ist also besser, die Fenster zu schließen. Das geht auch im Passivhaus, denn die ausreichend dimensionierte Lüftung157) steht hier zur Verfügung – und die bringt im Wärmeübertrager vorgekühlte Luft158) ins Haus; das stellt schon einmal keine Wärmelast159) mehr dar! Die Raumtemperaturen gehen dann im Laufes des Abends durch ein Maximum, gegen etwa 20:00, üblicherweise zwischen 23 und 23,5 °C – danach kann durch erneutes Öffnen der Fenster wieder der nächste Nachtkühl-Abschnitt beginnen. In allen Räumen des Gebäudes bewegen sich die Temperaturen im gleichen Zeitraum zwischen 22 und 23,5 °C – mit der Ausnahme des „Computerraums“ im Obergeschoss/West, wo durch hohe innere Lasten Temperaturen von bis zu 24,3 °C erreicht werden; auch die sind aber immer noch im Sommer als komfortabel einzustufen. Fazit: Auch ohne aktive Kühlung ist es im Gebäude in der ersten Hitzeperiode des Jahres 2023 ganztägig angenehm.
Ein Hinweis ist schon hier angebracht: Die Verhältnisse ändern sich grundlegend, wenn die Umgebung auch in der Nacht nicht mehr unter 20°C abkühlt – dann ist ein nennenswertes Potential zur Nachtkühlung durch Lüften nämlich nicht mehr gegeben. Die Meteorologen sprechen dann von „Tropennächten“. Ein Passivhaus kann ein paar Tage in Reihe auch solcher Tropennächte wegen der Zeitkonstante noch überbrücken; ein weniger gut gedämmtes Haus kann das kaum, dort wird es dann schnell zu heiß. Aber, wenn die Nachtschwüle über Wochen anhält, dann ist die passive Form der Kühlung auch am Ende; in Häusern aller Bauart. Da hilft mit vertretbarem Aufwand dann nur aktive Kühlung160) – was das bedeutet, werden wir auch hier diskutieren – später, wenn es soweit ist. Das könnte schon in der nächsten Woche sein, denn der Wetterdienst kündigt schwüle Mittelmeerluft an – da das Wetter aber bekanntlich ein chaotischer Prozess ist, werden wir erst noch sehen, ob es wirklich so kommt.
15. Juni: Aktiv Kühlen? Erzeugt das nicht ein Riesenproblem für das Stromnetz?
Der Reihe nach: Seit 2016 betreiben wir eine Luft/Luft-Split-Wärmepumpe als alleinige Heizung im Gebäude. Das haben wir, speziell für den Winter 2022/23, hier im Blog unter vielen Aspekten beschrieben. Moderne Geräte dieser Bauart können auch „andersherum betrieben“ werden, im Fachjargon oft „reversibel“ genannt. D.h., die Seite, auf der das Geräte kühlt (im Winter kühlt es die Außenluft!) kann mit der anderen vertauscht werden. Dann erwärmt das Gerät161) die Außenluft mit Energie, die es auf der Innenseite dem Raumluftstrom entnimmt: Die Innenluft wird so gekühlt. Dabei benötig die Wärmepumpe natürlich elektrische Energie zum Betrieb. Diese Tatsache führt z.B. in Italien an besonders heißen Tagen oftmals zu Überlastungen im Stromnetz – weshalb die folgende Frage nicht selten gestellt wird: Handeln wir uns mit einer solchen aktiven Kühlung nicht elektrische Lastprobleme auch im deutschen Stromnetz ein? Hier (Spoiler-Alarm) gleich die Antwort vorweg: Die ist nämlich vollständige Entwarnung; nein, auch wenn künftig nahezu alle Haushalte auch in Deutschland in Hitzeperioden die Wärmepumpen rückwärts laufen lassen, um mehr Sommerkomfort zu bekommen, würde das KEINE Probleme erzeugen: Vorausgesetzt, die Geräte werden sachgerecht eingesetzt und die Gebäude einigermaßen sommertauglich gemacht – eben mindestens auf einem EnerPHit-Energieeffizienz-Niveau. Hier kommen die Gründe:
- Die Kühllasten in einigermaßen vernünftig gedämmten Gebäuden mit einigermaßen vernünftigem Sonnenschutz sind in Deutschland auch künftig nicht extrem hoch.
- Moderne Geräte dieser Art162) sind inzwischen erheblich effizienter, als sie früher einmal waren: Noch vor einem Jahrzehnt wurde für 1 kW Kühlleistung oft auch 1 kW elektrische Energie gebraucht163) . Heute kommen gute Geräte auch in der Praxis auf Werte über 5, d.h., für 1 kW Kühlleistung werden nur rund 200 Watt elektrische Energie benötigt164) .
- Punkt 1 und Punkt 2 zusammen führen auf sehr niedrige elektrische Lasten: Denn, vernünftig verschattete Wohnungen in Deutschland kommen mit durchschnittlichen Kühlleistungen im Bereich von unter 2 kW aus. Die zugehörige mittlere elektrische Last liegt dann bei rund 400 Watt 165) . Würden alle 41 Millionen Haushalte solche Geräte gleichzeitig betreiben, dann ergäbe sich dadurch eine elektrische Gesamtlast von 16 GW. Zum Vergleich: Die Maximallast tritt derzeit bei uns im Winter auf, 82 GW kommen dabei vor. Demgegenüber liegt die Lastspitze im Sommer derzeit bei rund 70 GW, und das maximal über 6 Stunden des Tages, im Mittel sind es sonst rund 60 GW. Zählen wir da 16 GW zusätzlichen Kühlstrom dazu, wird der Wert der winterlichen Spitze immer noch nicht erreicht166) .
- Es kommt besser: Durch den Ausbau der Photovoltaik werden wir in Europa schon bald insbesondere bei gutem Sonnenschein bedeutende Überschüsse im Netz bekommen: Im Übrigen genau zu solchen Zeiten, in denen die Klimatisierung am ehesten gebraucht wird. Schon im Juni 2023 lag die PV-Erzeugung um die Mittagszeit bei über 40 GW allein in Deutschland. Weil wir in jedem Fall mehr PV brauchen werden, insbesondere für den Zeitraum Oktober bis Februar – wird durch den weiteren Ausbau der PV das solare Stromangebot im Sommer in 10 Jahren 100 GW überschreiten – und auch die Windkraft wird dann (fast immer) über 12 GW liefern. Selbst bei vollem E-Fahrzeug-Ladebetrieb bleibt da eine Menge sommerlicher Überschussstrom – die im Kühlbetrieb arbeitenden Wärmepumpen, selbst wenn sie weit verbreitet sind, werden diese Energiemengen gar nicht brauchen167) .
Wieviel Strom für die Kühlung einer gut gedämmten Wohnung auch in Hitzeperioden tatsächlich gebraucht wird, das gibt die Publikation "Heizen mit dem Klima-Splitgerät" [Feist 2022] aus den Erfahrungen vergangener Jahre wieder. Bisher, in diesem Jahr (2023), haben wir das Splitgerät noch nicht für die Kühlung eingesetzt. Mal sehen, ob sich das wegen der fürs Wochenende angkündigten Schwüle ändert.
Siehe auch: Ist aktive Kühlung grundsätzlich zu vermeiden
18. Juni: Hitze-Spitze? 32°C
Jetzt ist die angekündigte Hitze zwar da, 32°C im Schatten messe ich gerade, auf der Nordseite des Hauses. Trotzdem haben wir keine Kühlung eingeschaltet, denn: 22°C (!!) messe ich gerade als Raumtemperatur, und das ist im zweiten Obergeschoss, im „Studio“, da wo auch der Computer läuft, an dem ich das gerade formuliere. Wie ist das möglich? Ohne aktive Kühlung? Worauf es vom Wetter her wirklich ankommt, das sind die Temperaturen in der Nacht. Und da hatten wir bisher wirklich Glück: Denn es hat noch jedes mal deutlich unter 14°C abgekühlt in der Umgebung. Da lag die Wettervorhersage (aller Kanäle) wirklich falsch: Die hatten noch einen Tag zuvor eine Tropennacht (über 20°C) angekündigt. Und, leicht verständlich, dann würde es schwieriger mit dem passiven Kühlhalten und das in jeder Art von Gebäude; wenn es eben keine kältere Quelle gibt kann auch das Gebäude eingesammelte Wärme nicht mehr loswerden. Dann hilft für eine gewisse Zeit die „Zeitkonstante“. Die Masse des Gebäudes ist auf niedrigen Temperaturen - und kann etwas Energie aufnehmen; da wird das dann so um 1 Grad wärmer jeden Tag. Drei bis vier Tage ist das in einem gut gedämmten Gebäude durchzuhalten - aber dann gleicht sich auch hier die Innentemperatur den äußeren Bedingungen an - wenn nicht Energie auf anderem Weg hinausgeschafft wird. Mal sehen, was die kommenden Tage bringen. Die „Prognosen“ der Wetterdienste weisen alle in Richtung noch heißer, aber erst nach einem Regen-Zwischenspiel, das der Natur jetzt wirklich zu gönnen wäre. Damit wir diskutierbare „Life-daten“ zum Stromverbrauch des Splitgerätes bekommen. Nachtrag gegen 23:00 - die Tropennacht kündigt sich nun wirklich an: Draußen ist es noch immer „angenehm warm“, Temperaturen, bei denen es angenehm ist, in der Badehose am Balkontisch zu sitzen. Das bietet nicht viel Kühlpotential, denn im Haus ist es momentan noch kühler (22,6°C). Feuchtere Luft ist angekommen und der Himmel ist bedeckt - die Wärmeabstrahlung wird durch die Wolken reduziert. Die Meteorologen sagen Tiefstwerte um 20°C voraus. Das bietet nur ein bescheidenes Nachtlüftungs-Potential. Trotzdem wird es wohl auch morgen keine Notwendigkeit geben, die aktive Kühlung zu nutzen.
19. Juni 2023: Für passiv/aktiv entscheidend: Die Nacht-Temperaturen
Diesmal hat die Wetterprognose sich bewahrheitet: Die erste 'Tropennacht' dieses Jahres, die Außentemperatur ging nicht unter 20°C zurück. Für „passiv durch Fensterlüftung“ ist dann das Nachtauskühl-Potential gering. Selbst große Luftvolumenströme können bei nur noch um 1 Grad Temperaturdifferenz nicht viel Energie aus dem Haus schaffen. Innen wird natürlich fleißig weiter Wärme freigesetzt - wir selbst tun das (so um 100 Watt/Person), die elektrischen Geräte wie z.B. der Computer und auch der Kühlschrank168) . Dennoch: Derzeit ist es nach wie vor komfortabel überall im Haus, immer noch ohne aktive Kühlung, zwischen 22,4 und 23,3 °C. Das ist so etwa ein halbes Grad mehr als bisher. In etwa in diesem Bereich von 0,5 bis 1 Grad Anstieg jeden Tag unter den jetzt herrschenden Bedingungen erwarten wir169) . Da dauert es 3 bis 4 Tage, bis die Temperaturen an die Komfortgrenzen herankommen und erst dann wird gegebenenfalls auch aktiv gekühlt werden. Ob das in dieser Wetterlage noch soweit kommen wird? Es lässt sich immer noch nicht sicher vorhersagen, denn, der Wetterdienst stellt für Montag und Dienstag weitere Tropennächte in Aussicht - aber schon am Mittwoch soll der lang ersehnte Regen kommen und auch die Temperaturen am Tag wieder absenken. Es kann also durchaus sein, dass wir hier den Juni noch ohne Betrieb des Split-Gerätes auskommen. Ein solcher aktiver Sommerbetrieb findet gegenwärtig nur in länger anhaltenden Hitzeperioden mit Tropennächten statt. Derzeit sind die in unserem Klima noch nicht besonders häufig - nur, dass sich das leider in den kommenden Jahrzehnten ändern wird170) . Umfassend diskutiert wird die Frage, welche Temperaturen im Sommer in Hitzeperioden noch als „komfortabel“ gelten können. Da gehen immer wieder sehr subjektive Aspekte ein - und nicht selten wird das eine emotional geführte Diskussion. Wir plädieren daher dafür, dies den Menschen jeweils weitgehend zu überlassen - nämlich ihre jeweiligen Sommer-Komfort-Temperaturen zu wählen. Ethisch vertretbar geht das allerdings nur, wenn dadurch keine desaströs hohen Umweltschäden erzeugt werden. Ob das der Fall sein kann, darauf gehen wir später ein - sobald wir erste Messwerte des zugehörigen Verbrauchs in diesem Sommer gemessen und diskutiert haben. Für den Umweltaspekt ist der „mittlere Wert“ dieser noch-Komfort-Temperatur entscheidend: Der Wert, welcher sich bei freier Wahl der Raumtemperaturen im Sommer im Mittel im Aufenthaltsraum171) ergibt. Interessanterweise hat bereits Ole Fanger umfangreiche solche Tests durchgeführt und die Ergebnisse publiziert [Fanger 1960]172) : Die sind Grundlage der Norm ISO 7033. Der damit bestimmte Wert hängt natürlich noch von der Kleidung ab173) . Nehmen wir da eine konventionelle Position ein, bei der zwar kurze Hemden, aber keine kurzen Hosen 'akzeptiert' sind, dann lassen sich Sommer-Cloth-Werte um 0,44 Cloth ansetzen. Mit denen sind dann um 25,75 °C operative Temperatur noch im vollständig besten Komfort-Feld (Komfortklasse A). Das führte auf den Ansatz von „25 °C“ Solltemperatur im Sommer, den wir auf der sicheren Seite ansetzen 174) , wenn wir abschätzen wollen, wie hoch solche Sommerverbrauchswerte für die Raumkühlung werden können. Bei einer so angesetzten Maximaltemperatur ist dann auch nicht mit gesundheitlichen Risiken durch die Hitze zu rechnen. Dass es solche Risiken gibt, wenn Temperaturen dauerhaft z.B. über 30 °C liegen, ist empirisch allerdings unstrittig. Im Bericht zum Klimagerät [Feist 2022] haben wir bereits gezeigt, dass sich mit einem einzelnen solchen Gerät in einer Passivhauswohnung die operative Temperatur ganzjährig im „A“-Komfortbereich halten lässt; im Sommer werden dann 25°C Raumtemperatur nicht mehr überschritten. Die Fragen sind dann: Mit welchem Aufwand? Und: Zu welchen Kosten? Die Frage des Aufwandes haben wir auf dieser Seite bereits dokumentiert: Praxiserfahrung mit der Installation eines Splitgerätes. Auch, welche Investitionskosten dabei anfallen175) . Wie hoch die Betriebskosten sind, lässt sich aus dem Stromverbrauch berechnen176) .
20. Juni 2023: Die zweite Tropennacht
Die Wetterprognosen waren ziemlich akkurat: Es kühlte nicht unter 20°C ab im Außenbereich und eine Regenfront zog durch; letzteres erschwert die Nachtlüftung in der Praxis zusätzlich, denn, 'reinregnen' soll es ja auch nicht unbedingt. Wie im Blog von gestern beschrieben: Die Raumtemperaturen steigen unter diesen Bedingungen ganz allmählich an. Am heutigen Morgen liegen sie zwischen 22,9 °C im Erdgeschoss und 23,6 °C im Studio im Dachgeschoss. Komfortabel - und nur 0,4 Grad mehr als am Vortag. Die mittlere Temperatur im Haus liegt heute mit rund 23,3 °C sogar immer noch unter der mittleren Außenlufttemperatur von etwa 25 °C. Groß ist die Differenz nicht - und wer im Physik-Unterricht aufgepasst hat, wird sich fragen: Wie ist denn das überhaupt möglich? Die Antwort: Etwas „nerd-ish“, aber vielleicht durchaus als Praxisbeispiel interessant:
- Wieso finden es (auch Physiker) zunächst überhaupt verwunderlich? Weil es für die Wärme das Prinzip gibt: Sie fließt nur vom System der höheren Temperatur zu dem mit der niedrigeren. Wenn nun im Durchschnitt in der gesamten Umgebung eines Systems höhere Temperaturen vorliegen als im System, dann scheint der Mittelwertsatz der Potentialtheorie (Laplace-Gleichung) verletzt - und er ist es auch.
- Die Auflösung: Die Laplace-Gleichung beschreibt (quasi-)stationäre Prozesse; hier haben wir es aber mit einer Dynamik zu tun, in der die Fourier'sche Differentialgleichung gilt - da kann es durchaus „Nester“ mit noch niedrigeren Temperaturen im Inneren eines Temperaturfeldes geben. Die haben es allerdings auf Dauer nicht leicht: auch in der Nichtgleichgewichts-Thermodynamik drängt alles letztlich zum Ausgleich177) . Die verbleibenden sich „noch erinnernden“ Wärmekapazitäts-Blasen mit eingeschlossenem früherem Temperaturniveau werden allmählich ebenfalls auf die mittleren Temperaturen hochgezogen - in der Praxis in einem Gebäude sogar noch etwas höher, denn es wird im Inneren ja zudem auch noch Wärme freigesetzt.
- Solange, wie die Episoden mit insgesamt zu großer Hitze kurz genug sind und immer einmal wieder durch z.B. eine kühle Nacht abgelöst werden, kann die Wärmekapazität des Gebäudes sozusagen einspringen. Für ein paar Tage hält das vor - dauerhaft hohe Umgebungstemperaturen lassen diese instationären Effekte aber unwirksam werden. Wenn es dann dauerhaft z.B. über 24 °C sind im Außenraum, wie das in manchen Wettersituationen und in einigen Regionen der Welt auch heute schon ist, dann ist der rein passive Kühlbetrieb am Ende. Aktiv, d.h. mit einer Wärmepumpe unter Zufuhr von Antriebsenergie, lässt sich auch dann immer noch Wärme aus dem Haus hinausschaffen - entgegen dem natürlichen Temperaturgefälle. Eine geniale Erfindung - die wirklich noch nicht alt ist (Carrier 1911 zugeschrieben; dies war möglich geworden, weil die Grundzüge der Thermodynamik inzwischen verstanden waren). So „richtig mit bedeutenden Leistungen aktiv Kühlen“ können wir als Menschheit somit erst seit wenig mehr als 100 Jahren.
Dass wir die aktive Kühltechnologie verfügbar haben, hat z.B. die Besiedlung weiter Teile der Welt erst möglich gemacht. Oft scheiden sich dann daran die Geister: Während viele es als Segen der Technik preisen, gibt es Kritiker einer so realisierten 'künstlichen Welt'. Wie oft in Debatten dieser Art, verbauen die jeweiligen Extrempositionen eine nachhaltige Lösung: Der Aufwand für die Kühltechnologie, insbesondere der an Energie178) kann nämlich gering gehalten werden - mit effizient verschatteten Gebäuden, maßvollen inneren Wärmelasten und effizienten Wärmepumpen. Dass da Faktoren zur Verbesserung vorliegen (mindestens 3 bis 5 gegenüber 'alten' Systemen) überrascht oft. So verbesserte Systeme brauchen dann nur sehr wenig natürliche Ressourcen - die dann sogar wieder vollständig in die natürlichen Energie- und Stoffkreisläufe eingebettet werden können: Das vollständig mit PV betriebene effiziente Klimagerät (z.B. mit Propan als Kältemittel) in einem vernünftig geplanten und gebauten Haus erzeugt kein179) Umweltproblem mehr. Die Praxiserfahrung dazu wird in späteren Einträgen aufgearbeitet.
Missverständnisse vermeiden!
- Es gibt ein sich in der Zukunft verstärkendes Problem: Die Sommer werden (auch und gerade in Europa) heißer. Dabei nehmen auch in Gebieten, in denen es das vor ein paar Jahrzehnten noch kaum gab, die Zahl der Tropennächte zu.
- Das reduziert die Aufenthaltsqualität im Freien, wenn wir dem nicht entschieden entgegen wirken180) . Tun wir das, wird es den Anstieg erträglicher machen, völlig aufheben können wir den aber nicht mehr, dazu ist bereuts zu viel Klimawandel 'gebucht' durch die Emissionen in der Vergangenheit.
- Der jetzt schon unvermeidbare Anstieg der Temperaturen kann in den Aufenthaltsräumen tatsächlich abgefangen werden - in dem diese auch in Europa zunehmend auch aktiv gekühlt werden. Wenn das klug und effizient gemacht wird, das zeigt die Analyse hier, dann muss das die Probleme, die wir haben, nicht auch noch verstärken. Das setzt drei Punkte voraus: a) die Gebäude brauchen guten sommerlichen Hitzeschutz b) die aktiven Systeme müssen hocheffizient sein c) der Ausbau der PV muss zügig vorangehen, denn diese Systeme dürfen keinesfalls mit fossil erzeugtem Strom betrieben werden.
- Ein interessanter Aspekt: Die Raumklimageräte können im Winter und vor allem in der Übergangszeit auch zur Heizung, zumindest zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Das ist sogar ökonomisch interessant - und es spart in jedem Fall Klimagas-Emissionen. Wie sich das in der Praxis darstellt, haben wir im Winter-Teil dieses Blogs schon dargestellt Klimagas-Bilanz der Heizung mit dem Splitgerät.
Zwischenstand am Abend des 20. Juni: Im Dachgeschoss West (Studio, wo ich gerade sitze) haben wir jetzt 24,8 °C Raumtemperatur erreicht. Mit einem kurzärmligen Hemd und leichter (aber immer noch langer) Hose ist das thermisch subjektiv weiterhin angenehm; auch ohne wahrnehmbare Einschränkung der Produktivität. Bei weiter steigenden Temperaturen ändert sich letzteres - das ist jedenfalls bisher meine Erfahrung. Noch bis hinauf zu rund 26°C kann mit etwas mehr Luftbewegung181) die Situation immer noch etwas aufgebessert werden. Dann wäre allerdings auch eine kurze Hose angenehmer.
21. Juni 2023 (bewölkt)
Heute wird die Sonne nur wenig scheinen - und es wird daher auch tagsüber nicht so heiß, 27 °C Außenlufttemperatur sind angesagt. In der Nacht hatte es aber trotzdem kaum ausgekühlt, im Mittel der Nacht waren es immer noch über 19 °C. Das erlaubt keine bedeutende Auskühlung durch Nachtlüftung: Die inneren Wärmekapazitäten der Betondecken und Innenwände liegen jetzt bei rund 23,5 °C, die Raumtemperaturen liegen zwischen 23,2 und 23,7 °C. In einzelnen Räumen waren gestern für kurze Zeit sogar 25°C erreicht worden. Dennoch: Das Splitgerät bleibt derzeit, bei wieder unter 24°C überall, noch aus. Die Wetterprognosen sagen ein anhaltend 'tropisches' Wetter für die kommenden zwei Wochen voraus - der Tag, an dem dann die aktive Kühlung eingesetzt wird, wird kommen. 14 bis 16 kWh/Tag hat die PV-Anlage in den letzten Tagen jeweils erzeugt. Im Sommer ist das seit ihrer Installation 2015 immer deutlich mehr gewesen als der gesamte Stromverbrauch, der im Sommer bei rund 8,5 KWh/Tag liegt. Die Energie, die hier 'übrig' bleibt, wird ins lokale Stromnetz eingespeist. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre wissen wir, dass der gesamte Sommerstrom-Verbrauch der so betriebenen Split-Anlage bisher jeweils bei unter 60 kWhel lag. So etwa drei Monate beträgt der Zeitraum, in dem aktiver Betrieb vorkommen kann: beginnend Mitte Juni und zuletzt irgendwann im September. Je Tag sind es dann unter 0,7 kWh Strom für das „Kappen der Temperaturspitzen“ im Haus und keinem Überschreiten von 25 °C(vgl. die Publikation der Daten in [Feist 2022]). Der Stromverbrauch dafür beträgt damit weniger als 5% der PV-Stromerzeugung der moderat dimensionierten Solaranlage auf dem Dach. Eine Gesamteinschätzung erlaubt der Bezug auf die Wohnfläche: der Kühlstrom-Verbrauch liegt danach unter 0,36 kWh/(m²a) - und das selbstverständlich ausschließlich im Sommer. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch eines modernen effizienten Kühlschrankes liegt bei um 120 kWh/a (entsprechend 0,77 kWh/(m²a), der Stromverbrauch für die Heizung in diesem Haus bei rund 4 kWh/(m²a)(siehe "Heizstromverbrauch 2022/23"); in durchschnittlichen Gebäuden ist der Energieverbrauch allein für die Heizung mit rund 128 kWh/(m²a) um einen Faktor 32 (!!) höher. Der außerordentlich geringe Bedarf für die aktive Kühlung in einem vernünftig gebauten und genutzten Wohngebäude in Deutschland kann somit tatsächlich als vernachlässigbar angesehen werden. Wird auch noch berücksichtigt, dass die Kühlung ausschließlich zu Zeiten mit hohem Solarangebot durchgeführt werden kann, wird erkennbar, dass die Sorge vor einer sommerlichen 'Klimastrom-Spitze' unberechtigt ist. Vorausgesetzt werden muss dabei allerdings, dass die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden - gute Verschattung und gute Wärmedämmung, insbesondere der Dächer.
22. Juni: Außenbedingungen jetzt schwül
Eine Korrektur: Die Außentemperaturen am gestrigen Mittwoch waren dann doch noch auf über 30 °C angestiegen. Die dritte Tropennacht in Folge kommt dazu - dennoch konnten die Temperaturen im Haus in einem Bereich von 24 bis 25 °C gehalten werden. Das Diagramm zeigt die Messdaten und verdeutlicht die Reaktion des Gebäudes.
In den Tagen bis zum 19. Juni waren die Außentemperaturen in der Nacht immer noch soweit abgefallen, dass wir mit nachts geöffneten Fenstern die Temperaturen leicht in einem für uns sehr behaglichen Bereich halten konnten (türkis unterlegte Zeiträume). Das hält dann im gut gedämmten Haus auch für den ganzen Tag vor. Mit dem Einsetzen der Tropennächte fehlt dieses Kühlpotential fast vollständig - präziser, es wird auf ein deutlich höheres Temperaturniveau verlegt. Gut erkennbar ist jetzt (hellrot unterlegt), wie die Temperaturen auch im Haus jetzt jeden Tag um etwa 0,5 bis 0,8 °C zunehmen.
Seit heute kommt ein weiterer Komfort-Parameter ins Spiel: Die Luftfeuchtigkeit. Die liegt für die (inzwischen 24°C warme) Außenluft bei rund 80% - das entspricht einer Taupunkttemperatur von über 17°C; das ist der Bereich, in dem die meisten Menschen beginnen, die Luft als „schwül“ zu empfinden. Im Innenraum sind wir da noch nicht (derzeit rund 14°C Taupunkttemperatur), allerdings erfolgt auch hier natürlich mit der Zeit ein Angleichen.
Aus zwei Gründen haben wir daher jetzt das Klimasplitgerät im Erdgeschoss in Betrieb genommen:
- Die Kerntemperatur des Hauses (die Betondecken und Innenwände) kann so dauerhaft auf unter 23°C gehalten werden, auch wenn heute im Verlauf des Tages noch Wärme, vor allem durch die inneren Wärmequellen, dazu kommt.
- Das Klimagerät kühlt mit einer Wärmetauscher-Innenoberfläche, deren Temperatur unter 14 °C liegt - da gibt es somit unter den vorliegenden Raumklimabedingungen zunächst Kondensat. Dieses Tauwasser wird über die Kondensatleitung ins Abwasser geleitet - und das bedeutet, dass die entsprechende Feuchtigkeit das Haus verlässt. Das senkt - unmittelbar beobachtbar und spürbar - die rel. Feuchte der Raumluft ab und lässt sehr schnell das Raumklima behaglicher empfinden.
Was wird denn nun 'verbraucht' durch das Klimasplitgerät im Kühlbetrieb?
In der ersten Stunde des Betriebes wurden rund 220 Watt aus dem Netz gezogen. Zum Vergleich: unsere Photovoltaik-Anlage lieferte im gleichen Zeitraum bereits 874 Watt; immer noch mehr, als alle Verbraucher im Haus, inkl. des Klimagerätes, benötigt haben. Nun muss ein solcher Einzelwert nicht besonders typisch für die Gesamtbewertung sein. Wir berichten daher weiter, wenn die entsprechenden Messdaten vorliegen182) . Der Stromverbrauch (insgesamt) für das Klimagerät an diesem Tag summiert sich auf 3.04 kWh; das entspricht einer mittleren Last von 127 Watt. Zum Vergleich: der übrige Stromverbrauch, inkl. der für die Computer und den gesamten Haushalt lag bei 7,7 KWh, die PV-Anlage hat 14,8 kWh geliefert. Wir haben somit heute immer noch ca. 4 kWh Strom an das Netz abgegeben (netto). Die aktuelle Wetterverlaufsprognose für den heutigen Tag (22. Juni 2023) sieht nun danach aus, als ob wir hier in Darmstadt kaum etwas von dem Regen abbekommen werden, der zumindest den mittleren Teil Deutschlands heute durchläuft; dort könnte es an vielen Orten dann wieder „zu viel davon“ werden. Diese Ereignisse entsprechen genau den Warnungen, die seitens der Klimaforschung seit Jahrzehnten gegeben werden: Die Wetterbedingungen werden im Mittel heißer, nahezu überall auf dem Planeten. Zugleich werden aber die Wetterereignisse extremer: Es kommt dann Regen massiv konzentriert und lokal begrenzt - sowie für kurze Zeit, während es an anderen Orten sehr lange trocken bleiben kann. Diese Veränderungen sind sehr ungünstig - neben den direkten Schäden durch Extremwetter gibt es die Auswirkung der im Mittel dauerhaft zu geringen Niederschläge. Ich werde nicht müde werden, zu betonen, wie wichtig es ist, dass wir diese Entwicklung abfangen, bevor zu viele irreversible Schäden auftreten. Hohe Energieeffizienz und Umstellung auf erneuerbare Energie sind dafür die besten Lösungen - wie wir hier sehen, führen die, richtig angegangen, sogar zu bedeutend verbessertem Komfort.
Ein Zwischenruf
Das Folgende ist mir gerade aufgefallen: Ziemlich gleichgültig, welchen „social-media“-Kanal und welche „Bubble“ Du benutzt: Ein sehr großer Teil der Postings besteht aus „Empörungs-Äußerungen“. Es wird irgendwas ausgesucht, ein Vorgang, er kann gern auch völlig unbedeutend und missverstanden sein - und dann wird, immer gerne auch auf die Person, die damit verbunden wird183) eingehauen; erstmal verbal. Diese „Empörungsäußerungen“ werden mit besonders viel Interesse belohnt - das ist übrigens ein Trick, den die sogenannten „Spin-Doctors“ für die US-Wahlkämpfe schon seit langem praktizieren. Aufpassen müssen diejenigen, die etwas posten, natürlich immer, in welcher Bubble sie da sind. Demgemäß ist es jeweils z.B. nicht erlaubt den Begriff „Kernkraft“ zu verwenden; oder auch umgekehrt, im anderen Bubble „Atomkraft“. Jetzt mache ich das hier gerade genauso: Ich poste über eine Entwicklung, die mir überhaupt nicht passt. Warum passt mir die „Bubblifizierung“ der Gesellschaft nicht? Weil es sehr schnell gar nicht mehr um Argumente geht - sondern ausschließlich um das „Einhauen“ auf die jeweils als 'Feinde' erklärten anderen. Dass das eine Strategie ist, den Status quo (bzw. das Business As Usual, BAU) zu erhalten, ist offensichtlich. Denn: Ohne ernsthaft geführte Debatte kann eine eingeschlagene Richtung kaum geändert werden, es sei denn, mit Gewalt. Was die Gewalt angeht: Die kann und wird die Probleme nicht lösen, denn die Geübtesten in Gewalt sind gerade nicht die Geübten bei der Findung von Lösungen. Dass gar nicht wenige sich fortschrittlich gebende Akteure aber die gleichen Strategien - einen vermeintlichen Feind suchen und den dann verunglimpfen - anwenden, da scheint mir vieles nicht verstanden. Denn Fortschritt ist nur durch Überzeugung zu realisieren, und dazu muss ich mit den Menschen reden, auch mit denen, deren Ansichten ich nicht teile. Dazu braucht es rationale Regelungen für die Debatte; dass einige sich solchen nicht fügen wollen, kann eigentlich nur die Konsequenz haben, sie genau darauf hin zu weisen und nicht etwa in die gleiche Masche zu verfallen. Ich habe übrigens eine interessante Beobachtung gemacht: Die Dinge, die wirklich 'gar nicht gehen', die werden zwar manchmal184) in extremer Form verteidigt; in ein paar Jahren ist davon dann aber gar nicht mehr die Rede. Beispiele:
- Die Sonne dreht sich um die Erde, daran zu zweifeln, ist eine Blasphemie.
- Newton'sche Licht-Korpuskeln im Gegensatz zu Huygens Wellentheorie.
- „Kinderfüße müssen immer erst geröntgt werden, bevor die einen Schuh anprobieren dürfen“. Ging mir als Kind noch so (!!).
- „Radon fördert die Gesundheit“
- „Ohne Kernkraftwerke gehen schon 1990 die Lichter aus“
- „Strom wird schon bald so billig werden, dass sich der Einbau von Zählern gar nicht mehr lohnt.“
- „Sicherheitsgurte gefährden Menschenleben.“
- „SO2-Filter sind der Ruin der Kraftwerksbranche.“
- „Die Katalysator-Pflicht ist der Ruin der Automobilwirtschaft.“
- „Die Privatisierung und Deregulierung der Energiewirtschaft wird den Strompreis nachhaltig, dauerhaft und sehr stark senken.“
- „Photovoltaik ist eine Weltraumtechnologie, die wird immer sehr teuer bleiben, als Alternative Energiequelle ist das Wolkenkuckucksheim.“
- „Rauchen ist gesund und sexy“,
- „Der Atomausstieg ist nur mit massivem Kohlekraftwerks-Ausbau machbar“ (das war noch 2010 eine Position der Fortschritts-Energie-Bubble)
- „Erdgas ist die Brückentechnologie für eine nachhaltige Zukunft“: oh, ich fürchte, das glauben sogar heute noch (oder wieder?) viele.
Genug gemeckert. Ich könnte ein paar „moderne Aussagen“ hier aufführen, die in die gleiche Kategorie fallen. Das mache ich aber jetzt ganz bewusst nicht185) . Wir wollen es hier anders halten - konstruktive, lösungsorientierte Hinweise auf Wege, welche Probleme ausräumen können. Auch wenn das nicht wirklich ein „Clickbait“ ist. Hinweis: Hier gibt es jetzt eine Zusammenstellung, wie Hitze in sommerlichen Extremsituationen besser ertragen werden kann: Hitzebelastung reduzieren.
23. Juni: Entspannte Wetterlage nach Durchzug der Störungen
Viel geregnet hat es hier in Darmstadt gestern nicht - die Gewitterzellen sind nördlich und südlich vorbeigezogen. Aber die kältere Luft ist dennoch angekommen - heute Nacht gingen die Außentemperaturen dann wieder auf rund 18°C zurück; mit etwas Wind kann das schon die Nachtlüftung wieder wirksamer machen - so liegen die Raumtemperaturen am heutigen Vormittag zwischen 22,6 und 23,6 °C - da kann die aktive Kühlung heute schon wieder „AUS“ bleiben. Bei vernünftig eingestellten Sollwerten macht das die Regelung des Splitgerätes automatisch so: Allerdings, ein Standby-Verlust von rund 10 W, das müsste nicht sein, da gibt es ein bedeutendes Effizienzpotential für die Weiterentwicklung bei diesen Geräten186) .
Noch ein paar weitere gute Nachrichten
Tatsächlich liegt derzeit im Monatsmittel der Gasverbrauch in Deutschland weiterhin um rund 18% unter dem langjährigen Mittelwert (2018-2021). Die Maßnahmen zur Einsparung von Erdgas sind also weiterhin wirksam - auch im Sektor Haushalte. Offenbar wurde doch weit mehr an nachhaltig wirksamen Ansätzen durchgeführt, als allgemein angenommen. Auch nicht auszuschließen ist, dass eine Motivation für einen sparsamen Umgang immer noch vorliegt - auch wenn die Preise jetzt wieder gefallen sind. Überraschend (zumindest für mich): Auch der Stromverbrauch ist gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um rund 4% zurück gegangen. Das spart den Verbrauchern Kosten, es reduziert den CO2-Austoß direkt - und führt auch noch dazu, dass der Anteil der erneuerbaren Erzeugung am Gesamtstrom zunimmt187) . Die Kapazitäten für die erneuerbare Stromerzeugung haben ebenfalls messbar zugenommen, insbesondere bei der Photovoltaik wird das mit erkennbar höheren Leistungen deutlich. Die Entwicklungen zeigen, dass die Umstellung des Energiesystems auf nachhaltige Lösungen funktionieren kann. Keine Frage, der Zubau sowohl bei der PV als auch insbesondere bei Windkraftanlagen muss noch erheblich gesteigert werden: Das ist aber ohne weiteres möglich. Die Verbesserung der Energie-Effizienz ist vielfach als das bedeutendste Potential noch nicht erkannt - dennoch gibt selbst unter diesen Umständen eine gewisse Umsetzung: Neue Fenster sind eben heute von vorn herein besser als die alten und neue Kühlschränke sogar bedeutend besser als die Altgeräte, die sie ersetzen. Dass das bei neuen Kraftfahrzeugen noch nicht selbstverständlich ist, muss sich ändern188) .
Und noch die konkreten Werte aus dem Passivhaus Kranichstein: Die Temperaturen liegen in den Räumen am Nachmittag bei 22,8 bis 24°C. Ein Betrieb der aktiven Kühlung ist daher nicht erforderlich - wir haben das Splitgerät wieder vom Netz getrennt. Wenn nach einer Hitzeperiode durch ein durchlaufendes Tiefdruckgebiet die Außentemperaturen spürbar absinken, dann lässt sich durch Lüften jedes Gebäude relativ schnell (ein bis zwei Tage) wieder auf Komforttemperaturen herunterkühlen. Das ist auch in einem Passivhaus nicht anders - anders ist allein, dass die so „entladene innere Wärmekapazität“ des Hauses auf diesem Weg wieder für 2 bis 3 Tage 'vorhält', um Energie aufzunehmen, wenn es dann doch wieder heiß oder schwül werden sollte. Wie wir mit dem gestrigen Tag gesehen haben, ist der Zeitraum für eine solche 'Kälteeinspeicherung' aber begrenzt, insbesondere, wenn die Nachttemperaturen nicht mehr wesentlich zurückgehen. Diese „Spitzen“, derzeit meist nur wenige Tage, kann das Split-Klimagerät kappen und auch in diesen Zeiten noch hohen Komfort garantieren.
24. Juni: Sommersonne mit kühlen Nächten
So stellen wir uns in Mitteleuropa 'schönes' Sommerwetter vor: Es scheint die Sonne, vielleicht ab und zu ein paar Wolken. In der Nacht kühlt es dann aus. Das ist die typische kontinentale Wetterlage in einem Hochdruckgebiet, auch die Luftfeuchtigkeit ist nicht besonders hoch (Taupunkttemperaturen unter 12°C). Abgelöst wird die klassisch irgendwann durch ein atlantisches Tief: Da wird es dann in der Zeit davor eine kurze Zeit schwül - und dann kommt der abkühlende Regen. Dann gibt es auch genug Niederschlag für die Böden. Für die Gebäude bedeuten diese klassischen Wetterbedingungen: Wenn diese vernünftig verschattet werden können189) , heizen sie sich tagsüber nur wenig auf. Selbstverständlich werden die Fenster geschlossen, wenn es draußen richtig heiß ist. In der Nacht dann - mit der durch die Abstrahlung ausgekühlten Luft - kann die tagsüber zu viel zugeführte Energie abgelüftet werden. So sind wir es seit Generationen gewohnt. So funktioniert es derzeit auch (wieder) in unserem Passivhaus: Da sogar noch besser, denn die nicht-transparenten Bauteile leiten nur sehr wenig der Wärme aus der sonnenbestrahlten Oberfläche in den Raum, die Erwärmung am Tag ist daher noch geringer - natürlich nur, wenn auch hier die Verschattung der Fenster konsequent gehandhabt wird. Zur Vollständigkeit die Zahlen für heute Vormittag: Die Raumtemperaturen liegen nun zwischen 21°C und 23°C. Die Gebäude-Kerntemperatur ist schon wieder auf rund 22,5°C angekommen - die Wärmekapazität damit so weit entladen, dass auch ein paar besonders heiße oder schwüle Tage wieder abgefangen werden können. Eine aktive Kühlung bedarf es da nicht - und das bleibt dann auch erst einmal so (Der Stromverbrauch für Kühlung beträgt wieder 0,0 kWh). Mit dem jetzt bereits unvermeidbar (weil gebuchten) Teil des Klimawandel werden nun die Zahl der Tage mit auch in der Nacht heißen Bedingungen leider zunehmen - und es können auch mehr solcher Tage 'am Stück' werden. Das sind die Zeiten, in denen die Presse dann wieder schreibt „Deutschland leidet unter der Hitze“. Wie damit vernünftig umgegangen werden kann, das haben wir hier und in den Tipps (Hitzebelastung reduzieren) zusammengestellt. Mit dem, was jetzt unvermeidbar kommt, können wir also immer noch umgehen.
Anpassungen: Ja bitte! Aber: Das allein reicht nicht. 8 Tonnen CO2 pro Kopf sind viel zu viel!
Hier muss ich darauf hinweisen, dass die Anpassungsmaßnahmen versagen, wenn weiterhin im derzeit überzogenen Maß CO2 in die Atmosphäre abgegeben wird190) . Reduzieren wir die Verbrennung fossiler Rohstoffe nicht zügig, dann werden sich die Klimabedingungen in weit höherem Ausmaß verändern - und zwar in Richtung verschärfter Extreme, so, wie wir es andeutungsweise auch jetzt schon manchmal erfahren können: Es regnet viel seltener, dann aber in gewaltigen Mengen - oder die Niederschläge kommen als Hagel mit immer mehr zunehmenden Korndurchmessern. Lokale Extremereignisse nehmen zu, z.B. Tornados. Solche Bedingungen erschweren die Möglichkeiten, die Veränderungen abzufangen, zusätzlich. Bedeutender aber ist, dass Kipppunkte des Klimasystems erreicht werden können. Die damit einsetzenden verstärkenden Rückkopplungsschleifen können zu einem Teufelskreis werden, auf den wir nicht mehr mit Anpassung reagieren können; abgesehen davon, dass die noch möglichen Anpassungsmaßnahmen dann immer teurer werden; und gegebenenfalls bei lokalen Extremwettern gar nicht viel nutzen, wenn es dann auch keinen Strom gibt. Das sind die Gründe, warum wir den Ursachen dieser Entwicklungen entgegen treten müssen: Das nochmals wiederholt, die Ursachen liegen weit überwiegend in der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe. Rund 8 Tonnen davon setzen wir derzeit in Deutschland jährlich frei - pro Kopf. Das sind gewaltige Mengen - um einen annähernden Vergleich zu bekommen: Weltweit werden etwa 0,38 Tonnen Getreide pro Kopf geerntet, das ist der nachwachsende Rohstoff mit der größten Gesamtmasse; Zement, der 'meistverwendete Werkstoff', wird weltweit im Schnitt derzeit mit knapp 0,5 Tonnen pro Person produziert191) . Die CO2-Emissionen durch Verbrennung haben die mehr als 16fache „Tonnage“ - das zeigt die Größenordnung der Aufgabe, vor der wir hier stehen. Die Passipedia-Seiten befassen sich vor allem damit, wie diese Aufgabe in der Praxis gelöst werden kann - nämlich durch Energie-Effizienz und durch Umsteigen auf erneuerbare Energiequellen. Das geht, es kann sogar klug angegangen werden und dann die Gesamtkosten kaum erhöhen oder sogar reduzieren192) . Werden diese notwendigen Schritte weiter versäumt, dann kommt die Rechnung später, und die wird dann kaum zu begleichen sein. Ist die Katastrophe unvermeidbar? Nein, noch können wir verhindern, dass die Entwicklung unerträglich wird. Machen wir nicht sowieso schon genug dafür? Nein, wir machen leider mit großem Abstand zu wenig. Um von 8 Tonnen Emission pro Kopf auf deutlich unter 1 Tonne herunter zu kommen193) , dazu muss wirklich jede Gelegenheit wahrgenommen werden: Und bei jeder Gelegenheit geht es darum, nicht nur 'ein paar Prozent', sondern den weit überwiegenden Teil der mit dieser Aktivität verbundenen CO2-Emission zu vermeiden. Das geht, wie die konkreten Empfehlungen auf Passipedia darlegen. Wieviel Zeit dürfen wir uns dafür nehmen? Eine wichtige Frage - und sie wird oft sehr emotional und kontrovers diskutiert. So, wie wir es bisher in Deutschland anstellen, würde die Umstellung über 100 Jahre dauern und das ist viel zu lang. Das ist auch unnötig zu lang, denn wir lassen so auch die wirklich günstigen Gelegenheiten aus, die Dinge nachhaltig zu verbessern194) . Wenn wir anfangen, alle diese Gelegenheiten wahr zu nehmen195) , dann verkürzt sich der Umstellungszeitraum schon auf rund 30 Jahre196) . Zugleich wird die Umstellung der Energiequellen erfolgen müssen: Da gibt es eine ähnliche durch die Infrastruktur bedingte Dynamik: Die Umstellung im normalen Zyklus erfordert auch da etwa 25 bis 30 Jahre insgesamt. Auch das ist vernünftig umsetzbar, muss aber gewollt werden und konsequent erfolgen. Die ein wenig ermunternde Perspektive: In der Kombination von „Effizienzverbesserung konsequent“ und „Erneuerbare, so schnell es praktikabel geht“ drängen wir die Fossilen in der Hälfte der Zeit zurück197) ; wenn wir dabei immer noch bei den üblichen Zyklen bleiben, geht das innerhalb von rund 15 Jahren. Das wird dann bereits 'Paris'-verträglich. Es spricht jedoch nichts dagegen, es oft auch noch schneller um zu setzen. Und es spricht auch nichts dagegen, einige der maßlosen und unnötigen Verschwendungs-Exzesse zu vermeiden198) .
26. Juni stabiles Sommerwetter
Unter den jetzt vorliegenden Wetterbedingungen, würden diese so anhalten, bleibt es dauerhaft komfortabel im Haus. Zur Vollständigkeit die Zahlen für heute Vormittag: Die Raumtemperaturen liegen zwischen 22,5°C und 23,8°C. Die Gebäude-Kerntemperatur beträgt 23,3°C. Einer aktiven Kühlung bedarf es nicht - und das bleibt dann auch erst einmal so (der Stromverbrauch für Kühlung beträgt wieder 0,0 kWh). Da die Wettervorhersage ab morgen eine spürbare Abkühlung prognostiziert, wird es im Juni höchstwahrscheinlich keinen Bedarf für aktive Kühlung mehr geben. Dann war es nur ein einzelner schwüler Tag in diesem Monat, an dem mit dem Splitgerät die Komfortbedingungen 'nachgebessert' wurden (Vergleiche Blog-Eintrag vom 23. Juni 2023).
1. Juli kühlere Wetterbedingungen und ein Rückblick auf den Juni 2023
Angekündigt ist für heute der Durchzug eines atlantischen Tiefdruckgebietes - und es gibt sogar Hoffnung auf Regen. Die Außentemperaturen liegen seit Tagen dauerhaft in dem Bereich, in dem im Passivhaus ein vollkommen passiver Betrieb möglich ist - keine Heizung199) und auch keine aktive Kühlung. Die Betriebsweise ist jetzt ganz klassisch: Wenn es uns eher „warm“ ist, dann öffnen wir die Fenster ein wenig; sollte uns dann eher „kalt“ werden, dann machen wir die Fenster wieder zu. So liegen die Temperaturen dann unter typischen mitteleuropäischen Sommerbedingungen in Aufenthaltsräumen zwischen 21.8 und 24 °C (mit Ausnahme des „Server-Raums“, der auch mal 25,6 °C erreicht).
Unter Extremwetter-Bedingungen mit heißer, schwüler Luft, die auch in der Nacht nicht mehr unter 20 °C abkühlt, funktioniert diese Sommer-Standard-Betriebsweise nicht, weil auch nachts das Kühlpotential ausbleibt. Bisher sind solche Bedingungen in Mitteleuropa eher selten gewesen - aber, das wird sich wohl mit dem Klimawandel leider ändern. Die zusammenfassenden Diagramme für den Juni 2023 zeigen: Bedingungen ohne nennenswerte Nachtabkühlung hatten wir zwischen dem 19. und dem 22. Juni. Dia Tage bis zum 22. konnten dabei noch durch die hohe thermische Trägheit des Passivhauses sozusagen „durchtunnelt“ werden - nur an einem Tag, am 22. Juni, haben wir das Klimasplitgerät für rund 9 Stunden in Betrieb genommen und dabei insgesamt 3,04 kWhel verbraucht (vgl. Blockeintrag vom 23. Juni). Seitdem ist das aktive Systeme wieder außer Betrieb. Die Erzeugung von elektrischem Strom durch die eigene PV-Anlage lag in diesem Juni bei 453,5 kWh. Die aktive Kühlung hat davon rund 0,7% verbraucht. Im Vergleich dazu verbraucht mein Computer im gleichen Zeitraum etwa 18 kWhel und das ganze Haus ca. 208 kWhel. 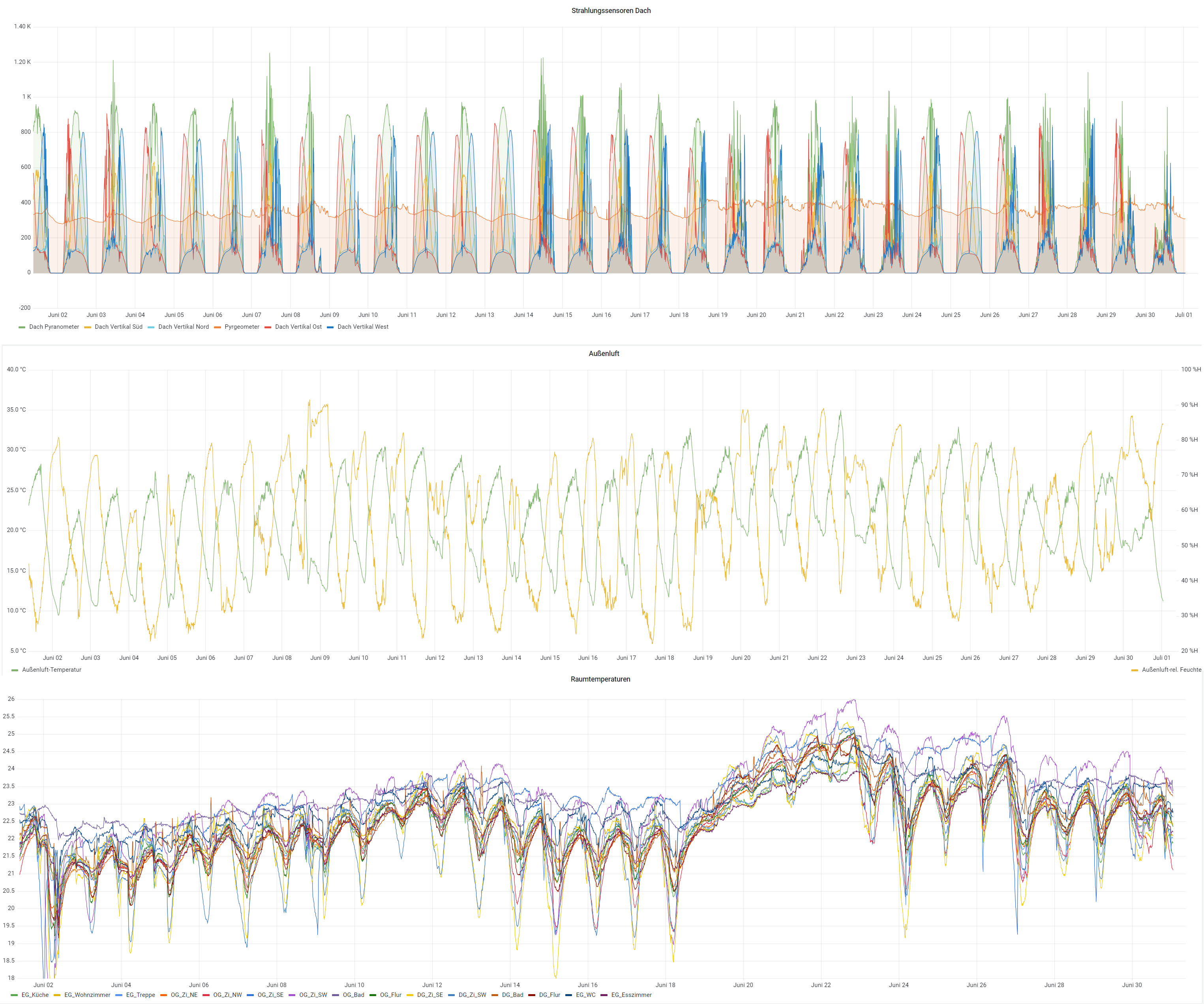 Diagramme: Der Juni 2023 in der Übersicht; ganz oben: solares Strahlungsangebot; Mitte: Außenluftbedingungen; Unten: Verlauf aller Raumtemperaturen. Die aktive Kühlung wurde im Juni nur für 9 h betrieben.
Diagramme: Der Juni 2023 in der Übersicht; ganz oben: solares Strahlungsangebot; Mitte: Außenluftbedingungen; Unten: Verlauf aller Raumtemperaturen. Die aktive Kühlung wurde im Juni nur für 9 h betrieben.
Für die ersten Juli-Wochen sagen die Wettervorhersagen eine anhaltende kühlere Wetterlage voraus. Dann könnte es weiter beim rein passiven Betrieb bleiben. Wie die Messdaten der vergangenen Jahre zeigen, wird im Passivhaus Kranichstein aber selbst bei Extremhitze-Wetter nur wenig Energie für die aktive Kühlung benötigt - im Maximum waren es in einem Sommermonat einmal 45 kWhel 200) . Die sommerliche Kühlung spielt nach diesen Erfahrungen in einem gut gedämmten Passivhaus keine bedeutende Rolle für den Energieverbrauch - selbst, wenn sich die Zahl der Tropennächte künftig stark erhöhen würde. Noch ein anderer Vergleichswert: Der Stromverbrauch für die winterliche Heizung mit der Split-Wärmepumpe lag bisher zwischen 665 und 1072 kWhel; das ist der höchste Einzelverbrauch in diesem Gebäude - obwohl das Passivhaus besonderen Wert auf niedrige Heizwärmelasten201) legt.
Gebäude-Kühlung: kein übermäßiger Strombedarf
Die interessante Erkenntnis: Im Gegensatz zu oft gehörten Ansichten ist selbst in einem Passivhaus in Mitteleuropa der Heizwärmebedarf weitaus202) bedeutsamer als ein evtl. sommerlicher Kühlbedarf, schon allein von der benötigten elektrischen Energie her. Noch entscheidender ist allerdings: Ein evtl. Kühlbedarf tritt immer nur auf, wenn es ohnehin PV-erzeugte Elektrizität im Überschuss gibt. Der Heizenergiebedarf dagegen kann genau dann im Winter maximal sein, wenn deutschlandweit Flaute herrscht und auch die Windenergie nur wenig Strom beiträgt203) - der wenige erzeugte PV-Strom wird dann ohnehin für die sonstigen Anwendungen gebraucht. Heizung ist daher auch künftig und auch in energieeffizienten Gebäuden die kritische Bedarfsgröße; auch deswegen ist es ratsam, den Heizwärmebedarf der Gebäude zu senken - das ist die bei weitem wirtschaftlichste Maßnahme zur Vermeidung hoher winterlicher Lasten. Die Verwendung einer effizienten Wärmepumpe zur Raumkühlung ist daher heute keine 'Klimasünde' mehr204) .
5. Juli Gedanken zur "Geschwindigkeit" von Klimaschutz-Maßnahmen
Insbesondere von vielen besorgten Bürgern hören wir jetzt oft die Befürchtung, dass die Kipppunkte des Klimasystems schon in 2, 3 oder 5 Jahren überschritten werden. Die schlechte Nachricht: Wenn das wirklich so ist, dann können wir das von Europa aus jetzt tatsächlich nicht mehr verhindern.
Ist das denn wirklich so? Niemand weiß gegenwärtig mit Sicherheit, wann genau welche Kipppunkte ereicht werden. Es kann gegenwärtig nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das auch schon in den nächsten Jahren passiert. Das ist aber, soweit ich die Diskussionslage kenne, eher wenig wahrscheinlich (2 bis 8%?)205) . Wir können diese Wahrscheinlichkeit übrigens dadurch reduzieren, in dem wir jetzt wirklich anfangen, weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen206) ; auf „Null“ können wir das Risiko aber schon jetzt nicht mehr reduzieren. Machen wir einfach weiter wie bisher207) , dann wird wegen des dann steigenden CO2-Gehalts der Atmosphäre die Wahrscheinlichkeit in jedem einzelnen Jahr höher - und im Verlauf von ca. 40 Jahren ist das Erreichen von Kipppunkten dann sogar ziemlich sicher. Das ist der Grund, warum „BAU“ überhaupt kein akzeptabler Lösungsansatz ist, weil dieser fast mit Sicherheit zu Kipppunkten führt.
Wahrscheinlicher als ein Kippen schon in den nächsten Jahren ist, dass die Entwicklung des „allmählich im Topf erwärmten Frosches“ so wie bisher weitergeht, wir dadurch zunehmend immer mehr sommerliche Hitzetote, Waldbrände, Extremwetter, Klimaflüchtlinge und Ernteausfälle bekommen und dann in ein bis zwei Jahrzehnten mit den Reparatur-Maßnahmen kaum noch nachkommen können. Das sind die typischen Zusammenbruch-Szenarien, wie sie schon in den Weltmodellen des Club of Rome dargestellt sind. Auch das sind wenig erfreuliche Aussichten - nur mit einem, durchaus wichtigen Unterschied: Das können wir auch jetzt noch verhindern! …und dabei auch das Restrisiko schon früher eintretender Katastrophen verringern.
Es gibt dazu noch ein zweites ebenfalls ernstes Risiko: Das sind Kipppunkte der politischen Lage. Eine große Zahl der Menschen hängen stark am Wohlstands-Steigerungs-Modell; so stark, dass diese dafür sogar zur Aufgabe elementarer demokratischer Grundprinzipien bereit sind. Das begrenzt Geschwindigkeit und Umfang wirklich umfassender Änderungen.
Was kann dann noch getan werden?
- Wie immer im Gefahrenfall: Ruhe bewahren. Durch fehlgeleitete Aggression wird die Situation sehr oft zusätzlich verschlimmert.
- Aufpassen mit der Kommunikation: Wenn für eine große Mehrheit 'Klimaaktivisten' quasi wie Untergangsprediger wirken „Das Ende ist nahe…“, dann wird gar nichts erreicht.
- Immer noch aufpassen mit der Kommunikation: Dass es ein ernstes Problem gibt(…das ernste Problem überhaupt), darf aber nicht verschwiegen werden. Die vernünftige Botschaft: „Wir haben ein bedeutendes Problem, wir sehen das Problem. Wir können das Problem aber immer noch lösen, müssen dazu allerdings einigermaßen vernünftig handeln. Und ein paar Dinge, die wir uns angewöhnt haben, künftig besser machen.“
- Immer noch aufpassen mit der Kommunikation: Die Botschaft, „wir können das jetzt noch ändern“ (und sehr konkret!) ist notwendiger Bestandteil der Kommunikation, sonst bewirkt diese genau das Gegenteil: Nämlich bei der um den Wohlstand besorgten Fraktion Aggression, bei der um das Klima besorgten Fraktion Fatalismus. 208)
- Wie geht es noch?
- Durchaus mit der Verbreitung der Einsicht, dass man auch zu Fuß Brötchen holen kann. Nicht als Forderung209) , sondern als Modell - eben attraktiv machen! Ich persönlich fahre seit 50 Jahren konsequent fast alle regionalen Wege mit dem Rad. Wenn dann mal ein Splitgerät per Taxi abgeholt werden muss, das kommt ja nicht so häufig vor, schlägt das von den Kosten her kaum ins Gewicht.
- Der konsequente Übergang von wenig-effizienten Teilsystemen auf hocheffiziente Systeme bei JEDER sich ergebenden Gelegenheit. Diese Gelegenheiten sind häufiger, als die meisten glauben. Die hocheffizienten Systeme sind verfügbar210) . Die hocheffizienten Systeme sind schon jetzt nicht bedeutend teurer als die jeweils sowieso notwendige konventionelle Erneuerung und sie bringen in aller Regel eine Reduktion von über 50%; für das jeweilige Teilsystem sogar oft deutlich mehr: Elektrische Leichtfahrzeuge über 85% gegenüber dem SUV.
- Der konsequente zügige Ausbau der erneuerbaren Energie- (Strom-) Erzeugung. Auch hier: Bei jeder Gelegenheit211) . Daran müssen wir arbeiten, eben auch wieder: Es positiv kommunizieren und attraktiv machen.
- Die zügige Umstellung der Ernährungsgewohnheiten auf pflanzenbasierter Basis; das geht durchaus auch „Schritt für Schritt“. Interessanterweise passiert da sogar etwas; auch wieder eher zu langsam, aber immerhin. Auch hier ist entscheidend, dass es attraktiv ist. Und, dass der Gemüseanbau für die Landwirtschaft attraktiv wird.
Einiges von den genannten Punkten geht ggfs. notfalls auch „sehr schnell“, sobald die Bereitschaft dafür da ist. Produktions- und Materialengpässe gibt es dabei kaum212) . Hinweis: Es gibt auch Ansätze, die gehen einfach nicht besonders schnell: - Der Aufbau von Kernfusions-Versorgung: bisher noch nicht mal technisch demonstriert (+7 Jahre ultraoptimistisch); Planung einer ernsthaften Demo (+7a); Umsetzung in der Breite (+10a) - Dito mit z.B. Laufwellenreaktoren - die industrielle Produktionsbasis dafür müsste ebenfalls erst aufgebaut werden - Dito mit umfassender Substitution von Erdgas durch Wasserstoff (völlig neue Verteil-Infrastruktur, die bereits allein weitaus teurer ist als das Erdgas-Netz; da gehen maximal 12% des bisherigen Energieflusses als Wasserstoff „durch“; und dann: 2mal soviel WKAs?) - … da spar ich mir ein paar weitere Punkte; alles, was gigantische Infrastruktur-Investitionen verlangt - dauert regelmäßig lang; sogar abgesehen von dem ganzen Beton und Stahl, der dafür immer gebraucht wird.
Konsequenzen bzgl. Heizung und Gebäuden?
- Konsequentes „wenn schon, denn schon…“; z.B. Dacherneuerung NUR noch mit sehr guter Dämmung UND PV - sofern nicht aussichtslos verschattet. Genau dafür jeweils eine Förderung; und zwar NUR, wenn auch wirklich konsequent verbessert wird und NICHT für die Gesamtkosten213) . Das läuft übrigens auf Pauschalbeträge hinaus - z.B. 80 € pro m² Dach, wenn die sachlichen Anforderungen erfüllt sind; und nicht 20% der (dann fast immer) aufgeblasenen Gesamtkosten, die über 1000 €/m² locker erreichen können, wenn da die jeweilige Luxus-Lösung gewählt wird214) .
- „JETZT“-Impulsprogramm für alles das, das auch ganz schnell geht: Z.B. die Kerndämmung (billig, einfach, wirksam, …) oder Balkon-Solar (ausdehnen auf: Bushaltestellen-Dach-Solar, Autobahn-Schallschutzwand-PV, usw. …)
- Durchaus ein Verbot von erneutem Einbau verbrennungsgestützter Zentralheizungen217) ; das war übrigens ein fataler Kommunikationsfehler. Auch, weil offenbar vielfach gar nicht verstanden war, dass überhaupt NUR der Ersatz im Ohnehin-Erneuerungsfall geht218) . Ob das allerdings 2024 oder 2025 oder 2026 kommt - ist tatsächlich nicht spielentscheidend219) . Spielentscheidend ist, dass die verfügbaren Alternativen attraktiv sind. Und - die können weit attraktiver gemacht werden. Hier nochmal unsere klare Analyse dazu: Wir können nur jede:m raten, bei einer Heizungserneuerung nicht mehr auf Kessel zu setzen, die kohlenstoffhaltige Materialien verbrennen. D.h., wir raten jetzt von Kohle220) -, Öl- und Gaskesseln, aber auch von Biomasse-Feuerung ab. Das wird künftig alles sehr teuer werden, weil an einem CO2-Preis kein Weg vorbeigehen wird und ein „erneuerbarer Ersatz“ für die Brennstoffe im notwenigen (gigantischen!) Umfang nicht verfügbar sein wird. Was bleibt dann auf der Positiv-Liste? Ganz vorn die Wärmepumpe, sie erlaubt die Verwendung von Strom, und der wird zu beträchtlichen Teilen aus erneuerbarer Energie kommen. Mit einem gewissen Rest aus „Lückenfüller“-Kraftwerken, das vor allem im Winter. Genau da können221) GUD222) -Kraftwerke eingesetzt werden, deren Abwärme über Wärmenetze verwendet werden kann. Heizwärme aus einem kommunalen Netz ist daher gleichfalls eine von uns empfohlene Lösung. Ergänzung: Die Auswirkungen auf die Struktur der Stromversorgung haben wir hier etwas genauer untersucht: "Die Zunahme der elektrischen Last durch Wärmepumpen". ===== 8. Juli 2023: Wetterprognose sagt heißesten Tag des Jahres für morgen voraus =====
37°C sollen es in Darmstadt werden; heute kletterte das Thermometer bereits auf 34°C. Im Haus wurden - wieder ganz ohne aktive Kühlung - maximal 23,5 °C erreicht, im Westraum („Homeoffice“) des Dachgeschosses223) . Das ist auch wieder dem Umstand zu verdanken, dass es letzte Nacht noch richtig schön auskühlte (14° draußen am frühen Morgen). Das wird nun in der Nacht auf Sonntag anders sein, es gibt nur ein geringes Potential für die nächtliche Fensterlüftung. Noch hat aber der innere Wärmespeicher des Hauses Aufnahmekapazität (jetzt bei um 22,5 °C).
9. Juli 2023: 37°C im Schatten, diesmal lagen die Prognosen korrekt
Gegen 15:00 waren 37°C im Schatten wirklich erreicht. Die Nachttemperatur zuvor ging aber doch noch einmal auf 15°C gegen 6:00 in der Früh zurück. Letzteres bedeutete, dass wir durch Lüften die Kerntemperatur am Morgen unter 22,3°C halten konnten - und unter solchen Bedingungen bleibt das Haus dann auch tagsüber, trotz der Hitze im Außenraum, ordentlich kühl. 24°C habe ich jetzt am Abend im „Homeoffice“ unter dem Dach; bei nur 53% relativer Luftfeuchtigkeit führt das nach den Maßstäben der Komfortnorm auf ein „mittleres vorhersagbares Votum der thermischen Behaglichkeit PMV224) von 0.0 bei der von mir getragenen Kleidung225) . Punktlandung! Besser kann das Innenklima gar nicht sein - ohne aktive Kühlung, am bisher heißesten Tag des Jahres. Nun soll es allerdings eine Tropennacht geben und auch morgen und selbst noch am Dienstag soll es heiß bleiben. Es bleibt also spannend: Vielleicht werde ich das Splitgerät in den nächsten Tagen dann doch irgendwann wieder betreiben. Das Sommer-Muster ist jedoch schon jetzt leicht zu erkennen: Unter den derzeitigen klimatischen Bedingungen in der Oberrheinischen Tiefebene (Darmstadt) ist auch für optimalen thermischen Komfort im Passivhaus eine aktive Kühlung nur ab und zu an wenigen Tagen gefragt. Selbst, wenn wir diese nicht hätten, würden nur wenige Stunden 27 °C überschritten und 28°C nie erreicht. Gibt es ein Klimagerät, dann lassen sich dauerhaft unter 25°C einhalten und dazu ist das Gerät selten im Betrieb, bei jeweils immer noch vernachlässigbarer Leistungsaufnahme. Die 25°C führen auf ein PMV von +0,2 bei gleicher Kleidungswahl und daher immer noch auf Komfortklasse „A“. Zusammengefasst: Üblicherweise lebt es sich beim gegenwärtigen Sommerklima in einem PHPP-geplanten Passivhaus hochkomfortabel auch ohne Klimagerät. Gibt es ein solches, dann können auch noch die wenigen Tage mit über 25 (bis 27°C) „gekappt“ werden; und das mit sehr geringem Aufwand an Energie und Kosten. Energie übrigens, die vollständig aus der eigenen PV-Anlage stammt, wie auch der gesamte Strom tagsüber im Sommer. Es bleiben dann immer noch Überschüsse, die dem Netz zur Verfügung gestellt werden.
Noch eine Bemerkung zur Lüftung
Die Lüftung hier fördert ziemlich genau 100 m³ Frischluft jede Stunde in die Aufenthaltsräume. Damit bleibt die Luftqualität dauerhaft gut, unabhängig davon, ob Fenster geöffnet werden oder nicht (bei drei Personen im Haus). Das bewährt sich auch jetzt im Sommer: Während wir in der Nacht die Fenster auf lassen (mit gewünschtem Kühleffekt) machen wir diese am Morgen in etwa dann zu, wenn die Außentemperatur die Innentemperatur überschreitet. Auf 1 Grad rauf oder runter kommt es dabei nicht an, denn bei so geringen Temperaturdifferenzen sind die Auswirkungen nur gering; es gibt also einen großen Spielraum. Die Zuluft aus der Lüftung erreicht übrigens selbst bei 37°C Außenlufttemperatur nur 26°C. Das liegt daran, dass der Wärmeübertrager der Wärmerückgewinnung in diesem Fall die Hitze der Außenluft auf die austretende Fortluft zurückschaufelt - der Übertrager arbeitet jetzt, volkstümlich ausgedrückt, als „Kälterückgewinnung“.
10. Juli - der erste Tag im Juli und der zweite Tag im Jahr 2023 MIT Kühlbetrieb
Es war eine Tropennacht: Am Standort kühlte es draußen während der Nacht kaum noch aus. Daher war es im Haus trotz Fensterlüftung am Morgen immer noch 24°C, kaum kühler als am Abend davor. Schon richtig: Da muss eigentlich noch nicht unbedingt gekühlt werden. Da ich es aber wirklich lieber kühler mag, wurde jetzt doch tagsüber das Klimagerät im Erdgeschoss betrieben: 2,74 kWh Strom wurden verbraucht - und auch die Temperaturen im Dachgeschoss lagen dann immer unter 25°C. Außen kletterten die Temperaturen dann am Nachmittag auf 31°C. In den 'sozialen Medien' wird jetzt zunehmend über die Hitze geklagt. Ein paar Gedanken dazu:
- In Deutschland waren die Temperaturen bisher keinesfalls bei neuen Rekordwerten - wie 2003 und 2015 sowie 2019.
- In anderen Stellen der Welt überschlagen sich aber die Rekorde: Der Süden der USA mit zuvor nie erreichten Temperaturen, in Peking bis zu 45°C (im Schatten), in Italien ist eine Extremhitzewelle im Anmarsch.
- Das sind Extremereignisse, wie sie in den Berichten des IPCC schon lange prognostiziert wurden. Es ist jetzt wirklich dringend geboten, endlich ernsthaft Klimaschutz umzusetzen.
- Bisher ist das Beobachtete extrem - aber keinesfalls bereits ein Beweis für einen unmittelbar bevorstehenden Kipppunkt, wie ich sehr oft von besorgten Bürgern gefragt wurde. Das Eintreten von Kipppunkten kann auch schon für die nächsten Jahre nicht vollständig ausgeschlossen werden, aber das ist bisher noch unwahrscheinlich.
- Wenn wir aber so weitermachen, wie bisher, dann werden Kippunkte noch in diesem Jahrhundert überschritten.
- Noch können wir das verhindern. Wie, dazu finden sich viele Hinweise auf Passipedia, z.B.: Energieeffizienz JETZT.
- Und nochmal die Hinweise auf praktische Maßnahmen, sich vor der Hitze und ihren Folgen ein wenig besser zu schützen: Das sind Tipps, die in Mitteleuropa fast überall eine gewisse Erleichterung bringen: Hitzebelastung reduzieren. ===== 11. Juli: Noch ein ordentlich heißer Tag =====
Allerdings war die Nacht diesmal hier am Standort richtig schön kühl. Morgens herrschten im Haus dann nach der Nachtlüftung überall um 23 °C, kühl genug, um auch den folgenden sehr heißen Tag komfortabel ohne aktive Kühlung zu meistern. Das Klimagerät blieb daher weiterhin „aus“, trotz bereits 33 °C Außenlufttemperatur im Schatten um die Mittagszeit. Um 16:00 herum kletterte das Außenluftthermometer sogar wieder auf 36 °C. Es wird wieder klar erkennbar: Ob es überhaupt einer aktiven Kühlung bedarf, das hängt vor allem davon ab, ob es in den Nächten noch auskühlt. Reihen sich heiße Tage mit Tropennächten, dann können in der Hitzeperiode passive Maßnahmen allein an ihre Grenzen kommen. Wie das auch schon andernorts seit langem aus der Erfahrung erkennbar ist226) . Übrigens ist das auch bei Gebäuden im Bestand nicht grundsätzlich anders: Ein Unterschied ist nur, dass sich die Serie heißer Tage wegen der kürzeren Zeitkonstanten schneller aufwärmen: Da kann es Vorkommen, dass die Speicherung in der inneren Wärmkapazität schon am Nachmittag des ersten Hitzetages 'aufgebraucht' ist.
Eine Abschweifung: "15 °C"
Diese Diskussion kam gerade in einer Gesprächsrunde hoch engagierter klimabewusster Menschen auf: „Also ich finde 15 °C Raumtemperatur im Winter komfortabel genug. Warum machen wir es künftig nicht überall einfach so?“
Die Frage will ich hier aus möglichst objektiver Sicht227) behandeln. Übrigens denke ich, dass wir genau dies wirklich können: weder müssen wir das aus irgendwelchen Gründen fürchten228) noch ist das die einzige noch verfügbare Lösung, ohne die der Untergang der Welt droht. Rein thermodynamisch und physiologisch ist das technisch 'machbar'229) . Ich werde auch diskutieren, was eine solche „Suffizienz-Maßnahme“ tatsächlich bringt (Spoiler: es sind beim gegenwärtigen durchschnittlichen Zustand der Gebäude rund 50% Heizwärmeeinsparung, wenn das im Durchschnitt „alle“ machen) und warum das, vielleicht für viele überraschend, nicht als von vorn herein „völlig inakzeptabler absurd unsozialer Ansatz“ klassifiziert werden kann. Das wird erkennbar, sobald genau analysiert wird, wie denn ein solches „neues Komfortnormal“ technisch, d.h. kleidungstechnisch, umgesetzt werden könnte. Es wird dann daraus auch erkenntlich, wieso das in den modernen Gesellschaften noch nicht einmal 'theoretisch' diskutiert werden „darf“230) . Schließlich gehe ich dann darauf ein, wie sich das im Vergleich zu anderen Ansätzen einordnet bzw. wie es mit solchen, zumindest 'ansatzweise', verbunden werden kann.
1. Erstmal die physiologischen Fakten: 15 °C, wie ultrakalt ist das?
Bei der heute üblichen Kleiderordnung (Winter, Innenraum) führen 15°C bei sitzenden Personen auf mittlere Komfortbewertung „cool“(minus 2,2); das führt dazu, dass sich über 85% der Personen in einem solchen Raum aktiv beklagen. Das kann ziemlichen Unmut bedeuten und die jeweils Zuständigen sind dann so massiv unter „Druck“, dass zumindest mit allen zugänglichen Mittel versucht wird, nachzuheizen. Fanger hatte das mal so formuliert: „Darüber kann theoretisch lang diskutiert werden. Die betroffenen Menschen interessiert diese Diskussion aber gar nicht. Die beschweren sich eben - und die sind sich dann auch in großer Mehrheit einig, dass es „hier viel zu kalt“ ist.“ Die folgenden Abschnitte diskutieren das etwas differenzierter: Dabei sollten wir aber immer bedenken, dass die gegenwärtige Kleiderordnung so ist, wie sie ist - und bewusst verändert werden müsste. Darüber redet derzeit niemand groß öffentlich; und das hat, wie die meisten genau wissen, gute Gründe.
2. Die Messung und Bewertung des Behaglichkeitsempfindens ist eine gut etablierte Wissenschaft: Interessanterweise sehr gut gesichert und mit wissenschaftlichem Konsens; Stichwort: Ole Fanger
Die Grundlagen zur Bewertung der thermischen Behaglichkeit wurden in dem Werk von Ole Fanger „Thermischer Komfort“ in genialer Weise geklärt. Fanger stellte dort die allgemein anerkannte „Behaglichkeitsgleichung“ auf, die auch heute die Basis der international eingeführten Norm ISO 7730 ist. Wir erklären diese Zusammenhänge ausführlich an anderem Ort: Komfortbänder für die Behaglichkeit. Es lohnt sich, sich für das Verständnis dieser Zusammenhänge die Zeit zu nehmen, das zu studieren. Denn: Ole Fanger hat nicht nur die subjektiven Maßstäbe quantifizierbar gemacht, er hat sogar ein gutes Modell dazu bereitgestellt, von dem aus die Phänomene verständlich werden; und sogar quantifiziert, wie groß die Zahl derer sein wird, denen ein Innenraumklima nicht akzeptabel erscheinen wird.
Eine interessante weitere Bemerkung dazu: Fangers Werk hat eine internationale Forschungsanstrengung ausgelöst; vor allem, weil an vielen Orten Forscher ursprünglich ganz andere 'Vorstellungen' hatten und ihnen die Ergebnisse von Fanger nicht wirklich gefallen haben. Sie haben die ausgeführten Bewertungstests daher in ihren Ländern besonders kritisch und sorgfältig überprüft: Und sie kamen (alle!) zu mit Fanger übereinstimmenden Ergebnissen; unabhängig von Hautfarbe, Nation, Geschlecht, Alter und sozialem Stand der Personen. Das wiederum wird auch heute noch viele überraschen - es wird aber sofort klar, sobald wir uns nur ernsthaft um ein Verständnis bemühen231) .
3. Behaglichkeit und Kleidung: Überraschung! Doch, da geht was
Der Zusammenhang ist mit etwas Nachdenken leicht unmittelbar erkennbar: Das Temperatur-Behaglichkeits-Niveau hängt ganz entscheidend von der Kleidung ab, übrigens auch von der körperlichen Aktivität. Das ergibt sich unbestritten aus den sorgfältig durchgeführten Untersuchungen in der Forschung. Der Zusammenhang kann sogar gut quantifiziert werden: Die Kleidung wird dabei nach ihrem Wärmedurchgangswiderstand klassifiziert, die moderne Einheit dafür ist „m²K/W“, das ist gerade der Kehrwert des Wärmeduchgangskoeffizienten der Kleidung232) . Fanger hatte dafür eine eigene, „anschauliche“ neue Maßeinheit eingeführt, die er '1 cloth' nannte und die der (damaligen) üblichen durchschnittlichen Winterkleidungsordnung in seinem Bundesstaat entsprach (da gehörte dann im Winter durchaus eine „Jacke“ dazu). Zweifelsohne kann eine Gesellschaft sich über Kleiderordnungen einigen, die weit besser warmhalten. In irgendeiner Form objektiv nachteilig ist das zunächst einmal lange nicht: Gut, eine 10 cm aufgeplusterte Polarausrüstung, das wäre dann schon fraglich, ob ich damit am PC noch vernünftig arbeiten kann - irgendwann würde das zumindest 'umständlich' werden. Wollen wir erst einmal nüchtern nachkalkulieren, welche „Kleiderordnung“ es für 15°C-Winter-Raumtemperatur denn benötigen würde. Dazu nutzen wir ISO 7730233) , um die angepasste Kleidung zu 15 °C zu bestimmen. Es sind dazu noch zwei weitere Eingaben erforderlich: Die Differenz von Strahlungs-und Lufttemperatur und die Aktivität der Person. Für die Temperaturen nehmen wir erstmal der Einfachheit halber an, dass Strahlung und Luft im Gleichgewicht und annähernd gleich sind234) . Für die Aktivität nehmen wir den Fall „sitzende Tätigkeit“ an, weil das zumindest ein häufig vorkommender Fall ist. Bei 15 °C liefert die Komfortgleichung dann einen Bekleidungs-Wärmedurchgangswiderstand von 1,85 cloth235) . „1,85 cloth“, was bedeutet das denn in der Praxis? Gegenüber den heute 'üblichen' Werten im Winter (so 0.8 bis 1,1 cloth) ist das gut „doppelt so dick“ gekleidet, konkret einmal illustriert durch eine Beispiel-Tracht:
„Lange Unterhose, langärmeliges Unterhemd, „warmes“ (Flanell-)Hemd, Flanell-Hose, dicker Pullover, Jacke, Handschuhe (!).“
Führen wir uns das vor Augen, wird sofort klar: Zunächst, wieso die 15°C schon „gehen“, da werden nämlich fast alles sagen: Ja klar doch, so geht das schon. Etwas zynisch überzogen ist der Kommentar dann: „Dann sitzen wir im langen Wintermantel im Wohnzimmer“. Es ist ja eben auch aus der ganz persönlichen Erfahrung bekannt, dass wir uns durch „dicke Kleidung“ auch an sehr kalte Bedingungen anpassen können. Und genau darum geht es dann: Diese als extrem empfundene „neue Kleiderordnung“ wird nach Jahrzehnten anderer Handhabung als Zumutung verstanden. Das ist die weit überwiegende Bewertung der Menschen dazu - und dabei dürfen wir uns nicht selbst täuschen, die meisten von denen, die es als Zumutung empfinden, sind dabei keinesfalls extreme so genannte 'Querdenker' - sondern überwiegend sehr gutmütig, aber rundum verstimmt über diese Art 'Lösung'. Den weniger gutmütigen Anteil in der Gesellschaft gibt es auch, und wie wir heute sehen, ist der sogar gar nicht ganz klein: Dieser Teil wird diese 'Zumutung' lautstark und aggressiv kommunizieren - und dadurch auch bei vielen weiteren Personen236) punkten. Das ist eine Gefahr, die ich sehr konkret erkenne und die ich, wenn immer das vernünftig möglich ist, versuchen würde zu vermeiden. Nun aber auch noch meine ganz persönliche 'Bewertung' eines solchen Ansatzes: Die hoch industrialisierten Gesellschaften haben im Verlauf der letzten ca. 70 Jahre den Wohlstand für den überwiegenden Teil der dort lebenden Menschen enorm erhöht237) . Z.B. ist die pro Person verfügbare Wohnfläche von unter 20 m²/Person vor 1960 auf über 47 m²/Person angestiegen. Diese Flächen sind heute nahezu alle mit komfortabelen Zentralheizungen beheizt - jeweils kein wirklich 'billige Lösung', aber wir konnten uns das nahezu problemlos 'leisten'. Die Wohnungen haben heute kaum noch extrem kalte Einscheibenverglasungen238) und sind auch nicht mit mehrmals geflickten schon von den Urgroßeltern geerbten Möbeln ausgestattet: M.a.W., das Wohlstandsversprechen ist tatsächlich ein einem sehr hohen Maß eingehalten worden. Vor diesem Hintergrund wäre eine derart massive Rücknahme einer Wohlstandskomponenten, wie das Absenken der Raumtemperaturen auf 15°C, ein vollständiger Anachronismus. Er wird es noch mehr, wenn wir erkennen, wie wenig das in Bezug auf die Probleme, die wir heute haben wirklich 'bringt', vgl. den folgenden Abschnitt 3 und vor allem, welcher Alterativen uns zum Komfortverzicht zur Verfügung stehen: Alternativen, die nämlich den Komfort sogar erhöhen und zugleich die durch unreflektiertes materielles Wachstum unbeabsichtigt erzeugten Probleme wirklich lösen.
4. Wie sind die Potentiale durch Absenkung der Raumtemperaturen einzuordnen?
Oben wurde schon ausgewiesen, dass sich für ein heute durchschnittliches Wohngebäude in Deutschland (Gesamtbestand) bei einer Absenkung von rund 22 °C auf die genannten 15°C eine Einsparung von rund 50% des Heizwärmebedarfs ergibt. Das ist tatsächlich eine ganze Menge- und das würde die Emissionen sogar noch stärker senken, weil dann der Deckungsanteil der Erneuerbaren erhöht und kohlenstoffärmere Brennstoffe bevorzugt werden können (Zur Ermittlung dieser Werte siehe hier).
Wie steht es um die praktische Umsetzbarkeit? Oder, anders gefragt, welcher Prozentsatz der Bevölkerung macht da bis zu welcher Konsequenz mit? Das ist seit dem Sommer 2022 in Deutschland keine rein theoretische Frage mehr: Wegen des Fehlens der russischen Gas- und Öllieferungen haben Versorger, Bundesnetzagentur und Bundes- wie Länderregierungen explizit zu „sehr sparsamem Verhalten“ aufgefordert. In dieser drastischen Form gab es das in der Bundesrepublik noch nicht zuvor. Wir haben im Blogbeitrag vom 5.4. dargelegt, dass bei der Heizung der Haushalte und anderen „Kleinverbrauchern“ nun tatsächlich eine Einsparung von rund 15% erreicht wurde - in der Summe aller Einsparungen, da sind z.B. auch das Ausweichen auf Holzöfen oder die Nachdämmung von Rohrleitungen mit dabei. Nehmen wir einmal an, es wäre wirklich überwiegend auf eine Abendsenkung der Raumtemperaturen zurück zu führen. Dann wäre das eine Absenkung um rund 2 Grad; und das wäre tatsächlich eine ziemlich gute „Einsparleistung“239) . Was ich aber auch sehe: Unter den herrschenden Bedingungen davon 'mehr' und das auch dauerhaft zu erwarten, ist unrealistisch. Unter enormem Druck der Verhältnisse wird vielleicht durchaus kurzzeitig mehr erzwungen - aber zu welchem Preis?
5. Geht es denn auch anders?
Es gibt andere Ansätze, die es erlauben, weniger Kohlenstoff für Heizzwecke zu verbrennen und die hohe Potentiale haben:
- Der Bewohner kann z.B. auf Holzofen statt Gasheizung umsteigen; das haben einzelne auch getan. Wir wissen allerdings heute, dass die Umweltbelastung dadurch eher noch steigt. Wichtiger: Die Potentiale an insgesamt verfügbarer Biomasse sind gering und in Deutschland praktisch bereits ausgeschöpft. Der Anteil der Biomasseheizung wird künftig eher zurückgehen müssen240) , vor allem, weil der Einsatz der nur knappen Biomasse-Potentiale für andere Anwendungen Priorität hat.
- Anschluss an Nah- oder Fernwärme: Das empfehlen wir grundsätzlich, wenn ein solches Angebot besteht. Allerdings: Die Wärmeerzeugung für diese Netze wird auf Dauer nicht weiter überwiegend auf Erdgas basieren können, da stehen bedeutende Umstellungen noch aus. Rund 15% Fernwärmeanteil hat Deutschland derzeit; er kann, sehr engagiert angegangen, etwa verdoppelt werden. Das hat somit ein Potential, das ebenfalls etwa in der Größenordnung der im Winter 2022/23 durch Temperaturreduktion erreichten Beiträge liegt. Das Gute an diesem Potential: das kann nachhaltig umgesetzt werden und es kann eine dauerhafte Lösung sein - bei der niemand befürchten muss, irgendwann frieren zu müssen241) . Es 'löst' aber eben nur einen Anteil von 15% des Problems, es ist ein Beitrag, aber nicht der entscheidende.
- Umrüsten auf Wärmepumpen: Das ist im Grundsatz für fast alle der 56% Gas und 18% Ölheizungen in Deutschland möglich. Das geht, im Gegensatz zu manchen 'Vorstellungen', nicht von heute auf morgen, auch nicht für alle innerhalb von z.B. 6 Jahren - weil dazu schon allein die Kapazität des einschlägigen Handwerks nicht entfernt ausreicht 242) ; eine beschleunigte Umrüstrate über die Ohnehin-Ersatzbeschaffung hinaus ist auch nicht sinnvoll, denn einen z.B. 2012 erneuerten Kessel jetzt abzuwracken ist ökologisch nicht empfehlenswert - ökonomisch sowieso nicht. Auch das Umrüsten erfolgt in den überwiegenden Fällen dann, wenn der Kessel sowieso abgängig ist. Genau dann empfehlen wir das ganz dringend: Es wäre wirklich unklug, dann wieder einen fossil betriebenen Kessel einzubauen243) . Eine solche Umstellung reduziert für das betreffende Gebäude die Netto-CO2-Emissionen im Schnitt der nächsten 26 Jahre um etwa 75%. Das ist viel mehr, als jede der schon angesprochenen Maßnahmen, insbesondere rund 5mal so viel, wie durch die 2022/23 erreichte Temperaturabsenkung und sogar mehr, als eine generelle Absenkung auf nur noch 15°C bringen könnte. Damit ist es für uns keine Frage, dass wir diese Umstellung empfehlen. Ein Wehrmutstropfen ist: Die üblicherweise heute noch gewählten praktischen Ausführungen sind oft ziemlich teuer; die finanzielle Förderung ist hier nur ein Teil der Lösung, es muss daran gearbeitet werden, die Lösungen kostengünstiger zu machen, und das geht auch, wir zeigen dafür eine ganze Reihe von Lösungen auf244) .
- Wärmeschutz am Gebäude: Das hat nach von uns ausgewerteten Modernisierungen ein Potential von im Durchschnitt 75%245) und das geht ebenfalls in fast allen bestehenden Gebäuden (Ausnahmen: Denkmäler aber auch Neubauten nach 2002, weil die einfach noch nicht „dran“ sind). Diese Maßnahme bringt ebenfalls erheblich mehr, als selbst eine dramatische Temperaturabsenkung. Der Wärmeschutz geht sogar mit einer Komfortverbesserung einher. Er erleichtert nachfolgend die Umrüstung auf Wärmepumpen erheblich und macht diese oft erst möglich, in jedem Fall weniger aufwändig und kostengünstiger. Wird der Wärmeschutz gut konzipiert und beim richtigen Anlass ausgeführt, dann ist das eine ökonomisch attraktive Lösung. Für ein konkretes Gebäude kann mit der Energieberatungssoftware ENBILschnell geprüft werden, welche Maßnahmen im Einzelfall in Frage kommen und wie stark sie die Energiekosten senken.
Alle hier genannten weiteren Lösungsbeiträge können mit einer „Suffizienz-Maßnahme“ Temperaturabsenkung natürlich auch kombiniert werden. Dabei sind die erzielten prozentualen Einsparungen dann sogar noch höher als bei einer fossilen Brennstoffheizung: Wärmepumpen laufen effizienter bei niedrigeren (Vorlauf-)Temperaturen und bei besserer Dämmung sinkt der Wärmebedarf mit jedem Grad sogar mehr als zuvor. Auch das ist unter "Was können Temperaturreduktionen?"| belegt.
Ein Fazit: Temperaturreduktionen können realistisch vielleicht 15 bis 20% insgesamt zu einer Reduktion beitragen. Sie können allein das Problem nicht lösen. Der letztendliche Übergang zu einer nicht mehr brennstoffbetriebenen Heizung ist alternativlos. Das können Nah/Fernwärmeanschlüsse oder Wärmepumpen sein, in kleinerem Umfang auch ein paar eher exotische Systeme (weniger als 5%). Der Übergang auf Wärmepumpen in der Breite muss aber durch verbesserten Wärmeschutz vorbereitet und unterstützt werden, sonst wird es im Stromnetz insgesamt im Winter eng und auch ein sehr stark forcierter Windkraftausbau kommt da nicht hinterher. Mit schrittweisen Verbesserungen beim Wärmeschutz geht es aber, wobei auch dann Windkraft schneller ausgebaut werden sollte, wie bisher geplant246) . Eine Ergänzung aus dem Jahr 2025: Die Diskussion um das „sparsame Heizen“ ist - nach kaum 3 Jahren - inzwischen so gut wie vergessen. Die Raumtemperaturen werden im Durchschnitt nicht weiter abgesenkt - sie werden wieder angehoben. Das ist ein Beispiel für die Kurzlebigkeit der Themen in der reizüberfluteten Zeit: Reagiert wird kurzfristig auf aktuell hochgespielte Anlässe. Würde wirksam reagiert (eben z.B. durch einen Heizungsaustausch oder eine Wärmedämmung) dann hätte die erzielte Einsparung aber dennoch Bestand: Einige machen dies, wir müssen daran arbeiten, dass es mehr werden.
12. Juli 2023: schwüle Hitze nach einer weiteren Tropennacht
Am Abend des 11. Juli kam dann das lange erhoffte Gewitter mit ein wenig Regen - das hat die Luft aufgeladen mit viel Feuchtigkeit; da es die ganze Nacht bewölkt blieb, konnte es auch nicht besonders auskühlen. Besonders heiß war es tagsüber gar nicht, 24 bis 28°C; aber die Feuchtigkeit hing noch lang in der Luft (rund 66%). Das wirkt sich auch nach innen aus - und da das Haus auch in der Nacht nicht kühler wurde, spielten sich die Raumtemperaturen zwischen 23 und 25 °C ein. Das Klimagerät wurde zwischen 10:10 und 20:00 betrieben, vor allem, um die Luftfeuchtigkeit zu senken; das hat unter den herrschenden Bedingungen einen wohltuenden Einfluss auf das Wohlbefinden; dieser Entfeuchtungsbetrieb hat heute 2,02 kWh elektrische Energie verbraucht - 15% der 13 kWh, die von der PV-Anlage geliefert wurden. Eine Bewertung: Der heutige Kühlbetrieb wäre im Grund nicht notwendig gewesen, weil es am Abend schnell auskühlte und auch die Feuchtigkeit der Außenluft viel geringer wurde; es wären ein paar Stunden mit Temperaturen leicht über 25°C geworden, keinesfalls unbehaglich, aber eben nicht mehr auf Behaglichkeitsklasse A, weil die Luft dazu ein wenig zu feucht war. Die etwa 2 kWh war es mir aber durchaus Wert, dadurch ein 'kühleren Kopf' zu behalten. Erkennbar wird hier eben auch: In einem Gebäude mit hoher Effizienz, mit einer Wärmepumpe und PV-Anlage können sich Nutzer sehr unterschiedlich und flexibel verhalten. Ob sie nur ausgiebig Fenster öffnen, ein Kühlgerät betreiben oder gleich eine 'ausgewachsene Wärmepumpe“, wir können fast sagen: Das alles funktioniert. Weder ist die Umweltbelastung noch sind die Betriebskosten dafür relevant.
13. und 14. Juli
Durchgehend angenehme Temperaturen im Haus - ohne den Betrieb aktiver Systeme.
Endlich: Standort und Termin der nächsten Passivhaustagung stehen fest
von Freitag 5. bis Sonntag 7. April 2024 in Innsbruck
Der „Call for Papers“, heute veröffentlicht, vgl. 27. Internationale Passivhaustagung, der Schwerpunkt der Tagung wird „Sanieren aber richtig!“. Dazu gibt es in Innsbruck eine große Zahl von Beispielen, nicht zuletzt durch die EU-Projekte Synphonia und OutPHit. Es gibt sogar eine Tagungsräumlichkeit, die zertifiziertes #EnePHit-Gebäude ist.
Die Tagung wird vom Passivhaus-Institut in enger Kooperation mit der Universität Innsbruck veranstaltet.
15. Juli 2023: Megahitze in Südeuropa
Beginnen wir mit dem Wetter in Darmstadt: heute liefen mehrere Gewitterzellen durch und es hat tatsächlich einige male geregnet; am frühen Morgen war es sogar 15°C kühl, so dass die Nachlüftung ausgezeichnet funktionierte und tagsüber stieg das Thermometer bis auf 29°C im Schatten. Im Haus war es durchgehend und überall komfortabel, 24 °C wurden nicht überschritten - und das Splitgerät blieb weiter „AUS“.
Aus Südeuropa kommen Nachrichten von einer Megahitze herein: 43°C in Athen heute, sie haben die Akropolis für Besucher gesperrt. Und es soll sogar noch heißer werden. Die Wassertemperaturen im südlichen Mittelmeer liegen mehr als 5°C über dem langjährigen Schnitt im, Juli.
18. Juli 2023: Nun zeigt sich: Im Juli wohl kein weiterer Kühlbedarf im Passivhaus
Zwar waren die Tages-Spitzentemperaturen der letzten Tage mit 26, 27 und 29°C im Schatten am Standort immer noch hoch - aber die Nächte waren ausreichend kühl, mit 17, 12 und 11°C. Unter solchen Bedingungen ist es problemlos möglich, mit Hilfe der Nachtlüftung das Passivhaus durchgehend komfortabel zu halten: Aktive Kühlung ist dann nicht erforderlich. So war es in den vergangenen Tagen: Das Splitgerät blieb konsequent „AUS“. Nach den Wetterprognosen für die Region wird das auch für den Rest des Julis ähnlich bleiben und es würde dann kein weiterer Kühlbedarf mehr anfallen.
19. Juli 2023 ein paar Tropfen Regen
…lange nicht ausreichend, noch nicht einmal, um unseren kleinen Garten mit Himbeersträuchern und ein paar Gewürzen ausreichend zu versorgen - geschweige denn das Grundwasser wieder ein wenig aufzufüllen.
Bis zu 30°C außen stiegen die Temperaturen um 15:00 - das empfinden wir inzwischen bereits als recht gut 'erträglich', in der Nacht ging die Außentemperatur bis auf 14°C zurück. Ideale Sommerbedingungen für ein vernünftig wärmegedämmtes Haus - durch Nachtlüftung lassen sich die Raumtemperaturen zum Start in den Tag auf 19 bis 22 °C herunter kühlen; dann werden es gegen Abend zwischen 22 bis 24 °C - alles im Komfortbereich; eine aktive Kühlung geht dann nicht in Betrieb. In Süditalien ist die Jahrhunderthitze heute wie prognostiziert angekommen; in Cagliari (Sardinien) und in Trapani (Sizilien) kletterte das Thermometer über 40 °C, auch für Italien ungewöhnlich heiß. Wirklich geplagt sind gerade die Bewohner von Phoenix, Arizona: schon den 19. Tag in Folge liegen die Tagestemperaturen bei über 43°C und selbst in der Nacht kühlt es nicht unter 32 °C herunter. Und auch in China hält die aktuelle Rekordhitze an - 29°C lese ich gerade für Beijing ab (da ist es gerade 03:30 tief in der Nacht).
Obwohl alle diese Werte Rekorde für die genannten Standorte sind - derzeit ist das zwar extrem unangenehm, für gesunde Menschen aber noch nicht lebensgefährlich. Allerdings müssen wir damit rechnen, dass die Spitzenwerte künftig noch immer weiter zunehmen - etwa ein weiteres Grad mehr an diesen Standorten ist durch die CO2-Emissionen bereits 'gebucht'. Noch viel mehr wird es werden, wenn wir als Menschheit auch weiterhin wie bisher Kohle, Öl und Gas verbrennen. Es ist jetzt dringend, dass möglichst viele einsehen, dass der Kurs in der Energieversorgung geändert werden muss: Weg von den fossilen Brennstoffen. Dafür sind zwei Maßnahmen zielführend: Die erheblich verbesserte Energienutzung (vgl. Energieeffizienz - das große Ganze) und der rasche Ausbau von erneuerbarer Energie, insbesondere von Windenergie.
22.07.2023 angenehme Sommertage in Darmstadt
Das Wetter hat sich sozusagen an die Prognose gehalten - die letzten Tage waren wechselnd bewölkt, ab und zu gab es sogar einmal ein wenig Regen, die Temperaturen am Standort lagen zwischen minimal 14 °C in der Frühe und maximal 26,5°C am späten Nachmittag. Unter solchen Bedingungen ist ein Passivhaus dauerhaft im „rein passiven Modus“ optimal behaglich; nachts werden die Fenster geöffnet und alle im Tagesverlauf eingesammelte Wärme abgelüftet; da gehen die Temperaturen im Haus dann auf zwischen 19 und 22 °C zurück. Tagsüber nehmen sie langsam zu, energetisch gespeist von den internen Wärmequellen und dem trotz der Jalousien einfallenden passiv solaren Ertrag. Im Maximum werden so innen zwischen 22,5° und 24°C erreicht. Die Erträge der PV-Anlage lagen trotz des nicht immer klaren Himmels zwischen 8,5 und 13,6 kWh/Tag; immer noch mehr (auch am ungünstigsten Tag) als der elektrische Verbrauch im gesamten Haus: Dieses Passivhaus ist daher im Sommer in der Bilanz mehr als autark247) .
Autarkiegrad?
Im Sommer wäre mit der vorhandenen, nicht übermäßig großen PV-Anlage und einer rund 4 kWh Batterie sogar eine strenge vollständige Autarkie leicht erreichbar: Mit dem Überschussstrom am Tag würde die Batterie geladen, der Stromverbrauch in einer Sommernacht lag hier noch nie über 3,3 kWh. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „Autarkie“ ist, dass eine Abhängigkeit von einer externen Versorgung nicht mehr besteht - das wäre hier zwischen Mai und September mit nicht sehr viel Aufwand erreichbar. Allerdings: Für den Winterzeitraum wird es schwieriger, denn da kommen zwei klimabedingte Umstände zusammen: Der PV-Strom 'reicht' von Ende September bis Mitte April noch nicht einmal für den Stromverbrauch im Haushalt (Waschen und Spülen, Kühlschrank, Kochen, Licht, PC u.ä.), geschweige denn für den sehr viel höheren Verbrauch an Antriebsstrom für die Wärmepumpe; hier beziehen wir daher Strom aus dem Netz. Der kann ohne größere Probleme über das vorhandene Netz transportiert werden (die Leistung war niemals höher als 500 Watt, vergleiche den Eintrag am 23. März dieses Jahres) und die benötigte elektrische Energie ist so gering, dass dies ebenfalls mit den schon installierten Windkraftanlagen abgedeckt wäre, zumindest dann, wenn alle Objekte mit Wärmepumpen so gut gedämmt sind wie dieses Gebäude hier. „Autark“ ist ein Passivhaus-Basic oder Passivhaus-plus so allerdings noch nicht.
Häufig fällt für eine solche Situation dann der Begriff „Autarkiegrad“; das ist jedoch eine logisch fragwürdige Bezeichnung, denn, autark ist das Objekt ja gerade eben nicht. Und solange wg. der Winterbedarfswerte Strom noch aus dem Netz bezogen werden muss, hängen die Bewohner weiterhin von der Stromversorgung ab. Ökonomisch kann ein höherer „Selbstversorgungsgrad“248) u.U. kaum noch Vorteile bringen, denn das Netz muss ja weiterhin geregelt, gewartet und abgerechnet werden und diese Kosten bleiben fast in konstanter Höhe erhalten, gleichgültig, wie gering und wie selten da noch elektrische Energie entnommen wird. Solange große lokale saisonale Speicher nicht erheblich kostengünstiger werden, ist dieses Problem nicht aufhebbar: Eine Tesla-Powerwall-Lithium-Batterie mit 9 kWh 'reicht' für gerade etwa einen Tag. Etwa 700 kWh müssten aber zusätzlich im Winter verfügbar sein, damit alle Systeme elektrisch betrieben werden können: Das wären 77 solche Speicher - selbst bei erheblicher Kostenreduktion für Batteriespeicher ist leicht erkennbar, dass das nicht als „Lösung für alle“ funktionieren kann: Der Windstrom wird gebraucht und die jahreszeitliche Speicherung muss mit einer anderen Technologie249) arbeiten. Sinnvoll sind dafür erneuerbar gewonnene Brennstoffe250) . Diese Quellen und Speichertechniken für die Gebäude nutzen zu können setzt allerdings weiterhin ein Stromnetz voraus. In aller Regel werden die meisten Gebäude nicht vollständig autark werden. Im Übrigen vereinfacht dies die Aufgabe der Energiewende sogar: Die elektrische Wärmepumpe funktioniert sowohl mit dem selbsterzeugten Solarstrom (im Sommer zur Kühlung und auch im Frühling für einen Teil der Heizung). Vor allem ist der Stromanschluss aber eine Voraussetzung dafür, den im Sommer unvermeidbar erzeugten Überschussstrom für andere Nutzer verfügbar zu machen. Sollten sogar im gesamten Stromnetz immer noch Überschüsse bestehen, so können diese dann in die Speicher gesteckt werden - vorzugsweise in alle Speicher, die vom Netz aus zugänglich sind; das können auch von Industrieunternehmen betriebene Speicher sein und es können auch thermische Speicher für Wärmeversorgungsnetze sein. Auch wenn das eigene Gebäude z.B. über einen Batteriespeicher verfügt, wäre es sinnvoll, diesen Speicher insbesondere dann zu füllen, wenn im Stromnetz erneuerbare Energie im Überfluss verfügbar ist - und dann zu entladen, wenn das Netz sonst hoch mit CO2-belastete, teure Kondensationskraftwerke benötigen würde. Alle hier genannten Gründe:
- Einfachere Winterlösung mit Windstrombezug
- Einspeisemöglichkeit für den nicht selbst nutzbaren PV-Strom und
- netzdienliche Ausnutzung eines evtl. vorhandenen individuellen Stromspeichers
sprechen für eine Netzanbindung, zumindest für das Stromnetz. Wirklich autarke Lösungen, auch für den Winter, benötigen zusätzlich eine saisonale Speicherung. Technisch möglich ist das, es wurde auch bereits demonstriert - ökonomisch und ökologisch sinnvoller ist es, wenn sich viele Verbraucher über das Netz verbinden; denn, nicht alle haben gleichzeitig das Heißwassergerät an oder die Backröhre - und auch die Angebotsprofile der erneuerbaren Stromerzeugung unterscheiden sich im Zeitverlauf und auch räumlich. Stunden vor Sonnenaufgang kann schon Solarstrom aus Osteuropa verfügbar sein und Portugal kann noch zwei Stunden länger am Abend einspeisen; Windenergie aus der Ägäis, aus Norwegen und Irland weisen nur selten alle zugleich eine extreme Flaute auf. Ein überregionales Netz erleichtert eine erneuerbare Energieversorgung daher in hohem Maß. Wirklich autarke Lösungen sind jedoch nicht unmöglich - und an manchen Standorten sogar vorteilhaft. In diesen Fällen ist das Prinzip „erst isolieren, dann installieren“ ganz besonders wichtig: Denn jede durch hohe Energieeffizienz im Winter eingesparte kWh reduziert die für die saisonale Speicherung benötige Kapazität; und die ist ziemlich teuer, insbesondere, wenn sie individuell für ein einzelnes Gebäude errichtet werden muss.
Am 23.Juli 2023: Wechselhaftes Wetter - einwandfreie rein passive Funktion des Passivhauses
Heute ist es nahezu durchgehend bewölkt - Außen- und Innentemperaturen liegen im Komfortbereich. An Tagen wie dem heutigen sind nahezu alle Gebäude leicht „passiv“ komfortabel zu halten. Unter diesen Randbedingungen braucht es weder eine Heizung noch eine Kühlung.
Keine leichte Kost: Warum die Abschreckung mit Atomwaffen auf Dauer nicht funktionieren kann
Der neue Film „Oppenheimer“ regt gerade zum Nachdenken an. Zur Bedeutung der Atomwaffen wurde immer wieder gesagt: „Die Existenz dieser Waffen wird die Kriegsgefahr von nun an beenden. Aus purer Angst vor der unglaublichen Zerstörung.“ Diese Aussage findet sich auch am Ende eines anderen, hier verlinkten videos.
Trifft das zu? Es gab schon immer skeptische Stimmen – J.R. Oppenheimer war eine von ihnen.
Einmal mit etwas Distanz darüber nachdenken
Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls (und der muss nicht so schwerwiegend sein wie der Brand in Heisenbergs Labor) ist niemals Null. Übrigens: Viele solche beinahe-Katastrophen sind passiert – und wir hatten mehrmals unglaubliches Glück. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer rücksichtsloser Diktator wie Hitler, dem der Verlust droht in einer Mischung von Größenwahn und Paranoia unverantwortlich handelt, ist ebenfalls niemals Null. Solche Personen hat die Welt zu allen Zeiten in der Geschichte gesehen. Deshalb: Die Anhäufung von Atomwaffen durch erbitterte Feinde auf der Ebene nationaler Staaten kann auf lange Sicht nicht die Lösung sein251) . Gibt es eine Lösung? Ja, es gibt sie: Das hatte die Welt bereits am Ende des Zweiten Weltkriegs erkannt. Es sind die Vereinten Nationen252) . Aber wir haben den Überblick verloren und sind nicht weitergekommen, einer solchen Organisation die Instrumente und den Einfluss zu geben, die sie dazu bräuchte. Da sind wir also wieder – mit einer wachsenden Bedrohung unserer Existenz. Einer weiteren solchen Bedrohung, neben und zusätzlich zu der, die wie Jahr für Jahr sozusagen systematisch aufbauen, indem wir immer mehr CO2 in die Erdatmosphäre abgeben. Eine Ergänzung (1.8.2023): Die hier verlinkte NBC-Dokumentation
The decision to drop the bomb (englisch)
enthält Interviews mit vielen der Zeitzeugen des Atomwaffeneinsatzes in Japan am Ende der 2. Weltkrieges. Diese Dokumentation macht die Überlegungen und Motive vieler der Beteiligten transparent. Es waren schwierige Entscheidungen - es gab ganz offensichtlich eine Verquickung vieler sehr unglücklicher Handlungsstränge; auch solcher, die eine Eigendynamik des Krieges253) betreffen. Z.B., in welchem Ausmaß eine vernünftige Entscheidung in Japan, den im Grunde sicher verlorenen Krieg unter Vermeidung vermeidbarer Opfer zu beenden, behindert war. Ganz besonders beachtenswert erscheint mir die Aussage ziemlich gegen Ende des Films (1:21:30): „<es wird> klar, dass wir niemals wieder einen weiteren Krieg haben dürfen. Es gibt keine andere Wahl.“ Die Generation der Menschen, die in der Folge dieser Ereignisse geboren und erzogen wurde, hatte genau diese Worte im Sinn - sie sind logische Konsequenz der unkalkulierbar destruktiven Bedrohung, die von diesen Waffen ausgeht. Interessant ist insbesondere, dass gerade Edward Teller diese Position auch teilte, ja Stolz darauf war, mit der Entwicklung der „Super“ seinen entscheidenden Beitrag dazu geleistet zu haben, dass es keine weiteren Kriege mehr geben durfte/konnte. Wie kaum anders zu erwarten254) , ist diese Überzeugung mit der Zeit erodiert. Zuerst eher in kleineren militärischen Operationen, dann in zwei desaströsen Stellvertreterkriegen in Südostasien, schließlich in konventionellen Invasionen der atomaren Großmächte zur Durchsetzung 'wichtiger Interessen', hat sich das Ausmaß der Kriegsführung unter der „atomaren Schwelle“ Stück für Stück immer weiter erhöht. Es sieht fast so aus, als sei die Welt dabei, auszuprobieren, welches Ausmaß von Krieg denn nun doch wieder 'erlaubt' sein kann, trotz des die Kriege eigentlich verbietenden atomaren Armageddon. Vergessen sind wieder die Aussagen hoher Verantwortlicher „Es herrschte Krieg, der Krieg bringt Tod und Vernichtung. Er verändert das Denken und Handeln, die Wahrheit war schon immer das erste Opfer des Krieges.“ (Ebenfalls im verlinkten Film dokumentiert). Diese Aussagen bilden eine der Voraussetzungen für die z.B. von Teller angenommene Stabilisierung durch die atomaren Rüstung, durch garantierte gegenseitigen Vernichtung255) . Es wird noch deutlicher, dass wir etwas versäumt haben, in den 78 Jahren nach dem Ende des 2. Weltkrieges: Den Aufbau einer Weltfriedensordnung und einer akzeptierten internationalen Instanz, die in der Lage ist, diese Ordnung auch aufrecht zu erhalten. Personen wie Oppenheimer, W. Shurcliff, Russel, Einstein, Szilard und Cyrus S. Eaton haben ungebrochen daran gearbeitet, die Schwere dieser Bedrohung der Menschen durch den Menschen zu begrenzen. Heute ist dies nun noch wichtiger als jemals zuvor - denn, inzwischen scheint zu vielen nicht mehr wirklich bewusst zu sein, mit welchem Feuer wir hier spielen. Aber vielleicht kam der Film zu J.R. Oppenheimer doch gerade noch im richtigen Moment heraus.
31. Juli 2023: Kühlenergieverbrauch für den Juli im Passivhaus: Völlig unbedeutend
Das ist unsere Bilanz zum Betriebsstromverbrauch des Klima-Split-Gerätes im Passivhaus Darmstadt Kranichstein für den Juli 2023: Es wurden insgesamt für die gesamte Wohnung 5,5 kWh elektrische Energie für die aktive Kühlung verbraucht (wohlgemerkt: Das ist NICHT der Wert „pro m²“, sondern der gesamte am Zwischenzähler abgelesen Wert für die gesamten 156 m² Wohnfläche, inklusive des „Standby-Verbrauchs“ des Gerätes). Wir stellen das in der folgenden Tabelle in Relation zu den anderen gemessenen Energieströmen im vergangenen Monat Juli: ^Betriebsstrom Splitgerät für Kühlung ^ Übriger Verbrauch an Strom im Haushalt ^ Erneuerbare Stromerzeugung der PV-Anlage ^
| Strom in kWhel im Monat Juli | 5,5 | 201,8 | 380 |
| Anteil an der PV- Stromerzeugung | 1,4% | 53,1% | 100% |
Nur ein unbedeutender Anteil von 1,4% der PV-Stromerzeugung wurde für die Kühlung eingesetzt; insgesamt war auch in diesem vom Solarangebot her eher untypisch bescheidenen Juli die PV-Stromerzeugung nahezu doppelt so hoch, wie der Eigenverbrauch: Es konnten netto 173 kWh für andere Kunden am Stromnetz bereitgestellt werden.
Dieses Ergebnis ist dem seit 13. Juli durchgehend eher kühlen Sommerwetter am Standdort zu verdanken. Solche Wetterperioden sind im Sommer in Mitteleuropa eigentlich auch immer typisch vorgekommen; sie waren im vergangenen Jahrzehnt seltener und kürzer. Unter diesen Bedingungen muss in einem Passivhaus nicht aktiv gekühlt werden, dieses lässt sich dann ganz einfach durch gelegentliches Öffnen von Fenstern bequem auf Wohlfühltemperatur einstellen.
In den inzwischen sieben Jahren Betrieb des Gerätes lag das Maximum eines monatlichen Stromverbrauchs für die Kühlung im August 2018 bei rund 45 kWhel. Auch das ist jedoch immer noch ein vernachlässigbar geringer Verbrauch, weniger als 1% des gesamten Jahresverbrauchs an allen Energieträgern.
Könnte das im Zuge des Klimawandels durch künftig höhere Außentemperaturen noch mehr werden? Das ist sogar ziemlich sicher so. Das Planungsinstrument „PHPP“erlaubt es sogar, den zukünftig maximalen Wert dafür zu berechnen: es ergeben sich damit unter den ungünstigsten Umständen rund 90 kWhel. Immer noch wäre die vorhandene PV-Anlage alleine mit einem rund 5 kWh Akku-Speicher problemlos in der Lage, diesen Bedarf und alles andere Im Gebäude zu decken.
Wir wiederholen die schon zuvor gezogene Bewertung: Heute und in den kommenden Jahrzehnten, sogar inkl. Klimawandel, ist der Strombedarf auch für eine möglicherweise gesteigerte aktive Kühlung in einem Passivhaus in Mitteleuropa vernachlässigbar gering und dieser kann jederzeit problemlos aus schon heute verfügbarem solaren Überschussstrom gedeckt werden.
Die Lösung 'Passivhaus' mit einer kleinen Wärmepumpe ist also nicht nur geeignet die Gebäude-CO22-Bilanz unter jeden kritischen Wert für das globale Klima zu senken, sondern auch gleichzeitig mögliche Komfortprobleme künftiger heißerer Sommer zu kompensieren, sollte der Klimawandel durch weiter fortgesetzte Unvernunft doch Ausmaße annehmen, die wir uns alle nicht wünschen256) . Die Lösung Passivhaus ist damit für den Anwendungsfall „Wohnen“ nicht nur eine Lösung zur Vermeidung eines unakzeptabel gesteigerten Klimawandels, sondern zugleich auch eine Anpassungslösung für das individuelle Wohnen, sollte der Klimawandel doch bedeutender ausfallen, als bei einer vernünftigen Klimaschutz-Politik257) .
Zwischenruf Klimaschutz: Noch wären die Probleme mit etwas Anstrengung in akzeptabler Weise lösbar. Leider überwiegt gerade der den Eindruck, dass die Umsetzung der Lösungen aber verweigert wird
Frei nach Carl Sagan kann ich feststellen: „Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass Hilfe von irgendwoher anders kommen wird, uns vor uns selbst zu retten.“ Das müssten wir schon selbst tun und dafür ist es jetzt, wie es früher oft ausgedrückt wurde, „allerhöchste Eisenbahn“.
- Die Lösungen sind alle technisch verfügbar; allein, sie werden derzeit nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt (EnerPHit-Sanierungen, Windkraft-Ausbau, elektro-Traktion im Verkehr, Wärmepumpen, weniger Fleisch-fixierte Ernährung, Kreislaufwirtschaft).
- Tatsächlich gibt es (leider!) stattdessen eine massive Desinformationskampagne, die sich jeweils ausdrücklich und massiv gegen die genannten zielführenden Lösungsansätze richtet.
- Ein Teil der Kampagne zielt zugleich auf chaotische Verwirrung, indem zusätzlich Ängste vor einem Kurs weg von der fossilen Energie geschürt werden.
- Es gibt sogar Lösungspfade, die keinen Wohlstandsverlust erzwingen, wozu z.B. Passivhaus und EnerPHit gehören, ebenso wie die Wahl elektrisch betriebener Fahrzeuge.
- Zur Verwirrung tragen außerdem Desinformationskampagnen zu vermeintlichen Scheinlösungen bei: Ein Beispiel ist der erneute Hype zum Thema „Kernfusion“. Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, dass die Kernfusion durchaus in fernerer Zukunft (in 5 Jahrzehnten z.B.) eine wichtige Rolle z.B. für die Möglichkeit einer interstellaren Raumfahrt spielen könnte - dann, wenn es der Menschheit gelingt, einen solchen Zeitraum als noch funktionierende Zivilisation zu überbrücken. Innerhalb dieser 5 Jahrzehnte wird die Kernfusion zu diesem Überbrücken keinen relevanten Beitrag leisten können - dafür kommt ein solcher definitiv zu spät. Ganz im Gegenteil: Wird, wie derzeit, der Kernfusions-Hype primär politisch-taktisch dazu eingesetzt, ernsthafte Ansätze zur Lösung zu behindern oder für 'überflüssig' zur erklären, dann ist dieser, wie auch manch anderer Hype, ein Beitrag zur Verhinderung einer realistischen Lösung.
- Gleichfalls wenig hilfreich sind die sich gerade in letzter Zeit häufenden Doomsday-Szenarien: Sei es, in der Extremform, mit der nicht korrekten Aussage „…dass die Katastrophe bereits heute in vollem Gange wäre“; das stellt nämlich eine vollkommene Verharmlosung dessen dar, was ohne ernsthaftes Handeln bereits in wenigen Jahrzehnten passieren wird. Oder sei es auch in Spielarten von willkürlich gesetzten und dann für 'unabdingbar' erklärten Erwärmungs-Begrenzungs-Zielen, die in ihrer operativen Erreichbarkeit nicht durchdacht und oft vollkommen unrealistisch sind 258) .
Doch, es gibt ein Problem: wir rasen derzeit immer noch beschleunigt in eine globale Katastrophe hinein. Wenn wir so weiter machen wie bisher, dann geht es dabei nicht um die Frage, ob die Generation der Enkel vielleicht etwas weniger vom Wohlstand abbekommt als wir, oder unsere Eltern. Es geht darum, ob die Gesellschaft, in der sie dann leben noch den Namen „Zivilisation“ verdient.
Nein, diese Katastrophe findet keinesfalls jetzt bereits statt: Das wäre eine Verharmlosung dessen, was da auf uns zukommt. Ja, die Vorboten sind sichtbar: Gletscher, die verschwinden, Permafrost-Bergrücken, die einstürzen, Wälder, die abbrennen, Landstriche, die überflutet werden, Hitzewellen, die den menschlichen Organismus überfordern. Jedes einzelne davon ist inzwischen auf der Stufe: In diesem Ausmaß hatten wir das noch nicht. Aber: Alle diese, auch zusammengenommen, sind hoch nicht die unabwendbare und nicht-wieder-rückgängig-machbare Katastrophe. Noch nicht. Die kommt erst noch und niemand kann heute genau sagen, wann: Wahrscheinlich bereits in wenigen Jahrzehnten. Das Fatale dabei ist jedoch: Wenn wir erst dann beginnen, vernünftig zu reagieren, dann wird es allerdings zu spät sein - rollt die Lawine erst einmal, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten.
Nein, es ist heute und jetzt noch längst nicht alles verloren. Wir wissen, wie sich die Emissionen im Verlauf von 15 bis 30 Jahren zügig auf Null senken lassen - das Programm dazu steht schon weiter oben. Das jetzt auch umzusetzen, das allerdings, darf jetzt nicht mehr weiter verzögert werden:
Ceterum censeo: Wir müssen die Kohlenstoffverbrennung jetzt beginnend signifikant reduzieren.
Kollege Lloyd Alter hat heute eine ähnlich Analyse climate-doomism publiziert. Prädikat: Lesenswert!
1. August 2023 Ein ganz normaler Sommer-Regen-Tag. Aber: Klimakatastrophe?
So ein Tag, über den wir uns als Kinder immer geärgert hatten: Für den Sommer zu kühl, eine Regenfront nach der anderen zieht durch, so besonders attraktiv war es dann nicht, ins Freibad zu gehen. Empfinden das viele auch heute noch genau so? Wenn wir einen Blick in die Fernsehkommentare, die Wetterberichte, die sog. „Social Media“ werfen, dann entsteht der Eindruck, dass das so ist. Im Sommer, da lieben wir es, wenn es so richtig sonnig und warm wird - jahrzehntelang sind wir Mitteleuropäer deswegen auch an die Adria zum Baden gefahren, das war der von der Mehrheit vorgezogene Urlaub.
Wir schreiben August 2023. Es hat sich schon etwas gewandelt, zumindest für die allermeisten Menschen in meinem engeren Umfeld, auf die ich das 'wir' im Folgenden beziehe: Zunächst haben wir konkret, sogar direkt in unserem täglichen Leben, auf die eine oder andere Art unter der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre gelitten - eher noch und mehr noch, wir wissen, dass eine solche jahrelang anhaltende Trockenheit Mitteleuropa vor Probleme stellen wird: Die landwirtschaftliche Produktion geht zurück, wird aufwändiger, die entsprechenden Produkte teurer. Der Garten259) muss ständig gewässert werden - und, unsereiner hat dabei sogar ein schlechtes Gewissen, denn, Wasser ist knapp. Die Meldungen zu den Folgen der sinkenden Grundwasserstände kommen dazu. Inzwischen ist es für alle Menschen aus meinem engeren Umfeld klar: Der Regen wird gebraucht, er ist überfällig und ausgesprochen hilfreich. Zumindest rational260) haben wir das inzwischen verstanden. Hier scheiden sich dann aber sehr schnell die Geister: Wie jeder Mathematiklehrer nur zu gut weiß, bedeutet rationale Einsicht eben noch lange nicht eine wirkliche An- und Aufnahme der Erkenntnis und noch viel weniger die Umsetzung dieser Erkenntnis in anwendbare Praxis261) . Zu dem generellen Problem, abstrakt erlerntes Wissen in praktische Anwendung um zu setzen262) , kommt hier sogar noch ein emotionaler Widerstand gegen eine ernsthafte Akzeptanz des rational Gelernten hinzu. Es gibt hierfür sogar einen „Modesprech“: Die Populär-Psychologie spricht von der 'kognitiven Dissonanz'263) .
Die ebenso falsche Reaktion seitens der Menschen, die das Ausmaß der Probleme, ihren Ernst und die katastrophalen Folgen weiter fortgesetzten Nicht-Handelns ein wenig mehr erfasst haben, ist, dass diese jetzt zu immer mehr 'nerv-tötenden' Mitteln greifen, um der (oft als „dumme Masse') gesehenen Menschheit die Dramatik der Lage 'endlich bewusst zu machen'. Ja, ich halte diese Reaktion für grundfalsch, weil sie am Kern der bestehenden Aufgabe gründlich vorbeigeht, und, bei Lichte betrachtet, die Rezeption und die Lösung sogar erschwert; ich werde begründen, warum das so ist:
* Das Problem der Rezeption besteht ja gar nicht darin, dass die Gefährdung durch den Klimawandel nicht ausreichend kommuniziert, z.T. bis in erschreckende Facetten der drohenden Katastrophe ausgemalt wird. Mit diesen Schreckensbildern werden fast alle Menschen nun bereits seit Jahrzehnten konfrontiert264) . Viele haben sich einen Panzer aus Ignoranz zugelegt, den sie bei jeder neuen 'Schreckensbotschaft' nochmals verstärken - sie wollen (und vielleicht sogar 'können') das alles nicht mehr hören: Es brennen Wälder (jetzt wo genau)? Es hagelt Tennisbälle. Welcher Teil Pakistans steht da schon seit Monaten unter Wasser?
- Dieser Panzer der Abwehr, er funktioniert derzeit (noch) wirklich recht gut. Insbesondere, so lange die Ereignisse immer noch im Rahmen von Vorgängen liegen, an denen es auch in der Vergangenheit nicht wirklich gemangelt hat: Waldbrände gab es doch auch früher schon, ebenso wie ein paar trockene Jahre265) und auch Überflutungen, Stürme, Bergrutsche gab es früher doch auch. Dass diese Ereignisse objektiv betrachtet häufiger werden und auch heute schon in ihrer Schwere zunehmen, ist zwar wieder rational richtig - prallt aber als eben auch nur intellektuelle Erkenntnis vollends am ausgebildeten Panzer ab.
- Wenn nun die aktuellen Extremereignisse zunehmend ständig wiederholt kommuniziert, farbenprächtig ausgemalt und auf die gleiche Ebene wie die tatsächlich anstehende Katastrophe gehoben werden - dann wird dieses „Getöse“ tatsächlich im wesentlichen vor allem den Abwehrpanzer trainieren und so sogar noch verstärken.
- Noch verheerender ist, wenn durch überzogene Protestaktionen der etablierten Ignoranz auch noch eine personifizierte Zielscheibe für den ganzen Frust der kognitiven Dissonanz dargeboten wird: Der Aktivist, der einen daran hindert, das Kind rechtzeitig aus der Krippe abzuholen - er bietet sich ja wirklich geradezu an, Zielscheibe der Aggression zu werden. Der Aktivist ist kein Ergebnis des Klimawandels - er stört in diesem Moment aber 'unendlich' viel mehr, als der Klimawandel. Dass er Schilder bei sich trägt, welche auf den Klimawandel hinweisen, das spricht (in diesem Zustand der kognitiven Dissonanz) für den betroffenen Autofahrer dann sogar ganz direkt gegen die Ernsthaftigkeit des objektiv bestehenden Problems. Grunderklärungsmuster hier: „Religiöse Sekten, die den nahenden Weltuntergang gepredigt haben, gab es doch auch schon immer. Auch, dass diese 'Einkehr und tut Buße“ gefordert haben. Dagegen hilft nur ein schon lange eingeübtes Verhalten: 'Am besten ist, man hört nicht hin.' Geht schwerer, wenn die/der jetzt vor mir auf der Straße sitzt - Folgerung: „Wie kommen die denn dazu? Alles was Recht ist, das geht jetzt aber definitiv viel zu weit.“
- In unmittelbare Folge diskutiert der Mainstream der Gesellschaft jetzt bereits über Monate über die 'Rechtmäßigkeit' (unbestreitbar, dass die Aktionen geltendes Recht brechen), oder über die „Legitimität“ verschiedenster Aktionsformen (übrigens unbestreitbar, dass nahezu alles, das da die letzten Monate passiert ist, in die Kategorie 'im Grunde ziemlich harmlos' fällt. Harmlos, aber gewaltig nervtötend. Und vor allem: Durchaus an den Grundlagen der emotionalen Seite der kognitiven Dissonanz rüttelnd - was diese aber nicht auflöst, sondern ganz überwiegend sogar verstärkt). Mein Punkt hier: Allein die Tatsache, dass wir jetzt monatelang personifizierte Debatten über die Aktionsformen führen, statt über konstruktive Wege, schadet einer realen Chance, der tatsächlich drohenden Klimakatastrophe266) jetzt wirksam entgegen zu treten.
Eine der weiteren Schwierigkeiten dabei sind die langen Verzögerungsglieder im planetaren Klimasystem: Die Schädigung baut sich Schritt für Schritt zunehmend auf. Emissionen an CO2 erhöhen die Konzentration in der Atmosphäre - und diese bleibt, selbst wenn keine weiteren Emissionen mehr erfolgen würde, noch lange auf erhöhtem Niveau: Der Abbau der Auswirkungen erfolgt erst über viele Jahrzehnte267) .
Diese langen Verzögerungen führen dazu, dass wir heute die Emissionen freisetzen, welche den Klimawandel noch in künftigen Jahrzehnten antreiben. Die dann eintretenden Ereignisse lassen sich dann nicht dadurch 'stoppen', dass wir erst dann beginnen, die Emissionen wirklich zu reduzieren. Das Ausmaß des Klimawandels in den folgenden Jahrzehnten wird von uns eben bereits heute gebucht. Wollen wir uns vor noch intensiveren Hitzewellen, Sturmfluten, Waldbränden in den 30er Jahren schützen, dann müssen wir jetzt die Emissionen reduzieren und müssen jetzt dafür sorgen, dass zwischen heute und 2033 signifikant weniger CO2 emittiert wird, als es bei Fortsetzung des derzeitigen Kurses geschehen würde. Ich merke in den Diskussionen zu diesem Thema übrigens immer wieder, dass ein Verständnis der Wirkung dieser Art Verzögerungsglieder in einem Regelkreis vielen Menschen offensichtlich sehr schwer fällt268) .
Aus der Tatsache, dass die richtig ernsthaften Folgen des Klimawandels höchstwahrscheinlich erst in einigen Jahrzehnten auftreten werden, folgt eben daher gerade nicht, dass wir erst einmal solange warten können, bis ebendiese Folgen eingetreten sind. Es ist klar, dass ein Handeln in Reaktion darauf definitiv viel (sehr viel) zu spät käme. Ein vergleichbares Beispiel dazu: Wenn eine Baufamilie Jahr für Jahr mit Schweröl getränkte Strohballen in den Dachstuhl und um das Haus herum anhäuft - wodurch Jahr für Jahr sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch das Ausmaß eines verheerenden Brandes steigen, dann nützt es im eingetretenen Brandfall wenig269) , wenn dann während dieses Brandfalls die aktuelle und weiterer Einlagerung von Brandlast reduziert oder eingestellt wird.
Ich gebe gerne zu, dass diese Gedanken möglicherweise ebenfalls viele Menschen heute überfordern. In allen Details muss denke ich auch nicht jede:r sämtliche Einzelprozesse im globalen System verstanden haben - ein gewisses Maß an Grundverständnis würde völlig ausreichen. Dieses Grundverständnis muss dazu ausreichen, die Einsicht zu gewinnen, dass es wirklich darauf ankommt, dass wir die Emissionen jetzt beginnend signifikant reduzieren, und zwar so wirkungsvoll, wie das unter Rücksicht auf eine fortgesetzte stabile Funktion der Weltwirtschaft und der Gesellschaften auf dieser Welt überhaupt möglich ist.
Der letzte Punkt ist offensichtlich ein wenig verstandener Zusammenhang bei einigen der als „Klimaschützer“ und „Klimawarner“ engagierten Personen: Die aktuelle Struktur der Weltwirtschaft besteht aus einem System, das nicht selbstverständlich funktioniert - und das nicht abrupt in eine völlig andere Betriebsweise umgestellt werden kann, ohne seine essentielle Funktion zu gefährden. Wie stark die Resilienz dieses Systems tatsächlich ist, das ist Gegenstand vieler politischer Debatten, dazu auch weiter unten. Nur: Dass ein signifikanter Einbruch der Weltwirtschaft zu wirklich schwerwiegenden Problemen führen würde, welche den Fortbestand der Zivilisation gleichfalls gefährden können, ist nicht bestreitbar270) .
Diese Erkenntnis hat eine entscheidende Konsequenz: Die Lösung kann heute nur in einem strukturierten phasenweisem Übergang der nicht-nachhaltigen Strukturen in letztlich nachhaltige Strukturen bestehen. Das ist auch die ursprünglich Kernidee beim sogenannten „European Green Deal“271) . Dass darüber gestritten wird, welche Geschwindigkeit bei diesem Übergang 'gerade noch zuträglich' oder 'unzumutbar und zum ökonomischen Kollaps führend' ist, ist sehr gut verständlich; das ist sogar eine notwendige und hoffentlich fruchtbare Diskussion.
Dann gibt es ein paar weitere Probleme beim Ablauf genau dieser Diskussion: Nämlich einerseits die enorme damit verbundenen Emotionalisierung, andererseits der weit überproportionale Einfluss, den mächtige und reiche Lobbygruppen auf den Verlauf der Diskussion nehmen. Lobbygruppen, die sehr spezielle partikuläre Ziele vertreten; u.a. eben auch eine finanzstarke Macht der fossilen Energielieferanten, deren Interesse, das Auslaufen der fossilen Verbrennung so lange wie möglich zu verzögern ja durchaus verständlich ist. Auch diese Gruppen sitzen natürlich eigentlich mit im gleichen Boot: Dennoch ist vielen von ihnen zunächst einmal das Hemd näher als der Rock; das ist hier ein Problem, und es ist nicht das Einzige. Andere starke Lobbygruppen leben von strukturellen Folgen der fossilen Infrastruktur: Die Zementwirtschaft z.B. vom Bau von Tiefgaragen und Autobahnbrücken. Es ist somit nicht einmal verwunderlich, dass aus einigen bedeutenden Wirtschaftssektoren massiver Widerstand gegen den Transformationsprozess geleistet wird. Wo die Grenze zwischen 'notwendigem Wandel' und 'katastropheninduzierendem Eingriff in das Funktionieren der gesamten Wirtschaftsstruktur“ liegt, ist nicht so ganz einfach zu entscheiden. In der derzeitigen Diskussion überwiegen leider die völligen Überdramatisierungen, und zwar leider auf beiden Seiten der Debatte. Als Beispiel: Eine Jahr-für-Jahr Wiederzurücknahme der im letzten Jahrzehnt massiv erhöhten durchschnittlichen Masse der PKW (Im Zeitraum von eben auch ca. einem Jahrzehnt) muss keinesfalls zum völligen Ruin der deutschen Automobilindustrie führen; zumal dann nicht, wenn dieser Übergang klug mit dem Fortschritt bei Fahrzeugeffizienz und Gebrauchstauglichkeit kombiniert wird. Das wäre nicht ausreichend für eine Lösung des vom Verkehr verursachten Anteils am Klimawandel? Wieso eigentlich nicht, wenn es eben klug kombiniert wird mit der schon erwähnten Verbesserung der Effizienz und mit Veränderungen der Verkehrsstruktur in den Städten (wie das z.B. in Amsterdam oder Paris bereits seit einiger Zeit Praxis ist).
Das eigentlich Schädliche am Verlauf der gegenwärtigen Debatte insbesondere in Deutschland ist aber, dass sie, von außen beobachtet, ein Bild von massiven Konflikten und extremen Störungen bietet. Die Botschaft hier ist ganz klar: So besonders attraktiv kann diese Transformation zur Nachhaltigkeit ja wohl nicht sein, wenn sie mit derart massiven Auseinandersetzungen verbunden ist. Gerade mit dieser Botschaft leisten wir dem Klimaschutz einen Bärendienst: Unser eigener konkreter Beitrag wird mehr als komplett entwertet, wenn er von all denen, die das beobachten, als Weg in die gesellschaftliche Selbstzerstörung wahrgenommen wird. Einmal anders ausgedrückt: Das, was wir in den Jahren von ca. 1999 bis rund 2010 an substantiellem Klimaschutzbeitrag in Deutschland wirklich geleistet haben, das war so schlecht eben nicht. Ja, so etwa ab 2010 haben wir das, und ziemlich bewusst, mehr oder weniger wieder eingestellt und uns zunächst über herbeigeredete angebliche damit verbundene Probleme echauffiert; und später dann über die paar wenigen Aktivisten (z.B. Fridays for Future), die uns vor Augen gehalten haben, dass das „so eben bei weitem noch nicht reicht“. Das Bild, das wir liefern, ist sehr wenig motivierend. Könnten wir das ändern? Ich denke schon! Das ist der Gegenstand der meisten Seiten auf Passipedia, aber ich nehme mir auch vor, es in einem späteren Post noch einmal konkret dar zu legen.
—
Der obenstehende Text war wohl provokativ genug, dass sich darauf in den 'social media' eine Debatte ergab. Offene Debatten bringen zusätzliche Erkenntnisse. Gar nicht selten ändern sie sogar die Sicht auf ein Situation oder eine Handlungsalternative. Um die Debatte nicht zu erschweren, werde ich an den Inhalten und Intentionen dieses Textes vom 1. August nichts mehr ändern (sehr wohl aber weiter gefundene Rechtschreibfehler korrigieren). Notwendige Änderungen oder Ergänzungen werde ich hier folgend darlegen, jeweils mit Bezug auf die Stelle im vorausgehenden Text, damit die Debatte transparent bleibt.
@masterhajoda@mastodon.social Ich bin übrigens vollständig gegenteiliger Meinung. Man muss den Menschen noch viel drastischer vor Augen führen, was sie erwartet. Bisher halten die meisten es offenbar für ein lustiges Spiel. Oder warum glaubst du, dass sie noch immer in ihrem Trott verharren, die Realität verweigern und ihrem persönlichen Gewinnstreben folgen? Sie nehmen es nicht ERNST, weil sie es nicht VERSTANDEN haben! #klimakatastrophe
WF: Danke für den Widerspruch! Wir sehen das ganz offensichtlich etwas anders. Aber 'anders' anders, als Du es darstellst: JA, die große Mehrheit sieht es derzeit wohl als belletristische Unterhaltung. Dieser Kreis ist noch größer, als Du denkst. Und JA, sie haben es nicht wirklich verstanden. Weltuntergangsfilme gab es viele. Blockbuster meist, das ist Topp-Unterhaltung. Und es ist klar: Es ist doch alles nur „Fiktion“. Nichts anderes wird mit der Katastrophen-Inflation erreicht.
@masterhajoda Das ist ja das leidige Problem bei all den Katastrophenfilmen. Da denkt dann der Zuschauer, ah so geht Katastrophe! Es macht dann einmal Wusch und danach ist Weltuntergang. Aber davon ist in der allgemeinen Lebenswirklichkeit natürlich nichts zu sehen. Der Prozess läuft für die menschliche Wahrnehmung zu langsam ab - im geologischen Maßstab allerdings in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wie ihn der Planet noch zuvor erlebt hat. #klimakatastrophe
WF: Diesen letzten Post unterstreiche ich doppelt. Das sehen wir gleich. Insbesondere der letzte Abschnitt: Zig Millionen Jahre hat es gedauert, dass Pflanzen den Kohlenstoff aus der Atmosphäre geholt und in Biomasse umgewandelt haben; deren Reste wir jetzt fördern und verbrennen, d.h. in die Atmosphäre zurückbringen. Einziges „Problem“ bei diesem 'Recycling': wir machen das in ein paar Jahrzehnten, aus geologischer und Evolutionssicht: in Bruchteilen eines Augenblicks.
Jim Skea (der neue Klimarat-Chef) führte unlängst ein Interview (der Spiegel), in dem ähnliche Überlegungen aufscheinen: „If you constantly communicate the message that we are all doomed to extinction, then that paralyzes people and prevents them from taking the necessary steps to get a grip on climate change,“ he said. „The world won't end if it warms by more than 1.5 degrees,“ Skea told Der Spiegel. „It will however be a more dangerous world.“
WF, kommentiert: Es ist sogar so, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Weltuntergang bei über 1.5°C zunimmt; eine Wahrscheinlichkeit, die ohnehin noch nie 'Null' war und derzeit vor allem durch Kriege und durch die pure Existenz von Atomwaffen nach Einschätzung derer, die davon wirklich etwas verstehen, spürbar erhöht ist. Vermutlich geht die größte Gefahr derzeit tatsächlich vom Verbrennen von übermäßig (weit übermäßig) viel Kohlenstoff aus. Weshalb wir das dringend und signifikant verringern müssen: Jetzt, und nicht erst in einem Jahrzehnt. Das sollten wir so engagiert voranbringen, wie irgend möglich - ohne dabei freilich z.B. die Krankenversorgung oder die Welternährung zu gefährden, denn das könnte beides jeweils auch 'zum Ende der Welt' führen, dies vielleicht sogar noch schneller.
Der wirklich bedeutendste Kommunikationsfehler heute besteht darin, dass immer so getan wird, als müssten die Menschen unter signifikanten Maßnahmen des Klimaschutzes leiden. Unter vielen der wirklich wirksamen Maßnahmen wird niemand leiden - außer vielleicht einige ganz bornierte und unflexible Profiteure der fossilen Industriesparte; noch nicht einmal die, wenn sie aktiv produktiv am Transformationsprozess teilhaben.
7. August 2023. Heute vor 78 Jahren...
…wurde demonstriert, dass die Menschheit nun in der Lage war, die Zivilisation in wenigen Stunden zu beenden.
Im verlinkten Artikel wird die menschliche Tragödie des Atomwaffengebrauchs in Zahlen gefasst.
Nachdem so die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs demonstriert war, waren sich fast alle auf der Erde darüber einig, dass es wichtig sei, Kriege in der Zukunft zu vermeiden. Das war eines der Ziele der neu gegründeten UN. Das Ziel war, militärische Konflikte schon im Vorfeld durch diplomatische Anstrengungen zu vermeiden.
Von dem Weg dahin sind wir im Jahr 2023 weit abgekommen. Es gibt einen Grund, warum die Uhr auf „90 Sekunden vor Mitternacht“ steht. Das "Bulletin of the atomic scientists" befasst sich aber nicht allein mit diesem offensichtlichen Mechanismus der Gefährdung der Menschheit durch sich selbst: Auch die anstehenden massiven klimatischen Veränderungen, die wir durch die fortgesetzte weit übermäßige Emission von Kohlendioxid in die Atmosphäre auslösen, ist dort ein systematisch begutachtetes Thema. Und auch dies geht in die durch die Uhr symbolisierte Lagebewertung ein.
Werden sich in Zukunft kühlere Köpfe durchsetzen? Es scheint dringend notwendig…
Apropos 'kühle Köpfe': Die letzten Tage in Darmstadt (Außenklima) waren eher kühl und regnerisch. Im Sommer ist das eine Wetterlage, mit der energieeffiziente Gebäude perfekt klarkommen: In einem Passivhaus oder einem EnerPHit-sanierten Wohngebäude muss unter solchen Bedingungen im Sommer weder aktiv gekühlt, noch aktiv geheizt werden. Da stellen sich die Temperaturen innen nahezu 'von selbst' in einem optimalen Komfortbereich ein; sollte es jemandem dann einmal eher „warm“ sein, wird das durch Kippen (oder auch kurzes Öffnen) von Fenstern schnell korrigiert, viel schneller als ein aktives System das kann. Sollte es mit offenen Fenstern dann eher „etwas kühl“ werden, dann werden die Fenster eben konsequent geschlossen. Weil dann trotzdem immer ausreichend frische Luft genau dort, wo sie gebraucht wird, durch die Lüftungsanlage bereitgestellt wird, können die Fenster bei ungünstigen Außenbedingungen (z.B. zu kalt, zu heiß, zu stürmisch) immer auch problemlos dauerhaft geschlossen bleiben. Durch die Wärmerückgewinnung ist dann der Einfluss der Frischluftzufuhr auf die thermischen Innenraum-Bedingungen extrem gering, praktisch nicht wahrnehmbar. Das ist u.a. der Grund, warum es in 32 Jahren Betrieb des Passivhauses zwischen Mitte März und Mitte Oktober noch nie zu einem Bedarf für einen Betrieb einer aktiven Beheizung gekommen ist.
16. August 2023. Schwüles Sommerwetter
Die über Spanien einströmenden Luftmassen sind warm, sie sind nicht übermäßig heiß, wenn sie bei uns ankommen - aber eben besonders feucht. Da hat eine Reihe von Folgen: Zum einen gibt es dann durchaus auch etwas Regen von Zeit zu Zeit. Vor allem aber wird die Luft als „schwül“ empfunden, bei rund 28°C Außenlufttemperatur und 66,3% relativer Feuchte ist das nicht verwunderlich272) . Auch in den Wohnräumen steigt unter diesen Bedingungen der Feuchtegehalt an: Das wird ein wenig abgepuffert durch die kapillare Feuchteaufnahme an Oberflächen; es gibt ja jede Menge Bücher, sonstiges Papier, Stoffe und mineralische Materialien in den Räumen - allerdings kommt natürlich der in der Wohnung freigesetzte Wasserdampf noch dazu. Im Ergebnis lag der Feuchtegehalt gestern in der Wohnung tatsächlich etwas unter dem der Außenluft - aber für uns zu hoch, um als angenehm empfunden zu werden. Eine weitere Folge des hohen Wasserdampfgehalts ist die dann auch in der Nacht erhöhte Absorption der Wärmestrahlung in der Luft - Außenoberflächen kühlen dann bei weitem nicht mehr so gut aus, als weitere Folge bleiben unter diesen Umständen eben auch die Nachttemperaturen hoch: In der Nacht zum Montag z.B. dauerhaft über 20°C, wodurch das Potential für eine wirksame Nachtlüftung und nächtliche Auskühlung weitgehend entfällt (sog. 'Tropennacht').
Obwohl alle Bedingungen am gestrigen Tag (und auch heute) durchaus noch in einem gerade noch „tolerierbaren Bereich“ liegen273) , haben wir den Luxus des Klima-Splitgerätes gestern geschätzt: Dieses war von 10:52 MESZ bis 21:22 für die Entfeuchtung der Raumluft im Betrieb und hat dabei 2,35 kWh elektrische Energie verbraucht. Dadurch wurde erreicht, dass die Temperaturen unter 24,5°C begrenzt wurden und der Feuchtegehalt unter 12,5g/kg blieb: Mit angepasster Kleidung ist das dann „A-Klasse“-Komfort274) . Andererseits hat die PV-Anlage gestern 11,1 kWh elektrische Energie erzeugt, immer noch mehr als die Summe aus dem gesamten Haushaltsstromverbrauch inkl. des Klimagerätes.
Die manchmal in diesem Zusammenhang gestellte Frage: Lebensnotwendig war dieses 'Bisschen' Verbesserung im Komfort gestern ganz sicher nicht. Es hat aber meine Lebensqualität durchaus erhöht - und so sogar sicher zu mehr Kreativität geführt. Ist der Energieaufwand für einen solchen Luxus nun noch gerechtfertigt? Wir könnten wie folgt argumentieren: Ohne den Betrieb des Splitgerätes hätte der PV-Strom unserer Anlage in der betreffenden Zeit anderen Nutzern zur Verfügung gestanden - und es gab sogar Strombedarf, der in der betreffenden Zeit eine CO2-Emission von rund 335 g/kWh(Mittelwert gemäß „Agora-Energiewende“) verursacht hat. Durch Nichtbetreiben unseres Splitgerätes hätten wir rund 790 g an CO2-Emissionen mehr einsparen können.
Ich möchte (ohne Umwege über andere mögliche Interpretationen) hier gleich auf die aus meiner Sicht angemessene Bewertung übergehen: Die Lösung, welche jetzt im hier genutzten Gebäude vorliegt, ist mit nicht allzu großem Aufwand für alle Menschen realisierbar - dafür ist sie auch insbesondere nicht etwa „zu teuer“: Sie ist nämlich in Wahrheit kostengünstiger, als die heute in Deutschland durchschnittlich übliche Kombination von Energiebezug, technischer Ausstattung und Gebäudequalität. Wird die hier praktizierte Lösung letztlich für nahezu alle Menschen realisiert275) , dann können sich alle diese Menschen eben diesen Komfort276) leisten277) , und dabei gibt es KEINE relevante Umweltbelastung278) .
Das ist es, was wir als eine „nachhaltige Lösung“ ansehen können - eine Lösung, die sich vollständig aus den natürlichen Energieflüssen (Solarstrahlung) speist, einen Bedarf hat, der für alle Menschen dauerhaft verfügbar ist und dabei keine negativen Umweltfolgen erzeugt. Das Beispiel illustriert auch sehr schön, dass solche Lösungen durchaus ein gewisses Ausmaß an Luxus erlauben - denn selbstverständlich lässt es sich auch unter Bedingungen der Komfortklasse „C“ noch gesund und erträglich leben. Das Beispiel illustriert, warum Menschen vor der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise keine Sorgen um Komfort- oder Wohlstandsverlust haben müssen, denn für nahezu alle Bereiche unseres Lebens ist es ähnlich gestellt wie bei diesem Beispiel. Haben wir erst einmal auf eine nachhaltige Struktur umgestellt, dann ist oft sogar ohne Umweltschaden ein besserer als der heutige Komfort möglich.
Vor einem Fehlschluss muss ich dann aber schon noch warnen: Das beweist keinesfalls, dass jeder heute genossene Luxus in allen Fällen völlig unproblematisch, weil künftig nachhaltig darstellbar, wäre. Denn: Zum einen sind die Erneuerbaren Potentiale letztlich begrenzt, vor allem bzgl. der möglichen Geschwindigkeit für ihren Ausbau. Und zum anderen muss eben dieser Ausbau von Erneuerbarer Energie und energieeffizienter Nutzungsstruktur tatsächlich auch erfolgen, noch ist das erst ganz am Anfang. Und eben gerade darüber wird derzeit in schrillen Tönen gestritten: Von einem Konsens, dass Erneuerbare jetzt tatsächlich so maximal wie vernünftig möglich ausgebaut und dass Energieeffizienz-Potentiale, wo auch immer sie sich anbieten, zügig erschlossen werden sollen, davon scheinen wir momentan immer noch weit entfernt.
Ökonomische Paradigmen
Dieses „…für alle Menschen dauerhaft verfügbar ist…“, das ist ein Lehrsatz nahezu aller heutigen Schulen in der Ökonomie. Allerdings wird das in der Regel ohne die oben mit aufgeführte Einschränkung „…ohne dass dies negative Umweltfolgen hat“ aufgeführt, denn es wird unterstellt, dass Letzteres im Grund praktisch automatisch, ohnehin der Fall ist279) .
Das ist eines der angenommenen Axiome: Eine anhaltende naturgesetzlich bedingte Knappheit an natürlichen Ressourcen gibt es nicht bzw. sie ist so weit, dass diese keine ernsthafte Rolle spielt. Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen haben die Gültigkeit dieses Axioms in Frage gestellt und in immer umfangreicheren Fällen direkt widerlegt. Es steht heute außer Zweifel, dass z.B. die Vorräte an Erdöl, an Kobalt, an der Belastbarkeit der Atmosphäre begrenzt sind und dass wir als Zivilisation in einigen Fällen nahe an den Grenzen operieren bzw. diese sogar höchstwahrscheinlich schon überschritten haben. Diese Tatsache ist allerdings für einige der Schulen in der Ökonomie ganz offensichtlich 'schwer verdaulich'. Wenn nämlich aus der Unbegrenztheit der Ressourcen geschlossen wird, dass es über die Selbstregulierung des Marktes hinaus keinerlei Regelungsbedarf gibt und so die Legitimation demokratischer Strukturen bezweifelt wird, dann stört eine Erkenntnis zu einer objektiven Begrenztheit ganz entscheidend. Das wird selbstverständlich bemerkt - daher fallen die Reaktionen auf Publikationen wie „Die Grenzen des Wachstums“[Meadows 1972], [„Global 2000“] bzw. der Film „An Unconvenient Truth“ [Gore 2006] so heftig aus. Meine These ist, dass die Dissonanz in Bezug auf genau diese Frage die entscheidende Ursache für die zunehmenden ideologischen Grabenkämpfe darstellt.
Wir haben auf den Seiten der Passipedia zahlreiche Bausteine dafür zusammengestellt, mit denen sich diese Dissonanz überwinden lässt. Dafür wäre es momentan noch nicht einmal Voraussetzung, dass die streitenden Seiten („unbegrenzte Ressourcen“ vs. „planetare Grenzen“) sich in Bezug auf genau diese Frage sozusagen für alle Zukunft einigen. Möglicherweise wird sich in ein paar Jahrzehnten herausstellen, dass unter Beachtung gewisser 'lokaler Grenzen' die Ressourcenlage im kosmischen Maßstab tatsächlich 'nahezu unendlich' ist. Allerdings: Dass es immer mal wieder solche lokalen Grenzen gab und diese dann durch Reparatur, Schonung, Substitution oder komplett innovativ anders gearteter Lösungen 'umgangen' werden mussten, genau dem verschließt sich heute kaum ein Ökonom.
Es kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, dass wir heute massiv an eine der Grenzen, nämlich der Verträglichkeit hoher Mengen des Verbrennungsproduktes CO2 mit der Stabilität des Klimas, stoßen. Die massive zusätzliche Emission von CO2 in die Atmosphäre muss weitgehend aufhören - und das muss in wenigen Jahrzehnten gelingen. Es kann sogar in wenigen Jahrzehnten gelingen: Die entscheidenden Instrumente dazu sind ein massiver Ausbau der Erneuerbaren Energie, die konsequente Nutzung brach liegender Energie-Effizienz-Potentiale und die sorgfältige Optimierung einiger Stoffströme (z.B. Metalle aber auch Zement).
In Energieeffizienz JETZT haben wir für wichtige Sektoren konkret dargestellt, wie entsprechende Lösungen aussehen können. Diese Lösungen haben alle eines gemeinsam: Sie reduzieren weder den Wohlstand noch lieb gewordenen Komfort - für das Beispiel Gebäudekühlung haben wir das gerade im Post zum 16. August ausführlich diskutiert.
Nun ist eines schon richtig: Die aufgeführten Vorschläge führen zu teilwiese enormen Verschiebungen in den Umsätzen einiger Wirtschaftssektoren. So ist es z.B. offensichtlich, dass es für die Vermeidung von CO2-Emissionen erheblich weniger Kohle, Öl- und Gasverbrennung geben muss. Es kann auch nicht bestritten werden, dass dies, ganz gleichgültig mit welcher Methode die Vermeidung der Kohlenstoffverbrennung letztlich erreicht wird, immer zu Anpassungsaufgaben280) in den genannten Sektoren führen wird. Dass es solche Verschiebungen, auch solche von hohem Umfang an der Wertschöpfung, immer wieder in der Geschichte gegeben hat und dass diese auch gemeistert wurden, auch daran besteht im Grundsatz kein Zweifel.
Auch im heute vorliegenden Fall ist es möglich, diese Aufgaben zu meistern. Insbesondere die Potentiale für eine effizienter Energienutzung sind dabei ganz besonders hilfreich: Weil dies mit dem geringsten Gesamtaufwand erschlossen werden können, weil sie, in die natürliche Zyklen eingebettet, einen sanften Übergang ermöglichen und weil sie den konkreten Aufbau einer erneuerbaren Energieversorgung erleichtern281) .
Diese Transformation ist möglich - auch wenn sie selbst heute noch von einigen der von fossiler Energie Abhängigen bekämpft wird. Ein solcher Kampf frisst übrigens nur zusätzlich Ressourcen. Wir haben in zahlreichen Beiträgen zu den Passivhaustagungen im übrigen sogar Instrumente für einen konkreten Pfad einer solchen Transformation beschrieben. Ausgetestet wurden diese Instrumente ebenfalls schon; und das sogar mit guten Ergebnissen.
Bei der Umsetzung in die Breite hat die Transformation allerdings seit so etwa 2009 gestockt - das war hier nicht anders, als in anderen Sektoren, besonders betroffen waren die Wind- und die Solarbranche. Das Stocken war von wichtigen Playern gefordert worden und in einem gewissen übergreifenden politischen Konsens durchgesetzt worden - in Deutschland war ein extremer Ausbau der Erdgas-Infrastruktur ein Treiber dieser bremsenden Politik. Wie aktuelle Analysen zeigen, hatte dies jeweils mehr mit sehr speziellen Interessen sehr spezieller „global Player“ zu tun282) . Wie oft in solchen Fragen, haben sich einige dieser Player letztlich sogar selbst am meisten geschadet. Ein konstruktives Zusammenwirken an wirklichen Lösungen der Aufgaben würde spürbar bessere Bedingungen für fast alle der beteiligten Stakeholder ermöglichen. Dass dabei die Kohlenstoffverbrennung schnell und massiv zurückgefahren werden muss, ist allerdings unumgänglich.
Vom 17. bis 19. August 2023: Schwüle Hitze in Deutschland
Um 14:00 schon 30°C im Schatten - bei einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Das sind schwüle Klimabedingungen - und die schlagen, zunächst unvermeidbar, auch auf den Innenraum durch, wenn dort nicht aktiv entfeuchtet wird. Das sind die Bedingungen, unter denen es sich klebrig auf der Haut anfühlt und sich das Papier wellt.
Genau hier leistet das Klima-Split-Gerät nun wirklich sehr gute Dienste: Die Inneneinheit entfeuchtet - und sie entzieht so der Luft in der Wohnung Wasserdampf. Das erfolgt übrigens für die gesamte Wohnung recht zuverlässig, wenn nur die Innertüren offen gehalten werden. 24,6 °C und 61% rel. Feuchtigkeit messe ich gerade in meinem Dachgeschoss-Arbeitszimmer. Das setzt die Taupunkttemperatur um 4 Grad herab - und führt tatsächlich dazu, dass nichts mehr 'klebt' und wir uns pudelwohl fühlen und kreativ sein können.
Das Klima-Splitgerät benötigt für seinen Betrieb Strom. Das sind derzeit etwa 250 Watt, die das Gerät zieht; immer noch weniger, als die PV-Anlage derzeit erzeugt. Auch die Kosten für die Installation dieses Gerätes waren nicht hoch; es begleitet uns jetzt schon 6 Jahre - und es erlaubt, wie weiter oben im Tagebuch beschrieben, auch die Heizung im Winter, die nahezu vollständig mit erneuerbar erzeugtem Strom gelingt283) .
Nachhaltige Lösungen wie hier, nämlich eine gut wärmegedämmte Wohnung mit einem Split-Gerät, sind daher eben nicht nur ökologisch sinnvoll - sie erweisen sich auch als besonders kostengünstig und sie erlauben einen erheblich verbesserten Komfort. Eben auch in solchen Zeiten mit extremen, schwülen, Außenbedingungen.
Wir beschreiben unter 'Splitgerät nachrüsten', wie solche Lösungen praktisch umgesetzt werden können und welche Beträge sie leisten können: Es überrascht sogar, wie viel allein das sogar in einem durchschnittlichen Gebäude im Bestand ausrichten kann. Holt der Eigentümer dann die im Grunde längst überfälligen Wärmschutzmaßnahmen am Gebäude nach, dann wird dieser Beitrag immer größer - am Ende kann er sogar zu einer vollständig nachhaltigen Lösung, auch im Bestandsgebäude, führen. Ein Beispiel für eine konkrete Lösungen, die Schritt für Schritt umgesetzt werden kann, nahezu überall, mit vertretbaren Kosten und vertretbarem Aufwand und vielen weiteren Vorteilen.
Der rauchende Colt? "SMOKING GUN EVIDENCE"
Wenn ein wissenschaftlicher Artikel schon eine solche Überschrift hat - dann ist das ein ernst zu nehmender Hinweis, dass da möglicherweise nicht sonderlich wissenschaftlich sorgfältig gearbeitet wurde. Der eigentliche Hintergrund ist leicht durchschaubar: es geht um sensationelle Aufmachung. Hier soll Aufmerksamkeit erzeugt werden - nicht in allen Fällen beweist das schon, dass die Inhalte alle unseriös sind; gerade ehrgeizige Forscher sind oft wirklich überzeugt, dass sie da auf etwas „ganz besonders Wichtiges“ gestoßen sind - viele Lehrstühle kennen dieses Problem, in solchen Fällen zur 'Mäßigung' zu raten. Wer eine wenig Hintergrund in kritischem Denken hat284) , für eine solche Person ist das schnell einsichtig.
https://youtu.be/XHcTtTB2Iho?t=204
Anton Petrov hat recht: Diese Art von Überschriften haben sich in den letzten Jahren in hohem Ausmaß vermehrt. Die Spitzenmeldungen dieser Art sind z.B. „Wissenschaftler bestätigen einen bedeutenden Durchbruch bei der Kernfusion“ oder „Durchbruch bei der Supraleitung könnte die bedeutendste Entdeckung unseres Lebens sein“. Großartige Ansprüche, die entweder schon unmittelbar danach widerlegt wurden oder solche, die letztendlich zeitnah als falsch erkannt werden. Außerdem: bei dieser „Kernfusions-Meldung“ - das illustriert vor allem, welche Absichten hinter dieser stecken: Wir sprechen hier über eine Waffen-Forschungs-Anstalt, nicht eine Einrichtung, die versucht, saubere Energiequellen zu entwickeln. … Die Sensationssucht285) hat ein neue Ebene von Absurdität erreicht. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es wirklich schwierig wird, noch zu entscheiden: was ist real und was ist es nicht? Viele Wissenschaftskanäle286) sind zu „Vorderladern“(bunkers?) und weniger zu Erklärern der Wissenschaft geworden. Ein paar von und haben das jetzt sogar erkannt und beginnen, all dies in Frage zu stallen. Wenn ich Überschriften wie diese hier sehe 'Rauchender Colt - Beweis für modifizierte Gravitationstheorie von Gaia-Beobachtungen weit entfernter Doppelsterne' macht mich das extrem stutzig (häh?), worüber reden die da überhaupt,… Zumal ich vor wenigen Wochen mehrere Artikel zum gleichen Inhalt gelesen habe, die genau das Gegenteil behauptet haben. … Da stellt sich die Frage: Wie nehmen wir solche Artikel auf und wem sollten wir da grundsätzliche „glauben“? Nun, die offensichtliche Antwort für Wissenschaftler würde hier sein: „Das wird sich in einiger Zeit zeigen.“ Das illustriert, was uns Carl Sagan immer wieder gesagt hat: „Wissenschaft, das ist nicht eine einfache Ansammlung von Wissen, es ist vielmehr eine Art des Denkens“.287)
Für an der speziellen wissenschaftlichen Frage Interessierte lohnt es sich übrigens wirklich, das gesamte Video von Anton Petrov zu verfolgen.
Populistische Verwirrspiele
Ich will hier einen Aspekt dieser Entwicklung noch deutlicher herausarbeiten, den Anton Petrov im übrigen auch andeutet: Die Zwecke, die sehr oft mit den sensationsheischenden „Click-Baits“ verfolgt werden. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass es hier seit gut einem Jahr eine nochmals extreme Steigerung in der Häufigkeit und der Übersteigerung eben solcher 'Meldungen' gegeben hat. Für einige der Sensationsaufmacher ist leicht erkennbar, was sie eigentlich bezwecken: Nämlich, maximale Verwirrung stiften und zugleich das Vertrauen in die Wissenschaft zerstören. Das ist die im politischen Raum so bewährte 'populistische Methode'. Ein Thema so emotionalisieren, dass viele Menschen darauf anbeißen; oft handelt es sich eigentlich um belanglosen Unsinn288) , häufiger aber um massive und beabsichtigte Irreleitung289) . Das ist die erste Kategorie dieser Art Meldungen.
...und haltlose Versprechungen
Es gibt noch eine zweite, und dafür ist der von Petrov zitierte Kernfusions-Artikel ein illustratives Beispiel. Vielen wird das bereits aufgefallen sein: Beginnend Anfang 2022 häufen sich genau solche Artikel mit dem Click-Bait „Durchbruch“; nahezu täglich wird einem ein weiterer dieser Art in die Timeline gespült. Das könnte nun zwei Ursachen haben: Die erste wäre, dass es in diesem Bereich der Wissenschaft gerade wirklich mit „Riesenschritten“ voran geht290) . Die zweite ist, dass das etwas mit der aktuellen Situation der hoch entwickelten Industrienationen zu tun hat: Wir haben, zum einen, durch weltpolitische Ereignisse bedingt, eine sehr hohe Energiepreissteigerung gehabt. Zeitgleich wird auch überdeutlich, dass „wir jetzt die Rechnung für den versäumten Klimaschutz präsentiert bekommen“291) . Würden die Menschen jetzt einen Schritt zurücktreten und die Situation mit ein wenig Abstand versuchen objektiver zu betrachten - dann könnten sie gerade relativ einfach erkennen, dass wir uns in Bezug auf den Energiekonsum und die Energieerzeugung ein wenig verrannt haben, übrigens, eine Erkenntnis, die nicht neu ist292) und die auch nicht ohne vernünftige Lösungsansätze ist293) . Es wäre jetzt wirklich an der Zeit, diese Vorschläge ernst zu nehmen und konsequent um zu setzen294) .
Es ist aber klar, dass eine konsequente Umsetzung dieser Vorschläge vergleichsweise rasch zu signifikanten Reduktionen im Kohle-, Öl- und Gasverbrauch führen würden - genau dafür sind diese Vorschläge doch gemacht. Das wäre, gerade jetzt, mit den weltweit höchsten Verbräuchen an fossilen Energieträgern aller Zeiten, eine sehr bedeutende Veränderung an genau diesen Märkten. Die Menge des emittierten CO2 ist ein Maß dafür: Wir führen der Atmosphäre je Kopf der Weltbevölkerung gerade 4,7 bis 4,9 Tonnen diese Gases zusätzlich zu. Das ist das über 60fache unseres Körpergewichtes, und das in jedem Jahr. Dahinter stehen ebenfalls Tonnen des Verbrauches eben dieser fossiler Energieträger, deren Kohlenstoffgehalt durch Verbrennen in das CO2 übergeführt wird. Diese Tonnen fossiler Energierohstoffe - das ist der bei weitem größte Materialumsatz durch unsere Zivilisation; der größte Umsatz an nachwachsenden Stoffen ist der an Getreide - und der ist mit rund 380 kg/Kopf um gut einen Faktor 10 geringer295) .
Da sind wir dann bei einer spürbaren Reduktion im Verbrauch an Kohle, Öl und Gas. Die stellen jedoch weltweit immer noch über 90% der Primärenergie und ihr Verkauf hat einen beträchtlichen Anteil an den nationalen Bruttosozialprodukten. Die Einnahmen, auch die Gewinne und sogar die Steuern aus diesem Handel haben eine große Bedeutung: Für die Unternehmen, die diesen Handel betreiben - aber auch für andere wichtige Teile der Volkswirtschaften296) . Vor diesem Hintergrund ist es keinesfalls verwunderlich, warum genau diese Entwicklung Alarmstimmung bei wichtigen, reichen und mächtigen Wirtschaftskreisen auslösen. Es ist völlig verständlich, dass diese Sektoren zunächst nahezu alles tun, um den Umstellungsprozess zu verlangsamen297) .
Hier erklärt sich nun dieser zweite Zeil des Energie-Technologie-bezogenen Sensationalismus: Die weit überwiegende Zahl der als besonders „wegweisend“ oder „Durchbruch verheißenden“ populistischen Meldungen betreffen besondere Energietechnologien; wie z.B. die Kernfusion, Wanderwellenreaktoren oder großtechnische Wasserstofferzeugung. Allen diesen Technologien ist gemein, dass sie selbstverständlich hohe Potentiale versprechen - und dass sie dies, zumindest angeblich, auf einer großtechnischen Erzeugerebene tun. Damit sehen diese Meldungen alle so aus, dass sie für den Nutzer der Energiedienstleistungen298) signalisieren: „Da ist Großartiges unterwegs, es gibt keinerlei Grund zum Nachdenken, es kann am Ende alles für Dich genauso - und sogar billiger - weitergehen wie bisher, in kurzer Zeit wird die betreffende Industrie für uns eine perfekt nachhaltige Erzeugerlösung bereitstellen.“ Das ist aber nicht das Einzige, was die gerade besonders herausgestellten Meldungen gemein haben: Die andere Gemeinsamkeit ist, dass alle diese genannten Technologien momentan bestenfalls im Labormaßstab demonstrierte Systeme verwenden; in wichtigen Fällen noch nicht einmal das: Bis heute gibt es keine einzige dauerhaft funktionstüchtige und im System netto-Energie-liefernde Anlage zur Kernfusion. Alle seriösen KollegInnen in diesem Forschungsbereich werden betätigen: Bis die Kernfusion großtechnisch eine relevante Rolle bei der Energieversorgung spielen kann, werden noch mindestens 30 Jahre vergehen. Das sind genau die 30 Jahre, innerhalb derer wir nach dem Stand der Erkenntnisse zum Klimaschutz die Reduktion der Kohlenstoffverbrennung auf „so gut wie Null“299) bereits vollendet haben müssen. Für das Beispiel Kernfusion ist das offensichtlich, die Kernspaltungsansätze könnten realistisch gesehen einen (kleinen, siehe Internationale Energie Agentur [IEA]) Beitrag leisten, Wasserstoff wird für ausgewählte Industriesektoren einen Beitrag zu Lösungen leisten können, aber keinesfalls als Ersatz für den Sprit im gesamten Verkehr oder die Heizung unserer Wohnungen; dafür sind deren gegenwärtigen Verbrauchswerte einfach um ein Vielfaches (5 bis 10faches) zu hoch.
Trotz dieser Fakten, oder vielleicht gerade deswegen, werden solche Meldungen seit einiger Zeit ganz besonders „gepuscht“. Ich bekomme z.B. jeden Tag mindestens vier 'neue' Beiträge genau dieser Struktur über alle Internet-Kanäle empfohlen. Fast genauso zahlreich sind Empfehlungen etwa zu „Ein Energieexperte zu 'Was die meisten Hausbesitzer nicht wissen: Solar lohnt sich nicht'“ oder zu „Wärmepumpen, lasst die Finger davon, die sind nur teuer und verbrauchen dann auch noch Unmengen an Strom“ bzw. „Mit dem Elektroauto kommst Du vielleicht 200 km weit und bleibst dann wg. fehlender Ladestationen liegen“). Dass sich genau diese Beiträge so massiv häufen hat einen einfachen Grund: Sie werden über finanzschwere Werbekanäle generiert. Und dies verfolgt den wesentlichen Zweck, das Geschäftsmodell 'fossile Energie' so lange wie möglich auf so hohem Niveau wie möglich zu halten. Auch zahlreiche politische Kräfte sind in genau diesem Sinn unterwegs; das betrifft in diesem Fall sogar alle Parteien, wenn auch nicht alle Politiker. Die wenigen Ausnahmen allerdings werden jeweils sehr schnell Zielscheiben ganz spezieller Sonderbehandlungen: Hier werden dann die altbewährten Angriffe direkt auf die Personen gerichtet; deren Frisuren im harmlosen Fall, deren Lebensgewohnheiten, deren Freunde oder Partner, sonderbare Geschichten aus deren früherem Leben300) .
Es gibt nur einen ernsthaft realistischen Ansatz: Die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialen muss zügig (heute beginnend), und drastisch (um Faktoren 5 bis 20) reduziert werden. Überall, wo dies heute in hohem Ausmaß erfolgt: Sei es im Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs (zig Kilowatt zig-millionenfach), im Brenner einer Zentralheizung (ebenfalls zig Kilowatt zig-millionenfach) oder im Braunkohlekraftwerk oder der Zementbrennerei. Die Lösungen dafür stehen uns bereits seit langer Zeit technisch und auch ökonomisch tragfähig zur Verfügung: Nicht als im Labor erst kürzlich getestete Exotenlösung, sondern schon seit Jahrzehnten in der Praxis eingesetzte, bewährte technische Systeme: Elektromotoren für die Fahrzeuge, betrieben aus Batterien; Wärmedämmung der Gebäude und Deckung des dann leicht handhabbaren Restbedarfs aus Wärmepumpen sowie Windkraftanlagen und ökologische Baustoffe. Diese Lösungen können heute beginnend, mit sofort hohen Beiträgen, zu bezahlbaren Kosten und mit meist weiteren Vorteilen umgesetzt werden. Es ist richtig: Eine solche Umsetzung wird den Bedarf an fossilen Brennstoffen zügig jedes Jahr weiter reduzieren. Das genau ist das Ziel - und es ist ein notwendig zu erreichendes Ziel. Die fossile Industrie wäre gut beraten, sich konstruktiv an dieser Transformation zu beteiligen - sie können den sonst irgendwann unausbleiblichen raschen Zusammenbruch so jetzt noch vermeiden, indem sie auf alternative Investitionen umsteigen. Die Millionensummen, die derzeit in Desinformationskampagnen gesteckt werden, werden die Situation für diesen Sektor letztlich nur ganz erheblich erschweren.
20. August 2023
Die schwüle Hitze hält an: tatsächlich habe ich sowohl gestern als auch heute wieder mein Bewegungstraining301) an der 'frischen Luft' nicht ausgelassen. Bei jeweils 50 Minuten zügiger Gangart, da komme ich dann bei 30°C und 58% relativer Feuchte ganz schön ins Schwitzen; Sauna soll ja gesund sein! Zugegeben, es tut dann richtig gut, wieder trockene Kleider anzulegen und und ins Dachgeschoss zurück zu kehren: Bei rund 24,8 °C und 59% relativer Feuchte ist hier immer noch Komfortklasse „A“ erreicht302) .
Um diese Innenraumkonditionen einhalten zu können, dafür muss jetzt tatsächlich das Klimagerät betrieben werden. Eine rein passive Methode, die Raumluft unter solchen Außenbedingungen soweit zu entfeuchten, gibt es nicht - bzw. nicht unter noch vertretbarem Aufwand303) .
Hier noch einmal der Link mit den Tipps zu Hitzebelastung reduzieren.
Auch das soll hier noch einmal wiederholt werden: Die Installation eines Klima-Split-Gerätes ist bei Verwendung einer modernen energieeffizienten Anlage heute keine Klimasünde mehr. Ganz im Gegenteil: Das kann sogar beim Klimaschutz helfen, Informationen dazu finden sich hier: Klima-Split-Gerät installieren. Diese Geräte sind auch nicht besonders teuer und sie sind meist schnell und kostengünstig installierbar. Viele wissen das nicht: Gute neue Geräte können auch „umkehrt herum“ betrieben werden: Dann entnehmen sie Wärme aus der Außenluft und können damit heizen. Das liegt natürlich daran, dass es sich auch bei diesen Geräten um Wärmepumpen handelt. Die Betriebsenergie ist elektrisch - und in der Regel lässt sich damit auch in einem Altbau ein einzelner Raum durchaus warm halten. Da der Strom dafür auch im Winter inzwischen zu über 50% aus erneuerbarer Energie kommt, sind die CO2-Emissionen eines solchen Heizbetriebes in aller Regel geringer als die einer Gasheizung - und oft gelingt es auch, die Zentralheizung im Herbst noch eine längere Zeit komplett abzuschalten; dann entfallen auch die sonst oft hohen Abstrahlungs-, Leitungs- und Bereitschaftsverluste.
In den hier regelmäßig erscheinenden Posts werden Erfahrungen mit einem solchen Gerät dokumentiert. In unserem sehr gut wärmegedämmten Haus lässt sich nämlich sogar die gesamte Heizung so ersetzen; das haben wir jetzt über einen Zeitraum von 6 Jahren getestet: Einfach in den früheren Einträgen weiter oben blättern, z.B. zum Gesamtverbrauch für die Gebäudeheizung: Stromverbrauch des Splitgerätes im Winter 2022/23.
21. August 2023
Wenn die Wettervorhersagen zutreffen, dann ist heute der Höhepunkt der schwülen Hitze für unseren Standort (Darmstadt) erreicht; 32°C im Schatten werden erreicht - und die Luftfeuchtigkeit ist immer noch sehr hoch (50% rel. Feuchte in der Außenluft derzeit; das entspricht dann einer Taupunkttemperatur von 16,9 °C). Durch die Feuchtepufferung in Möbeln und Bauteilen und den Betrieb des Klima-Splitgerätes liegen die Werte für den Innenraum im Dachgeschoss jetzt bei 25 °C und 62,3% relativer Feuchte304) ; das liegt jetzt (knapp) außerhalb des Komfort-Klasse „A“-Bandes305) .
Rund 4 kWh elektrische Energie verbraucht das Splitgerät am Tag unter diesen Bedingungen. Auch das deckt der mit der eigenen PV-Anlage produzierte Strom, inkl. des gesamten sonstigen Haushaltstroms, vollständig ab306) .
Etwas anders sehen die Nachrichten aus Teilen der übrigen Welt aus: In Südspanien liegen die Außentemperaturen im Schatten gerade über 40°C (in Sevilla), es herrscht allerdings derzeit dort sehr trockene Hitze.
22. August bis 26. August: "Kühlperiode" im Passivhaus Kranichstein wohl für dieses Jahr abgeschlossen
Bis inklusive 22. August hielt die aktuelle Hitze- und Schwüle-Periode an: Beendet dann mit dem Durchzug eines gewaltigen Gewitters. Ab dem 23. August war dann auch das Splitgerät nicht mehr in Betrieb - zwar war die Luft noch immer etwas feuchter als gewohnt, aber das ließ sich problemlos bei weniger als 26°C in den Räumen aushalten. Die Fenster können jetzt bereits wieder den ganzen Tag über gekippt gestellt bleiben; ab und zu gibt es Warmluft- und Feuchteschübe; sobald uns das stört, werden die Fenster eben wieder geschlossen.
Insgesamt hat das Klimagerät im August bisher 27,86 kWh an elektrischer Energie verbraucht; und aller Voraussicht nach wird da auch kein Verbrauch mehr dazukommen. Zum Vergleich: Der Stromzähler für die PV-Elektrizitätserzeugung steht auf 251,3 kWh, der Verbrauch am gesamten Haushaltstrom (ohne das Splitgerät) lag bei etwa 147 kWh. Trotz einem für August eher untypisch niedrigen Solarertrag liegt dieser immer noch über dem Gesamtverbrauch, nach wie vor bleibt ein Netto-Einspeiseüberschuss.
Die gesamte Betriebsenergie für komfortables Kühlen in diesem Sommer lag damit bei weniger als 36,4 kWhel /(m²a); das entspricht auch in etwa dem bisherigen Mittelwert des sommerlichen Stromverbrauchs des Splitgerätes. Mit unter 0,25 kWh/(m²a) fällt dieser Verbrauch allerdings kaum ins Gewicht: Das ist weit weniger als z.B. der Verbrauch unseres Kühlschrankes oder der Spülmaschine.
Viel entscheidender dabei ist aber, dass der Strombedarf für die Raumklimatisierung ausschließlich in die Zeiten mit PV-Überschuss fällt - und so wird das künftig auch für alle Standorte in Mitteleuropa sein, wenn der Ausbau der Solarstromerzeugung zügig fortgesetzt wird.
Wenn den Wetterprognosen Glauben geschenkt werden kann, dann war die vergangene die letzte diesjährige unangenehme Hitzeperiode an unserem Standort; natürlich kann es beim Wetter auch immer wieder Überraschungen geben; abschließend bilanzieren werden wir diesen Sommer daher erst im Oktober können.
4. September 2023: Strahlender Sonnenschein - angenehm warm, nicht zu heiß
Spätsommerwetter, wie sich die meisten das wünschen: Heute strahlt die Sonne, ist weht ein angenehmes Lüftchen und die Temperaturen passen gerade - auch im Außenbereich. Da können wir auf der Terrasse Abendessen. Diese Bedingungen sind es, unter denen sich auch ganz gewöhnliche Wohngebäude wie „Passivhäuser“ anfühlen. Jetzt können überall die Fenster geöffnet werden - wird es dann zu kühl oder zu warm - dann werden sie eben wieder erst einmal geschlossen; Heizen oder Kühlen, das muss unter solchen Bedingungen nicht sein, die Gebäude verhalten sich, thermisch betrachtet „passiv“. Das ist übrigens die ursprüngliche Idee mit dem Passivhaus: Wie kann diese Periode im Jahr, in dem eine aktive Heizung oder Kühlung erforderlich wird, verringert werden? Schon beim Vorläufer-Standard, dem Niedrigenergiehaus307) ist das so - diese verbrauchen nicht nur viel weniger Energie als früher gebaute Objekte - sie haben auch eine deutlich kürzere Heizzeit308) : In einem typischen Altbau wird normalerweise von Anfang Oktober bis Ende April geheizt. Beim heute üblichen besseren Wärmeschutz von Neubauten beginnt die Heizzeit erst spät im Oktober und schon ab Mitte April kann es in der Wohnung auch ohne Heizung wieder komfortabel bleiben. In unserem Passivhaus beginnt die Zeit mit aktiver Heizung erst spät im November309) und Mitte März ist dann bereits wieder Schluss mit Heizwärmebedarf310) . Insgesamt bleiben in einem Passivhaus dann rund 4 Monate mit aktivem Heizbetrieb - statt der in Altbauten üblichen sieben Monate.
Zuvor waren die letzten Tage im August und Anfang September wechselhaft im Wetter. Wie aus den Wettervorhersagen schon geschlossen, war es problemlos, unter diesen durchaus wechselnden Außenbedingungen die Komforttemperaturen im Haus dauerhaft auf bestem Niveau zu halten - dazu war weder eine aktive Kühlung noch ein Nachheizen erforderlich.
16. September: angenehmes Herbstwetter
Die vergangenen Wochen waren wechselhaft im Wetter: Ein wenig Regen, einige bewölkte Tage - die letzten Tage aber wieder fast durchgehend sonnig, jedoch ohne unangenehme Temperaturspitzen. Das sind Bedingungen, unter denen ein Passivhaus dauerhaft ohne Energie für Heizung oder Kühlung auskommt; so wie auch der erste Prototyp hier. Unter solchen Umständen bleibt das Splitgerät natürlich aus: Es war jetzt seit dem 23. August nicht mehr im Betrieb - und das wird voraussichtlich bis mindestens Anfang November so bleiben.
Nachrichten aus dem Kosmos: Mit einiger Wahrscheinlichkeit Biomarker auf einem Exoplaneten gefunden
Wie immer bei diesen Nachrichten, sollten wir in der Bewertung vorsichtig sein: Denn noch können wir nicht definitiv wissen, dass das Dimethylsulfamid auf K2-18b wirklich von Mikroben produziert wurde (siehe: Aliens entdeckt?). K2-18 ist eine Roter Zwerg; nach vorherrschender Meinung der Astrobiologen nicht die optimalsten Bedingungen für die Entwicklung von Leben. Schon 2019 wurde bereits bestätigt, dass wir bei KII18-b Wasser in der Atmosphäre nachweisen können; es handelt sich um eine Supererde mit einer dichten Wasserstoff-Atmosphäre: Eine typische „Wasserwelt“, Hycean-Planet genannt. Auch Methan und CO2 wurden in der Atmosphäre entdeckt. Aktuell gibt es jetzt sogar einen Nachweis für DMS „(Dimethylsulfamid)“. Auf der Erde wird DMS nur von Bakterien erzeugt - dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es unter den ganz anderen Randbedingungen auf K2-18b auch rein chemisch gebildet werden kann.
Eine solche Entdeckung würde allerdings die Einschätzungen vieler Exobiologen bestätigen: Dass nämlich 'primitives Leben' auf vielen Planeten gefunden werden kann. Das ist, solange sich kein Fund von eindeutigen Biomarkern einigermaßen zweifelsfrei bestätigen lässt, allerdings bisher nur eine Hypothese. Denn noch wissen wir nicht zuverlässig, ob die Grenze zwischen unbelebter Chemie und fortpflanzungsfähigen Organismen überall so leicht und so schnell vonstatten geht, wie das auf der Erde geschah Abiogenese: Hier trat erstes primitives Leben bereits sehr früh, praktisch unmittelbar nachdem die Umweltbedingungen dafür überhaupt geeignet waren, auf.
Sollte sich der Nachweis für organisches Leben auf K2-18b tatsächlich führen lassen, so wären wir in Bezug auf die Einschätzung des Kosmos einen guten Schritt weiter: Ein einziger Nachweis von Leben außerhalb und unabhängig vom Planeten Erde lassen diese Einschätzungen der Exobiologen deutlich wahrscheinlicher werden: Wir könnten dann davon ausgehen, dass es in der Milchstraße aber auch im übrigen Kosmos von Leben „nur so wimmelt“. Ein weiterer Faktor in der Drake-Gleichung wäre dann auch nach unten abgeschätzt: Wir wissen bereits, dass die Sternentstehungsrate in der Milchstraße zwischen 4 und 19 Sonnenmassen pro Jahr liegt. Die Planetenfinder-Forschungsvorhaben der vergangenen zwei Jahrzehnte lassen auch $f_p$ inzwischen recht zuverlässig auf etwa 50% aller Sterne bestimmen - $f_p$ ist der Anteil von Sternen mit Planetensystemen. Schließlich zeigen statistische Analysen der Daten des Kepler-Teleskops, dass es in der Milchstraße mehrere Milliarden annähernd erdgroße Planeten in der für Leben geeigneten Zone gibt (Faktor $n_p$). Für den Faktor $f_l$, nämlich dem Anteil der Planeten mit Leben, gab es bisher keine wissenschaftlich belegbaren Zahlen: aber das könnte sich mit K2-18b nun geändert haben. Da die Entfernung zu Kepler-2-18 nur rund 110 Lichtjahre sind, würde das für einen Faktor jedenfalls größer als $f_l>$ 0,02 sprechen.
Schließlich hat eine technische Zivilisation eine begrenzte Lebensdauer, innerhalb der sie in der Lage ist, ein Radiosignal aus dem Weltraum zu empfangen. Die Zerstörung kann durch natürliche Ereignisse wie z. B. massive Vulkanausbrüche oder Asteroideneinschläge erfolgen; die Abstände solcher Ereignisse auf der Erde liegen allerdings bei sicher über 10.000 Jahren. Wahrscheinlicher ist derzeit die Selbstzerstörung unserer Zivilisation, wozu wir nun bereits eine Auswahl verschiedener Möglichkeiten haben. Noch sind diese Bedrohungen im Grundsatz aller vermeidbar, die Vermeidung setzt allerdings jeweils ein ausreichendes Maß an „praktischer Vernunft“311) voraus 312) .
Wenn sich die unabhängige Abiogenese au K2-18b bestätigen sollte, dann wäre dadurch freilich die Wahrscheinlichkeit für das Entstehen von erkenntnisfähigen Wesen auch auf anderen Planeten wieder von so gut wie Null auf einen messbaren Wert gestiegen. Bei einer eher pessimistischen Abschätzung ergäbe sich zwar für die Milchstraße immer noch eine eher geringe Wahrscheinlichkeit für die zeitkompatible Existenz zweier technischer Zivilisationen. Bei etwa 1 Billion Galaxien im Kosmos würden sich dann jedoch immer noch einige Milliarden erkenntnisfähige Spezies 'zeitkompatibel' im uns bekannten Universum ergeben. Dass wir zu einer von diesen Zivilisationen Kontakt bekommen können, ist bei einer Überlebensdauer die sich nur in Jahrhunderten misst, praktisch ausgeschlossen. Sollten wir es aber auf eine Lebensdauer der Zivilisation von über etwa 250 Jahren bringen können, so wird es immer wahrscheinlicher, dass wir auch über die eigene Galaxis hinaus technische Signaturen aus fernen Galaxien empfangen können - das wäre zwar keine Kommunikation im engeren Sinn313) , aber es könnte unseren Fortschritt als Zivilisation beflügeln, in mehrerlei Hinsicht: Es ist nämlich unwahrscheinlich, Signaturen von sehr jungen technischen Zivilisationen wahr zu nehmen; diese verfügen noch nicht über die Ressourcen für eine intelligente störungsreduzierte Aussendung. Daher werden von uns empfangene Signaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit von gegenüber uns weit fortgeschrittenen Zivilisationen kommen. Von diesen sind aber bedeutende weiterführende Erkenntnisse zu erwarten - sowohl in technischer Hinsicht314) als auch in Hinsicht auf ethische Strategien, welche ein Überleben der Zivilisation ermöglichen.
Das Verhältnis zwischen einer jungen technischen Zivilisation und den von ihr empfangenen Signaturen entspricht dann weniger einem Informationsaustausch315) , sondern einem Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Diese Analyse ist in mehrerlei Richtung aufschlussgebend:
- Zunächst erscheint es nun eher wahrscheinlich, dass es im gesamten Kosmos zumindest vereinzelt über biologische Evolution entstandene intelligente Wesen gibt, die einen erheblich fortgeschrittenen Erkenntnisstand gegenüber uns entwickelt haben. Allerdings dürften die eher in entfernten Galaxien zu finden sein.
- Es ist sogar wahrscheinlich, dass es Vererbungsketten von Top-Down-Informationsübergabe zwischen einigen dieser zunächst voneinander weit entfernten bewusstseinsfähigen Wesen gibt. Hierdurch können sich im Kosmos erkenntnisfähige Strukturen etabliert haben, die nicht nur Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, sondern dann sogar viele Jahrmillionen kommunikationsfähig bleiben. Innerhalb solcher Zeiträume sind dann natürlich gewaltige technische, kulturelle und ethische Fortschritte möglich. Überleben werden nur solche intelligenten Systeme, die eine tragfähige Überlebensfähigkeit fördernde Ethik entwickelt haben und einigermaßen konform praktizieren. Die anderen fallen zwangsläufig früher oder später einem Selbstzerstörungsprozess anheim - denn dieser Prozess wird mit fortschreitendem technischen Kenntnisstand immer leichter technisch umsetzbar; er lässt sich nur vermeiden, wenn wirksame Mechanismen in Kraft gesetzt sind, die solche Prozesse systematisch vermeiden.
- Dass fremde bewusstseinsfähige Wesen physischen Kontakt mit anderen solchen Wesen („Aliens“) eingehen können, erscheint mir nun allerdings sehr unwahrscheinlich: Dazu sind die fraglichen Entfernungen einfach viel zu groß. Dass es zu Transportmöglichkeiten mit Überlichtgeschwindigkeit kommt ist ebenfalls extrem unwahrscheinlich, entgegen mancher moderner Spekulationen über Reisen durch technische Veränderungen der Raumzeit316) .
- Die ebenfalls verbreitete Spekulation, dass auch mit klassischen Unterlichtgeschwindigkeitsreisen expansionswillige Zivilisationen sich innerhalb von wenigen 100 Millionen Jahren über eine gesamte Galaxis ausbreiten halte ich ebenfalls für sehr unwahrscheinlich (sog. Fermi-Paradoxon). Die gesamte Utopie orientiert sich hier sehr stark an einer anthropozentrischen Allmachtsphantasie: Die allerdings würde nach der verwendeten Logik früher oder später zu massiven Konflikten eben genau der so geschaffenen Kolonien führen - weil diese viele Lichtjahre voreinander entfernt unabhängig existieren, ist unter solchen Umständen eine einigermaßen kohärente Kulturentwicklung unwahrscheinlich. Wenn der Expansionswille dabei erhalten bleibt (und der ist ja die primär Grundlage für eine solche physische Ausbreitungsstrategie), kommen sich die Ableger-Kolonien solcherart aufgebauter interstellarer Expansionswellen selbst ins Gehege. Wegen der dabei zu erwartenden extremen Entfremdung der verschiedenen Ableger bei weiter bestehender anthropozentrischer Machtkonfigurationen muss dabei mit enormen zerstörerischen Kräften gerechnet werden. Eine klassische interstellare Ausbreitung (ohne schneller-als-Licht-Kommunikation) können nach dieser Analyse nur solche Zivilisationen dauerhaft überleben, die über eine dem angemessen entwickelte Ethik verfügen. Eine solche würde den Schutz von Leben und Lebensentfaltung aller bewusstseinsfähiger Systeme im Zentrum haben. Es ist übrigens interessant, welche Verbindung sich hier zur Diskussion des Tierschutzes ergibt. Aus dieser Diskussion ergibt sich eine ziemlich zwanglose Erklärung des sog. Fermi-Paradoxons: Interstellare Raumfahrt mit nennenswertem materiellen Effekt ist extrem aufwändig und führt für eine Zivilisation nur dann nicht zu Selbstzerstörung, wenn sie mit einer schützenden Ethik verbunden ist; diese verbietet aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine maßlose und unkontrollierte Expansion in einer gesamten Galaxie.
- Des weiteren verdeutlicht es, wie wertvoll Anstrengungen sind, das Überleben unserer Zivilisation für zumindest einige weitere Jahrzehnte zu sichern: Dann nämlich steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass wir Informationen solcher weit fortgeschrittener Zivilisationen empfangen können. Dies wiederum setzt die Überlebensfähigkeit massiv herauf, weil hiervon insbesondere Informationen für Überlebensstrategien zu erwarten sind.
=====Am 17. September: Spätsommerwetter und ein Nachtrag zum „habitablen“ Planeten=====
Schönes Spätsommerwetter hier derzeit - tagsüber erreichen die Außentemperaturen bis zu 28°C. Das allerdings nur für wenige Stunden am Nachmittag - in dieser Zeit lassen wir die Fenster geschlossen, während diese sonst zu beliebigen Zeiten geöffnet werden können; oder eben auch geschlossen bleiben können, denn die Lüftungsanlage versorgt gesichert mit Frischluft, allein durch die garantierten Volumenströme hier (um 100 m³/h) wird die Innerluftqualität auf hohem Niveau gehalten.
In den Monaten September bis Mitte November und wieder Mitte März bis Mitte Juni, insgesamt etwa ein halbes Jahr lang, ist das die typische Situation in einem zu unserem Klima passend wärmegedämmten Haus. Und, ja, es ist vor allem das Niveau der Wärmedämmung, das ein solches Ergebnis ermöglicht - diese hat den größten Einfluss auf die Reaktionen des Gebäudes auf wechselnde Wetterbedingungen. Etwa 1:10 (!) betragen die Verhältnisse der Verlustwärmeströme - zwischen einer ungedämmten Altbauaußenwand der Baujahre bis etwa 1972 und einer nachträglich ausreichend gut gedämmten Wand. Wenn das nach einem großen Unterschied klingt - dann, weil das auch so ist. Das verkürzt die Zeiten sowohl für die Notwendigkeit eine aktiven Heizung317) als auch für die evtl. Notwendigkeit einer aktiven Kühlung bei fortschreitender Veränderung des Klimas318) aktiv gekühlt und dafür 36,4 kWh Strom verwendet, der ausschließlich aus Überschüssen des selbst erzeugten Photovoltaik-Stroms gedeckt werden konnte; aus Komfortgründen hätten wir uns in diesem Jahr diese aktive Kühlung sogar sparen können, auch ohne diese wären die Temperaturen im Haus nicht über 28°C angestiegen319) . Der Stromverbrauch für die Kühlung ist bisher vernachlässigbar, sehr viel weniger als z.B. mein persönlicher Verbrauch für den Betrieb des Notebooks, mit dem ich diese Erfahrungsberichte schreibe. Dieser Verbrauch könnte sich freilich in den kommenden Jahrzehnten verfünffachen, wenn die Klimaveränderungen wie im bisherigen Trend anhalten320) . Auch dann allerdings wird der Stromverbrauch für die aktive Kühlung in einem angemessen wärmegedämmten Gebäude bei unter 200 kWh/a bleiben und das ist weiterhin ohne Problem mit individuellen PV-Anlagen am Gebäude selbst zu decken; bis auf wenige Ausnahmefälle, in denen die PV entweder nicht sinnvoll oder nicht zulässig ist.
Weit verbreitete Ängste, dass Klimaanlagen in Deutschland zu hohen zusätzlichen Energieverbrauchswerten oder gar zu einer Überlastung des Stromnetzes führen würden, sind vor diesem Hintergrund unbegründet.
Nach einem entspannten Sonntag am Abend noch ergänzt: Wie schon an anderer Stelle im Blog ausgeführt, ist die Installation eines modernen Klima-Splitgerätes für zumindest einen Raum der Wohnung kein besonders hoher Aufwand und auch nicht mit hohen Kosten verbunden: Einbau eines Split-Gerätes. Diese Geräte sind in den vergangenen 10 Jahren ganz erheblich effizienter und vor allem sehr viel leiser geworden - und fast alle erlauben inzwischen auch einen Heizbetrieb im Winter; genau diesen benutzen wir in unserer Wohnung; und wir schaffen es so tatsächlich, gar keine andere Heizung mehr zu benötigen. In weniger effizienten Gebäuden würde es möglicherweise zwei oder sogar drei solcher Geräte benötigen - auch das wäre aber immer noch erheblich kostengünstiger in der Anschaffung als ein Wärmepumpenersatz für die Zentralheizung. Noch klüger ist es allerdings, vorläufig nur ein solches Geräte zu installieren und dessen Anteil an der Heizung Stück um Stück durch Verbesserung des Wärmeschutzes zu erhöhen. In wenigen Jahren werden Neugeräte dieses Typs nämlich überwiegend noch einen Tick effizienter sein und mit R290 (Propan) betrieben werden, wodurch der Treibhausgaseffekt des Arbeitsgases praktisch unbedeutend wird.
Ergänzung zum Planeten um den roten Zwergstern K2-18
Auf meinen Bericht gestern gab es einige für mich überraschende Reaktionen, die mich veranlassen, auf ein paar Punkte näher einzugehen.
Eine der Reaktionen war „Wann reisen wir los?“ und natürlich war das satirisch gemeint. In der Tat könnte es sein, dass gar nicht wenige heute bei dem Gedanken an Exo-Planeten primär die Frage in den Kopf kommt, ob denn ein solcher Planet als „zweite Heimat“ für uns Menschen geeignet wäre - insbesondere dann, wenn unser eigener Heimatplanet für unsere Spezies keine komfortablen Bedingungen mehr bieten würde. Solche Überlegungen kommen Wissenschaftlern, die sich mit Fragen der Planeten anderer Sterne befassen, an dieser Stelle jedoch überhaupt nicht in den Sinn: Im konkreten Fall gleich aus drei Gründen, auf die ich hier näher eingehen will. Dass sich solche Vorstellungen offenbar bei nicht wenigen Personen einstellen liegt nach meiner Einschätzung vor allem an einem völlig unrealistischen Bild, das insbesondere vom Genre „Science Fiction“ bzgl. der interstellaren Raumfahrt gezeichnet wird. Leider werden einige dieser Vorstellungen auch von einigen begeisterten Fans der Science Fiction, die im wissenschaftlich/technischen Bereich arbeiten, manchmal befördert. Es wird daher Zeit, darauf aus einer realistischen Perspektive einzugehen.
Die Eigenschaften des Planeten "b" um K2-18
Für den Planeten wurde eine Gleichgewichtstemperatur von 11 ± 15 °C gemessen - das sieht zunächst einmal recht komfortabel aus, liegt es doch in dem Bereich der Temperaturen, die wir auf der Erde gewohnt sind. Die Masse ist mindestens 7mal so groß wie die der Erde - und bei einem 2,7-fachen Radius ergibt sich so an der Oberfläche eine Schwerkraft, die interessanterweise von 1 g ebenfalls nur wenig verschieden ist. Jetzt kommt es aber dicke: die Atmosphäre des Exoplaneten enthält neben Wasserdampf vor allem Wasserstoff und Helium, alle drei Gase in sehr hoher Dichte und unter extrem hohem Druck321) : der könnte ein Millionenfaches des Druckes auf der Oberfläche der Erde betragen. K2-18 ist von diesen Eigenschaften her für den Aufenthalt von irdischem Leben, insbesondere von Menschen oder anderen höher entwickelten Organismen, völlig ungeeignet: Weitaus ungeeigneter als z.B. Venus, dort beträgt der Druck 'nur' 92 bar. Auch ein „Terraforming“, d.h. die Veränderung der atmosphärischen Zusammensetzung im Sinne einer leichteren Ansiedelbarkeit für Leben, wie wir es kennen, ist wegen des extremen Druckes sehr viel schwieriger als dies für die Venus gelten dürfte. Ein attraktives Reiseziel ist K2-18b von diesen Eigenschaft her überhaupt nicht - da sind wir mit anderen Planeten unseres eigenen Sonnensystems schon besser gestellt.
Es gesellt sich ein weiter Punkt hinzu: Die 'Sonne' dieses Planeten, K2-18, ist ein 'roter Zwerg', der nur etwa 50% der Masse der Sonne hat. Diese Kategorie von Sternen hat ein weitaus weniger stabiles Oberflächenverhalten als unsere Sonne: Die Aktivitätsausbrüche können gewaltig sein322) , die dadurch ausgelösten Störungen der elektromagnetischen Felder im Planetensystem dementsprechend hoch. Der Planet K2-18b befindet sich auch in einer Entfernung von nur 16% (!) des Erdbahnradius zu seinem Zentralgestirn - Aktivitätsausbrüche wirken sich dort erheblich massiver aus. Ebenso wie der vom Stern ausgehende Sternwind, der ein sehr hohes Niveau an ionisierender Strahlung323) in der Nähe des Planeten bewirken wird: Auch das macht K2-18b sehr wenig einladend. Ganz zu schweigen von den enormen Gezeitenwellen auf dem Wassergestirn, die durch die Nähe zum Zentralstern bedingt sind.
Die Bedingungen auf K2-18b sind daher in so hohem Ausmaß extrem, wie es sich selbst Science-Fiction Autoren regelmäßig gar nicht vorstellen konnten oder wollten; das liegt natürlich daran, dass mit solchen „Welten“, deren Betreten durch irdische Lebewesen selbst in speziellen Schutzanzügen nicht möglich sein wird, kaum eine irgendwie für menschliches Publikum faszinierende Story verbunden werden kann. Selbst der Wasserplanet „Solaris“ in dem schon reichlich entfremdeten Roman von Stanislav Lem wird am Ende auf der Oberfläche vom Protogonisten besucht und der sagenumwobene bewusstseinsfähige Ozean wird von ihm berührt. K2-18b ist weitaus fremdartiger als Solaris.
Sollten Abenteurer von der Erde irgendwann zu interstellaren Reisen aufbrechen324) , dann wird gerade K2-18b ganz sicher nicht ein Zielobjekt der ersten Wahl sein.
Das Ding mit den interstellaren Reisen
Das Zentralgestirn K2-18 ist von der Erde rund 124 Lj325) weit entfernt. Das Licht, mit einer Geschwindigkeit von rund 300.000 km/s benötigt somit 124 Jahre von dort, um das Sonnensystem zu erreichen. Vergleichen wir damit z.B. die minimale Entfernung zum Planeten Mars unseres eigenen Systems: Dafür benötigt das Licht immerhin 5 Minuten. Mit der uns heute und für die nächsten Jahrzehnte verfügbaren Raumfahrttechnik benötigt eine Reise zum Mars etwa 9 Monate. Die Entfernung zum genannten Exoplaneten ist etwa 13 Millionen mal so weit wie die zum Mars! Mit der gegenwärtig verfügbaren Raumfahrttechnik ist eine solche Reise für Menschen schlicht nicht möglich.
Nun werden andere Antriebstechniken für die Raumfahrt diskutiert, mit Kernkraft betriebene Ionen- oder Plasmaantriebe sind physikalisch möglich, wenn auch noch nicht für Großraumschiffe praktisch demonstriert. Um ein einzelnes bemanntes Raumschiff auf „nur“ 10 % der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, wären Energiemengen aufzubringen, die in der Größenordnung des jährlichen Weltenergiebedarfs liegen - das weist auf den hier zu betreibenden Aufwand hin, den sich die Menschheit in diesem oder im folgenden Jahrhundert kaum wird leisten wollen oder auch können.
10% der Lichtgeschwindigkeit würde aber immer noch eine Reisezeit zu K2-18b von mehr als 1200 Jahren bedeuten - das sind rund 40 menschliche Generationen, weshalb dieses Raumfahrtkonzept auch ein „Generationen-Raumschiff“ genannt wird. Allerdings sind dabei eine ganze Reihe von Fragen noch völlig ungeklärt: Wie hoch ist die ionisierende Strahlung im interstellaren Raum und welcher Aufwand ist erforderlich, diese auf ein tolerierbares Maß abzuschirmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit interstellarem Staub, die bei 10% der Lichtgeschwindigkeit bereits verheerende zerstörerische Auswirkung haben wird?326)
Allein diese Fakten illustrieren, dass wir derzeit von einer technischen Realisierbarkeit interstellarer Reisen für Menschen noch sehr weit entfernt sind; es ist noch nicht einmal klar, ob es solche Reisen überhaupt irgendwann einmal in der Zukunft geben wird - Frank Drake hat dies z.B. grundsätzlich, und aus guten Gründen, bezweifelt. Durchaus denkbar ist der Flug unbemannter Sonden, das Breakthrough Starshot-Projekt ist ein Beispiel für ein solches Vorhaben, das im wesentlichen Erkenntniszwecken dient. Interessanterweise erfolgt die Beschleunigung hier durch Laserlicht, das auf ein Lichtsegel der nur wenige Gramm schweren Sonde gerichtet wird (!). Auch dieser Ansatz steht derzeit noch an den Grenzen der für die nächsten 20 Jahre als technologisch realisierbar gedachten Möglichkeiten. Eine solche Mikro-Sonde würde mit ca. 20% der Lichtgeschwindigkeit an ihrem Ziel vorbei fliegen, da es keine Möglichkeit einer zerstörungsfreien Abbremsung gibt. Auch der schon dafür benötigte Aufwand verdeutlicht die Herausforderungen interstellarer Raumfahrprojekte327) .
Fazit: Interstellare Raumfahrt übersteigt die für uns Menschen in den nächsten Jahrzehnten gegebenen Möglichkeiten; auf lange Sicht sind allerdings unbemannte Sonden zu den Lichtjahre entfernten Sternen durchaus vorstellbar, vor allem mit gebündelten Photonen auf Lichtsegel gerichtete Mikrosonden könnten bei der Erforschung des interstellaren Raumes eingesetzt werden. Selbst diese Projekte würden den Einsatz gewaltiger Ressourcen erfordern. Als „Ausweichheimat“ („Erde 2.0“) geeignete Exoplaneten in absehbarer Zeit quasi mit „Rettungsschiffen“ von der Erde zu erreichen bleibt eine lebhafte Phantasie nur wenig durchdachter Science-Fiction-Plots. Die zugehörigen Aufbauten würde die menschlichen und natürlichen Ressourcen unseres Planeten für Jahrzehnte nahezu vollständig beanspruchen, ein Aufwand, den in diesem Jahrhundert niemand auf der Erde wird leisten wollen oder können.
Eine etwas andere Frage ist der „Rettungsflug“ zu anderen Himmelskörpern innerhalb unseres Sonnensystems. Das ist das Konzept von Elon Musk mit seiner „Starship“-Initiative. Dieser Flug ist noch derzeitigem Stand der Technik durchaus im Bereich einer technischen Möglichkeit - die Experimente mit dem Starship zeigen auch schon hier den Aufwand, der auch dafür bereits erforderlich ist. Ich werde die damit verbundenen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt genauer diskutieren: Das Kernproblem bei diesem Ansatz liegt nicht so sehr bei einem solchen Flug an sich, sondern bei der Frage der Überlebensfähigkeit einer auf sich allein gestellten Marskolonie. Bisherige Experimente mit vom irdischen Ökosystem abgekoppelten Systemen (Biosphäre 2) sind dafür nicht gerade ermutigend. Um hier nicht falsch verstanden zu werden: Letztendlich halte ich ein von der Erde unabhängiges Ökosystem, in welchem Generationen von Menschen überleben können, nicht für prinzipiell unmöglich. Allerdings bin ich sicher, dass wir bisher die Voraussetzungen dafür noch nicht entfernt verstanden haben. Die zugehörigen Erkenntnisprozesse liegen bei Zeitintervallen von vielen Jahrzehnten; das liegt in der Natur der Sache, denn die Überlebensfähigkeit einer Spezies wird nicht in Jahren, sondern in Jahrhunderten gemessen. Sehr wahrscheinlich sind dafür großvolumig rotierende Raumstationen (sog. O'Neill-Zylinder) sogar leichter umzusetzen als z.B. eine Kolonie auf dem Mars. Auch solche Konzepte haben aber immer noch ein gigantisches ökonomisches Ausmaß und sind bisher gerade nur eben angedacht.
Ergänzung am 2. Juni 2024: Ein Zitat aus dem Buch „A City on Mars“ von Zach und Kelly Weinersmith, die nach gründlichem Studium der hier andiskutierten Frage zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind328) :
„…eines Tages können wir, wenn wir genug gelernt haben, den Mars in Besitz nehmen. … Aber wir müssen ihn uns verdienen, indem wir sowohl unser Wissen erweitern als auch indem wir eine verantwortungsvollere, friedlichere Spezies werden. Dadurch, dass wir zu den Sternen fliegen, werden wir nicht <automatisch> weise. Wir müssen weise werden, wenn wir zu den Sternen fliegen wollen.“
Apell zu einem mehr bodenständigen Zugang zur Sicherung einer menschlichen Zukunft
Die in den vorausgehenden Abschnitten gesammelten Fakten geben eine realistische, aber durchaus weiterhin optimistische Bewertung der Möglichkeiten, überlebensfähige menschliche Kolonien außerhalb des Planeten Erde zu gründen, wieder. Aus den Fakten ergibt sich leicht nachvollziehbar, dass der dafür erforderliche Aufwand enorm ist, schon bei den Projekten, die sich innerhalb des eigenen Sonnensystems abspielen. In den nächsten 3 bis 4 Jahrzehnten wird ein „Rettungsring“ für die menschliche Zivilisation außerhalb des Planeten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei beträchtlichem Aufwand nicht realisierbar sein - das wird in aller Kürze hier von Bill Nye zusammengefasst Settle on Mars? Ein Flug von Menschen zu Exoplaneten steht selbst in noch weiterer Zukunft kaum an und dieser wäre mit geradezu gigantischem Aufwand verbunden329) .
Reflektieren wir nun noch einmal den Ausgangspunkt dieser „Spekulationen“: Das ist der vielfach angenommene Umstand, dass aus irgendwelchen Gründen Planet Erde, die Urheimat unserer Spezies, keine lebenswerten Bedingungen für die menschliche Zivilisation bieten könnte. Früher waren solche Befürchtungen vom Auftreten großer Naturkatastrophen geprägt: Ein Einschlag eines großen Asteroiden oder ein gewaltiger Supervulkan-Ausbruch. Von ersterem wissen wir heute aufgrund der Himmelsdurchmusterung, dass dies innerhalb der kommenden 200 Jahre praktisch ausgeschlossen werden kann - und wir darüber hinaus schon in spätestens einem Jahrzehnt in der Lage sein werden, solch ein Ereignis erfolgreich zu verhindern; unklar ist dabei allerdings, ob für ein solches Projekt der sog. Planetaren Verteidigung ausreichend Mittel in den Haushalten der Nationen geben wird.
Viel größer als die Gefahr solcher „natürlicher“ Katastrophen ist allerdings derzeit die Bedrohung der Zivilisation durch ihre eigene Aktivitäten. Der durch den massiven Konsum von fossilen Energieträgeren ausgelöste Klimawandel ist hierfür nur das herausragende Beispiel - auch die Gefahr eines weltweiten nuklearen Konfliktes ist immer noch gegeben; der auch durch den Klimawandel mit ausgelöste Artenschwund ist in seinen Auswirkungen ebenfalls nur schwer absehbar. Viele sehen die planetaren Grenzen auch bereits durch den maßlosen Ressourcenabbau gefährdet - das ist nach wie vor das beliebteste Szenario, weshalb sich Menschen vorstellen, dass wir den Planeten „verlassen“ müssen, nachdem wir ihn maßlos ausgeplündert haben. Diese Sicht ist übrigens verblüffend weit verbreitet - auch dies hängt mit wenig seriös recherchierte Filmepen mit solchen Horrorszenarien zusammen.
Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist: Die Zerstörung der Zivilisation durch ihre eigenen Aktivitäten muss nicht stattfinden, wir Menschen sind ohne weiteres in der Lage, diese oft heraufbeschworenen Untergangsszenarien zu vermeiden. Es geht dabei auch mehr um 'vermeiden' als um 'verhindern', denn die ohne Zweifel vorliegenden Gefahren werden durch unser eigenes Handeln ausgelöst: Das CO2 kommt nicht auf mysteriösem Weg in die Atmosphäre - vielmehr werden Jahr für Jahr je Person mehr als 4 to dieses Verbrennungsgases aktiv durch Abfeuern von fossiler Kohle, Öl und Gas freigesetzt. Es ist keinesfalls so, dass dies für den Erhalt der Zivilisation zwingend erforderlich wäre330) . Im Artikel über Energieeffizienz haben wir einen Weg skizziert, mit dem die Verbrennung fossiler Rohstoffe innerhalb von weniger als drei Jahrzehnten nahezu vollständig zurückgefahren werden kann. Dieser Weg über verbesserte Energieeffizienz und den Einsatz von erneuerbarer Energie ist sogar mit einem verblüffend kleinen Aufwand verbunden; der größte Teil des Aufwandes besteht darin, den heutigen Pfad der Verschwendung zu verlassen und systematisch auf nachhaltige Wege der Energiedienstleistung umzusteigen. Wie wir in Passipedia an verschiedenen Stellen gezeigt haben, ist das sogar mit verbessertem Komfort, höherer Versorgungssicherheit und bedeutend geringeren Abhängigkeiten von mächtigen Strukturen umsetzbar. Der erforderliche Aufwand dafür ist um Größenordnungen geringer als der für die Umsetzung planetarer oder interstellarer Raumfahrtprojekte - und während diese einen möglichen Erfolg erst in vielen Jahrzehnten (möglicherweise - eben nicht gesichert) werden erzielen können, ist der Erfolg einer Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften heute schon sicher, wenn wir dies nur angehen: Das ist nämlich durch bereits heute nachhaltig wirtschaftende Regionen erwiesen. Der Erfolg einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist dann übrigens nicht allein die Rettung des Fortbestandes der menschlichen Spezies - wie das in einem O'Niell-Zylinder mit vielleicht einigen Zehntausend Bewohnern oder einer Mars-Kolonie möglicherweise der Fall wäre - sondern die Chance eines bruchlosen Fortbestandes der in viele Milliarden zählenden irdischen Bevölkerung.
Angesichts des weitaus geringeren Aufwandes und des weitaus höheren Nutzens ist es daher derzeit vor allem angebracht, an der Überlebensfähigkeit der Zivilisation auf deren Heimatplaneten Erde zu arbeiten. Möglichkeiten dafür gibt es unzählige - Martin Luthers Empfehlung, ein Apfelbäumchen zu pflanzen, ist nur eine davon. Viele weitere werden in unserer Sammlung zu "Energieeffizienz jetzt" dargestellt: Dies umzusetzen macht Spaß und ist von Erfolg gekrönt - und es spart sogar bares Geld.
25. September 2023: Zwei Tage nach der Tag- und Nachtgleiche
Dass die Tage jetzt schnell kürzer werden - das ist leicht wahrzunehmen. Freilich gab es gestern viel Sonnenschein und für den heutigen Tag sieht es noch besser aus. Die Außenlufttemperaturen liegen in einem Bereich zwischen 7 °C morgens und fast 20 °C am Nachmittag. Im Tagesmittel liegen rund 13°C schon deutlich unter den Innentemperaturen; die halten sich hier gerade zwischen 22 und 23°C. Das bedeutet, dass Gebäude schon jetzt einen nennenswerten Wärmeverlust aufweisen; im Passivhaus ist der allerdings mit unter 800 Watt immer noch deutlich geringer, als die ständig ohnehin verfügbare freie Wärme; die ist derzeit bei klarem Himmel, wird sie ungehindert ins Haus gelassen, eher noch zu hoch. Daher halten wir auch derzeit noch die Jalousien auf einem „freie Durchsicht“-Stand, bei dem zwischen den Lamellen maximaler Ausblick gegeben ist, aber direktes Sonnenlicht noch nicht in den Raum gelangt. Geheizt werden muss dann nicht, das diffuse Licht trägt auch dann immer noch genügend Energie in die Räume: Gekühlt werden muss aber selbstverständlich auch nicht, denn, sollte es uns tatsächlich bei dieser Wetterlage zur warm werden, dann wird eben für ein paar Minuten das Fenster geöffnet - die Außenluft ist jetzt kühl genug, um Temperaturen im Raum so schnell wieder zu reduzieren.
Die Beleuchtungsstärke bei dieser Stellung der Jalousien an meinem Sitzplatz beträgt so übrigens knapp 500 Lux und es handelt sich um ein recht gleichmäßiges Licht; Kunstlicht bedarf es unter diesen Bedingungen offensichtlich auch nicht; außer in den wenigen Stunden am Abend.
Noch die Zahlen zur PV-Stromerzeugung: Der Beitrag lag gestern (an einem klaren Herbsttag) bei 11 kWh, immer noch deutlich mehr, als der derzeitige tägliche Verbrauch an Strom im Haushalt (rund 6,5 kWh/d). An eher durchschnittlich bewölkten Tagen sind es um 5 kWh/d, die noch geliefert werden. Ab Oktober wird dann der erzeugte PV-Strom in der Regel nicht mehr zur Deckung des 'normalen' Stromverbrauchs ausreichen, da waren es typischerweise noch rund 3,6 kWh/d. Dann müssen andere erneuerbare Energieerzeuger übernehmen; im Winter muss das überwiegend Windenergie sein, denn unsere PV-Anlage liefert im Dezember durchschnittlich weniger als 1 kWh/d. Bei der erneuerbaren Energie kommt es auf eine vernünftige Mischung aus verschiedenen Quellen an und auch eine weite geographische Verteilung ist hilfreich: Denn, dass überall zugleich 'Dunkelflaute' herrscht, ist unwahrscheinlich.
Trotzdem muss auch für einen solchen Fall vorgesorgt sein: In diesem Fall ist saisonale Speicherung von Energie die einzige verbleibende Möglichkeit331) . Wie das im Prinzip machbar ist, haben wir an anderer Stelle diskutiert: Saisonale Energiespeicher. Realistisch betrachtet bleiben als bezahlbare Optionen dafür nur Wasserstoff und/oder daraus über einen Sabatier-Prozess gewonnenes (EE-)Methan. Beides ist immer noch spürbar teurer als heute bezogenes Erdgas. Sehr viel sinnvoller ist es da, zunächst einmal den Bedarf für eine solche teure jahrzeitliche Speicherung gering zu halten. Die besondere Belastung ist dabei der Bedarf an Heizwärme, denn der ist im Winter konzentriert. Die in den vorausgehenden Abschnitten dokumentierten Erfahrungen zeigen, dass sich der Bedarf an Heizwärme tatsächlich um gut einen Faktor 10 reduzieren lässt: Unter solchen Randbedingungen bleiben selbst die teuren Energieträger Wasserstoff und EE-Methan noch finanzierbar, einfach, weil nur wenig davon gebraucht wird.
1. Oktober: September-Übersicht
Meldung des Deutschen Wetterdienstes: „Das Temperaturmittel lag im September 2023 mit 17,2 Grad Celsius ( °C) um 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 3,4 Grad.“ Das können wir auch anhand unserer Messdaten am Standort bestätigen: Im übrigen war es hier tatsächlich tagsüber im gesamten Monat warm genug, um im Hemd und ohne Jacke im Freien zu sitzen - wir konnten so fast jeden Abend auf der Terrasse gemeinsam Abendbrot essen.
Bei solchem Wetter muss natürlich in einem Passivhaus weder geheizt noch gekühlt werden: Der gesamte Monat erlaubte einen rein passiven Betrieb des Gebäudes: Die Fenster konnten fast immer auch gekippt bleiben, in den paar etwas kühleren Nächten bleiben die meisten Fenster dann eben zu. Energieverbrauch für Heizung und Kühlung332) : 0 kWh. Aber ja, im September ist das eigentlich keine Kunst: In gar nicht wenigen Gebäuden wurde aber schon geheizt - und in einigen Bürogebäuden wurde auch klimatisiert. Interessanter sind dann die Daten für Oktober und November: Auch in diesen Monaten haben wir im beschriebenen Gebäude seit 1992 nie heizen müssen. Noch wichtiger sind dann die Wintermonate: Da braucht es zwar ein wenig Heizung, aber sehr viel weniger als „üblich“, nämlich weniger als ein Zehntel (!) der Wärme. Die mit dem Klimagerät erzeugt, beträgt der Stromverbrauch dafür nur rund 4 kWh/(m²a); das tut nirgendwo „weh“, weder der Haushaltskasse noch der Umwelt. So auch im letzten Winter, beschrieben hier: Wieviel im Winter verbraucht
Wir dokumentieren die Messdaten des Monatsverlaufs, beginnend mit den Strahlungsdaten:
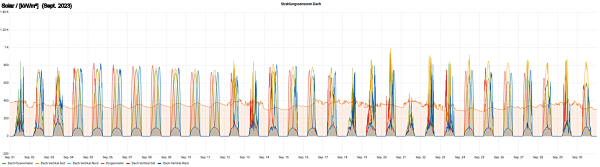
Die Raumtemperaturen lagen bis auf wenige Ausnahmen zwischen 21,5 und 24,5°C, somit in einem Bereich, der mit jeweils angepasster Kleidung optimale Behaglichkeit erlaubt. Einzelne Ausnahmen, z.B. ein Ausreißer auf 18,4 °C in den frühen Morgenstunden des 21.September sind auf Sonderaktionen der Bewohner zurückzuführen: Da z.B. war ein Fenster im südöstlichen Obergeschosszimmer ganz geöffnet. In die andere Richtung geht der Ausreißer auf 25,7°C um die Mittagszeit im Dachgeschoss-Studio-Raum („Bibliothek“); ab diesem Tag hatten wir dort die Jalousie vollständig geöffnet, so dass wir die einfallende Sonne genießen konnten.
7. Oktober 2023 Immer noch Spätsommer-Wetter
Wir haben die Jalousien jetzt die meiste Zeit geöffnet: Denn, die Temperaturen im Außenbereich beginnen zu sinken, die Wärmeverluste des Hauses nehmen daher zu. Da ist passiv solare Energie jetzt willkommen - so um rund 23°C im Arbeitszimmer, das bin ich jetzt einfach gewohnt, und das ist so auch immer noch ganztägig zu halten.
Klar, dass unter diesen Umständen derzeit weder aktiv geheizt noch gekühlt werden muss, versteht sich nahezu von selbst. Jedenfalls in jedem einigermaßen vernünftig geplanten und gebauten Gebäude an unserem Standort.
Die Raumtemperaturen liegen nach wie vor zwischen 21,7 und 23,6 °C, ganz ohne Heizung. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten zeigt, dass das noch zumindest bis weit in den November so bleibt.
Subjektiv gesehen ist das (nach dem Frühjahr) eine der besonders angenehmen Zeiten im Haus. Da kann durchaus auch mal die Außentür eine Weile offen stehen - wenn es uns dann im Nordteil des Erdgeschosses zu kühl werden sollte, dann machen wir die Tür eben wieder zu. Es dauert dann keine 10 Minuten, und die Temperaturen liegen wieder im Behaglichkeitsfeld, auch das ohne Notwendigkeit für eine aktive Beheizung.
Wie funktioniert das? - In wenigen Schritten erklärt.
(1) Steht die Tür oder ein Fenster auf, so kommt es dadurch zu einem stark erhöhten Luftaustausch mit dem Innenraum. Das können 500 (bei Wind noch mehr) Kubikmeter pro Stunde sein.
(2) Die eintretende Luft fließt zunächst im unteren Bereich des Raumes ein, in dem die Tür nach außen offen ist; sie hat dort schnell eine Temperatur, die nicht viel über der der Außenluft liegt (Das gilt übrigens weitgehend unabhängig vom Baustandard eines Gebäudes).
(3) In diesem Raum spüre ich den Abfall der Temperatur daher schon bald, in 2 bis 3 Minuten spätestens - ein paar Minuten halten Bewohner das auch aus (wie lange, das schwankt subjektiv sehr stark; 'Warmduscher' rufen schon nach wenigen Sekunden 'Tür zu, es zieht', hart gesottene Sportsleute freuen sich ob des Hauchs der frischen, kalten Luft und sitzen auch schon mal eine Viertelstunde im Kaltluftstrom. Nur, wenn das jemand wirklich aus ideologischen Gründen auf die Spitze treiben will, sind die Öffnungszeiten auch schon einmal länger - oder, wenn niemand anwesend ist im betreffenden Geschoss; das kann schon auch mal vorkommen).
(4) Bei einer Viertelstunde offen stehender Tür, 22°C innen und 10° C außen ist der gesamte zusätzliche Wärmeverlust auf etwa 600 Wh (Wattstunden) zu beziffern. Diese Energiemenge wird somit zunächst der Luft im betroffenen Raum, dann aber auch durch die Wärmeübergänge den oberflächennahen Schichten des Raumes entzogen.
(5) Machen wir nach 15 Min die Tür zu, so dauert es rund 12 Minuten, bis sich die Raumluft des betroffenen Raumes wieder mit der Raumluft im Rest des Gebäudes vermischt hat - die Luft im Rest der Wohnung ändert bei diesem Vorgang ihre Temperatur nur wenig (maximal rund 2 K); das ist die erste Quelle für den Ersatz der verlorenen Wärme.
(6) Die Bauteil- und Möbeloberflächen haben allerdings einen noch größeren Einfluss auf das thermische Verhalten: Sie haben nämlich, im Vergleich zur Luft, sehr hohe Wärmekapazitäten. Die Größenordnung liegt bei einem Faktor 20 bis 80. Diese Wärmekapazitäten werden bei kurzen „Kaltlufteinfällen“ nur wenig entladen; die Temperaturen dieser Oberflächen lagen und liegen daher auch während und kurz nach der Türöffnung nur Bruchteile eines Grads unter deren ursprünglichen Temperaturwerten.
(7) Die konvektiven Wärmeübergänge an den Oberflächen sorgen nun dafür, dass weiterhin Wärme aus den Oberflächen in die noch kühlere Luft übertragen wird; und zwar so lange, bis diese Luft wieder etwa gleiche Temperatur wie die Oberflächen erreicht hat. Die Zeit, die dafür gebraucht wird, ist ähnlich lang wie die Zeit, die zuvor mit geöffneter Tür dieselbe Oberfläche entladen wurde - in unserem Fall rund eine Viertelstunde.
(8) Dass sich die Temperaturen der Oberflächen fast über den gesamten Vorgang nur wenig ändern, das liegt an der schon genannten relativ hohen Wärmekapazität im Vergleich zu der der Luft.
(9) Letztlich strömt dann weitere Wärme aus den tieferen Schichten der Möbel und der Bauteile in den Raum nach - innerhalb von rund einer Stunde hat sich der zusätzliche Wärmeverlust dann auf nahezu die gesamte zugängliche Wärmekapazität des Gebäudes verteilt. Diese gesamte wirksame Wärmekapazität liegt bei unserem Gebäude jedenfalls deutlich über 30 kWh/K; die 600 Wh bewirken daher eine netto-Temperaturabnahme des Hauses um rund 0,02 K. Das ist nahezu unbedeutend, dann jedenfalls, wenn diese Energie innerhalb von ein paar Tagen wieder nachgeliefert wird. Das ist im Oktober nahezu immer der Fall, denn die Sonne kommt da durchaus immer mal ein paar Stunden hinter den Wolken hervor und liefert dann zusätzliche freie Wärme über den Grundbedarf hinaus. In den Übergangsjahreszeiten, solang nicht geheizt wird, spielt eine ab und zu für ein paar Minuten offen stehende Tür somit kaum ein Rolle - 'Theorie' (eben nachvollzogen) und 'Praxis' (die dargelegte subjektive Erfahrung) stehen auch hier in voller Übereinstimmung.
Wie verhält sich das aber nun z.B. mitten im Winter?
Gehen wir dazu von einem mittleren Tag im Dezember oder Januar aus, an dem die Außentemperatur rund 0°C beträgt. Bei ganz geöffneter Tür ist dann auch das pro Zeiteinheit ausgetauschte Luftvolumen höher (stärkerer Antrieb durch höheren Dichteunterschied); zusammen mit der höheren Temperaturdifferenz ergibt sich bei wieder 1/4 Stunde Öffnungszeit nun ein zusätzlicher Wärmeverlust von etwa 2 kWh. Auch der wird, ähnlich schnell, nach dem Schließen der Tür wieder aus den Wärmekapazitäten der Bauteile und Möbel nachgeliefert; allerdings 'läuft' in diesen Zeiten die Heizung im Haus ohnehin, und zwar fast dauerhaft. Der Zusatzwärmeverlust kann nun nicht mehr durch überschüssig verfügbare freie Wärme nachgeliefert werden, wie das im Oktober noch der Fall ist. Der Wärmeverlust muss im Kernwinter nun durch die Heizungsanlage zusätzlich geliefert werden: Das sind eben genau rund 2 kWh Heizwärme mehr. Machen wir das z.B. jeden Tag einmal, dann summiert sich das auf rund 200 kWh zusätzlichen Heizwärmeverbrauch oder rund 1,3 kWh/(m²a) Mehrverbrauch. Mit der Wärmepumpe somit rund 0,5 kWh/(m²a) zusätzlichem Stromverbrauch für das Heizen; das sind rund 12% des ohne das Offenstehenlassen vorliegenden Verbrauchs. Auch das ist im Grunde kein Drama, aber eben durchaus eine nennenswerte und messbare Menge Energie. Die hier abgeschätzte Größenordnung illustriert auch einen Teil der Ursache, weshalb die individuellen Verbrauchswerte in baugleichen Wohnungen durchaus unterschiedlich sein können: Denn, von „das passiert so gut wie nie“ bis „es passiert auch schon mal 3 mal am Tag und dann sogar für 1/2 Stunde“ ist es ein weites Feld. Da können dann schon 6 oder 10 zusätzliche kWh/(m²a) Verluste zustande kommen. Allerdings: selbst das würde die Energiewende nicht in Frage stellen; und der Effekt ist auch dann immer noch kleiner, als wenn z.B. auf die Wärmerückgewinnung aus der Fortluft verzichtet wird: Jenes summiert sich nämlich auf über 20 kWh/(m²a); und wie wir hier gerade gesehen haben, lohnt sich das selbst dann, wenn die Bewohner sich sehr nachlässig verhalten bzgl. des Offenstehenlassens von Außentüren. Das würde nur dann anders, wenn solche Türen eher dauerhaft offen stehen; weil letzteres ziemlich ungemütlich im Innenraum werden würde, kommt das auch so gut wie nie vor.
Discussing "Just stop Oil"
Alex O'Connor hat eine Diskussion aufgezeichnet, die ich ziemlich aufschlussreich finde333) . Alex spricht mit „James Skeet“, einem der Aktivisten einer Gruppe, die sich „Just Stop Oil“ nennt und die spektakuläre Aktionen unternimmt, um, wie sie selbst sich definieren „Auf den Klimawandel aufmerksam zu machen“. Es gibt eine Reihe weiterer Aktivisten mit ähnlichem Hintergrund, auch derzeit gerade in Deutschland. Das Video von Alex ist durchaus in der Lage, die ethischen Fragen in diesem Zusammenhang transparent zu machen - aber auch, zu illustrieren, worin die Probleme hier eigentlich liegen: Das wird im folgenden Kommentar beleuchtet.
- Der Katastrophenfall bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe: Das ist ernst! Dazu muss nur ein Blick auf die IPCC-Berichte geworfen werden. Nun, das ist nicht eine Gefahr für alles Leben auf dem Planeten. Aber es ist eine Gefahr für unsere menschlichen Zivilisation, wenn wir den derzeit eingeschlagenen Weg fortsetzen. Mit dazu gehören alle, die das erwähnte „van Gogh“-Gemälde hoch schätzen334) und alle Personen, die im Gespräch erwähnt wurden – aber auch die meisten Menschen, die nicht erwähnt wurden335) . Was die Gefahr betrifft, in der wir uns befinden, hat James Skeet Recht, möglicherweise sogar mehr, als ihm selbst „recht ist“.
'Just Stop Oil' with Alex O'Connor
- Was wir wirklich tun müssen, um diese gefährliche Entwicklung einzudämmen, ist die signifikante Reduktion der Kohlenstoffverbrennung; jetzt beginnend innerhalb weniger Jahrzehnte auf nahezu Null. Wenn wir dies nicht tun, dann kann dies nicht erst in 20 oder gar erst in 30 Jahren „korrigiert“ werden336) . Wenn wir das so weiter betreiben, dann wird es zu genau den katastrophalen Ergebnissen führen, von denen James Skeet spricht. Ein Umstand dabei wird von Nicht-Naturwissenschaftlern oft schwer verstanden: Das thermische System des Planeten hat eine Zeitkonstante von mehreren Jahrzehnten, d.h., es reagiert erst mit langer Verzögerung337) . Die viel zu hohen Emissionen, die wir jetzt ausstoßen, werden verheerende Folgen in den noch kommenden Jahrzehnten haben; diese sind damit zu diesem Teil schon jetzt determiniert: Zu dem Zeitpunkt, an dem die Folgen eintreffen, sind diese nicht mehr auf die Schnelle abzuwenden. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache – und sie scheint nicht verstanden zu werden. Darüber z.B. sollten wir reden. 338)
- Viele Kollegen aus allen Bereichen der (zumeist nicht-naturwissenschaftlichen) Wissenschaft scheinen die CO2-Emissions-„Diskussion“ als eine weitere 'interessante' Frage unterschiedlicher wissenschaftlicher Auffassungen zu betrachten: Wie die Diskussion, ob „die Evolution recht hat“ oder „ob Jesus identisch ist mit Gott oder Teil einer göttlichen Einheit.“ Sie scheinen den Unterschied in der Problemstruktur hier nicht zu erkennen, scheinen zu glauben, dass es eines von all den anderen Themen ist, zu denen Wissenschaftler unterschiedliche Meinungen haben können. Und deshalb denken sie, dass Bewegungen wie „Just Stop Oil“ den alten Endzeit-Predigern ähneln, jene, die immer mal wieder gesagt haben „Das Ende ist nah… tut Buße und kehrt um“. Es gibt zwei entscheidende Unterschiede:
(I) Beim Klimawandel liegt keine wissenschaftliche Kontroverse vor: Der Klimawandel ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache und er wird zu einer katastrophalen Entwicklung führen, wenn wir die Emissionspraxis nicht wesentlich ändern.
(II) Dies ist keine „Prophezeiung“, wie manche es nennen würden339) , sondern eine deterministisch berechenbare Entwicklung mit fast bei Sicherheit (99 %) eintretendem katastrophalen Ausgang340) .
Dies sollte allen klar sein, die Einfluss auf die Entscheidungen über den weiter von uns eingeschlagenen Weg haben. Das sind übrigens fast alle: Alle, die ihre Wohnung heizen, anders als zu Fuß unterwegs sind und/oder auch nur in hohem Maß tierische Nahrungsmittel verzehren. Das ist eine weiteres Thema, über das wir reden sollten – jedenfalls so lange, bis es einen Konsens in der breiten Öffentlichkeit gibt, der mit dem in der Wissenschaft übereinstimmt341) .
- Hier ist meine Kritik an den Aktionsformen, gerichtet an James Skeet: Was ich jetzt wahrnehme, auch aus den Ansätzen, den Alex in der Diskussion gewählt hat: Ja, die Aktionen von „Just Stop Oil“ provozieren offenbar Diskussionen. Das sieht nach „großem Erfolg“ aus, wenn der Erfolg in erzielter Aufmerksamkeit gemessen wird342) . Die Aktionen sind ständig in den Nachrichten - und jetzt sogar auf Alex O'Connors Youtube-Kanal. ABER: Was da jetzt diskutiert wird, das sind eben nicht die Themen, um die es geht (siehe die letzten Sätze in 1), 2), 3)), sondern diskutiert wird die Legitimität der Art der Maßnahmen, welche die Aktionisten ergreifen. Das ist eine Ablenkung. Es hilft sogar gerade jenen Akteuren, die versuchen, jedes Engagement zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu kriminalisieren: Sogar die Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet forschen, werden nicht mehr nur drangsaliert343) , sondern kriminalisiert. Ich glaube nicht, dass dies das Ergebnis ist, das durch die Aktionen beabsichtigt ist. Aber es ist das Ergebnis, das die großen Fossilkonzerne sich geradezu wünschen. Wenn Ihr das nicht so machen würdet, es wäre so ziemlich die beste Idee, mit der fossile Interessen wirksam die Öffentlichkeit ablenken und fehllenken können. - Der nun noch folgende Punkt „5)“ ist der eigentlich entscheidende: Denn „5)“ ist das Thema, über das wir wirklich reden müssen – das ist der Ansatz, der die Bedrohung zumindest abmildern kann.
- CO2-Emissionen hängen mit der Art zusammen, wie die meisten von uns in den entwickelten Ländern jeden Tag leben. Wir nutzen Benzin fürs Fahrzeug, verbrennen Öl in der Heizungsanlage, verbrauchen Strom aus Kraftwerken auf Basis fossiler Brennstoffe und essen Fleisch aus einer klimaschädlichen „Produktionslinie“344) . Ingenieure wissen, dass sich das jeweils ändern lässt: Wärmedämmung ist eine Maßnahme, Elektroautos sind eine andere, Wärmepumpen eine dritte und Windkraft und PV weitere. Diese Lösungen gibt es hier und jetzt. Die derzeit wichtigsten Entscheidungen bestehen darin, von den bestehenden nicht nachhaltigen „Nicht“-Lösungen auf diese bewährten nachhaltigen Lösungen umzusteigen: „Wärmedämmung der Gebäude“, „Wechseln auf Wärmepumpenheizung, wann immer Heizungen erneuert werden“, „Reduzieren von Fahrten mit Verbrennungsmotor so weit wie möglich“, „Reduzieren des Fleischkonsums (insbesondere von Rindfleisch) so weit wie es jeder zu tun bereit ist“, … Darüber hinaus brauchen die meisten dieser Änderungen Zeit, es kann einfach nicht alles in ein paar Jahren nachgeholt werden345) . Beispiel: Alle neuen Benzin/Diesel-Autos die jetzt noch gekauft werden, werden auch in 15 bis 20 Jahre noch gefahren werden. Sobald wir uns der Situation, in der wir uns befinden, wirklich bewusst sind, müssen wir über genau diese Themen sprechen; aber eben nicht nur reden, sondern auch danach handeln. Dieses Handeln muss keine Nachteile haben, die unsere Lebensqualität verringern. Darin liegt übrigens ein weiteres Kommunikationsproblem: Leider werden zu oft die Ansätze allein diskutiert oder überbetont, die in der Wahrnehmung vieler Menschen auf 'Verzicht' hinaus laufen. Das liegt auch daran, dass gerade auch viele der Klima-Aktivisten über andere Beiträge, die weitaus bedeutender sind, gar nicht informieren. Wir haben an anderer Stelle viele von denen zusammengestellt: Energieeffizienz JETZT!.
Ein Nachtrag ist fällig:
17. Oktober 2923: Natürlich noch kein Heizbedarf
Bis zum 13.10. (Freitag) war es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm in Darmstadt; ich denke, auch in den übrigen Häusern der K7-Siedlung in Darmstadt-Kranichstein346) hat da noch niemand heizen müssen. Seither sind die Temperaturen eher Oktober-typisch (unter 10 °C im Tagesmittel). Die Sonne bricht häufig mal durch, das sorgt dafür, dass es in allen Räumen schön warm bleibt (22 bis 25°C). Einen Bedarf für Heizung (oder Kühlung) gibt es unter diesen Umständen nicht - das Splitgerät war weiterhin dauerhaft aus.
20. Oktober 2023
Es wird herbstlicher; die Temperaturen im Tagesmittel liegen zwischen 11 und 14 °C - und heute war auch die solare Einstrahlung nicht besonders hoch. Das sind aber noch lang keine Bedingungen, unter denen die Temperaturen im Passivhaus merklich fallen. Die liegen weiterhin zwischen minimal 22 und maximal 24,4 °C. Aber klar doch: Heizen müssen wir dafür nicht. Auch die wenige diffuse Himmelsstrahlung und die Wärme von Personen und elektrischen Geräten reichen derzeit aus, alle Wärmeverluste auszugleichen. Im Oktober haben wir seit Fertigstellung aller Dämmmaßnahmen in 32 Jahren noch nie aktiv geheizt.
Beiratssitzungen zur 27. Internationalen Passivhaustagung abgeschlossen
Die nächste Passivhaustagung wird vom 5. bis 6. April 2024 auf dem Campus Technik der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck stattfinden. Es wurden 155 Abstracts eingereicht, die abschließende Sitzung des wissenschaftlichen Beirats fand heute statt. Von der Vielzahl hochwertiger Beiträge waren wir überwältigt: Es kann sein, dass wir letztlich mehr Abstracts zur Präsentation empfohlen haben, als das Tagungsteam organisatorisch unterbringen kann. Wie das dann gelöst wird - ich werde auch dazu etwas schreiben, so bald es Vorschläge dazu gibt.
Unter einem „richtig guten Beitrag“ verstehe ich die Darstellung eines Bauprojektes oder einer Energieeffizienz-Komponente:
- Das solide geplant und bereits fertig realisiert ist,
- von dem eine unabhängige Bestätigung der entscheidenden Eigenschaften vorliegt (z.B. Luftdichtheits-Koeffizient per Drucktest gemessen),
- das im Beitrag vollständig beschrieben wird und
- von dem praktische Erfahrungswerte der Erprobung in realen Bauprojekten vorliegt.
Dieses Jahr haben wir einige Gebäude, die bereits seit 10 und mehr Jahren in Betrieb sind und von denen Messdaten zu Wohnkomfort und zum tatsächlichen Verbrauch vorliegen. Insbesondere sind da auch energietechnische Modernisierungen dabei. Mit solchen Ergebnissen lassen sich wertvolle Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Energieeffizienz-Maßnahmen gewinnen. Genau das wird immer wieder Thema sein auf der kommenden Tagung. (Homepage der Tagung: Internationale Passivhaustagung).
28. Oktober 2023 (Sonnabend)
Kurz und schnell: Die Heizung ist natürlich immer noch aus, die Temperaturen im Haus nach wie vor für „kurzes Hemd“ geeignet; bei jetzt typisch herbstlichem Wetter, immer noch um 10°C Außenlufttemperatur, leider auch nur wenig Sonnenschein.
Energie im Überfluss (1)?
Das wird, inzwischen seit Jahrzehnten, immer wieder behauptet. Es gibt verschiedene 'Richtungen' dieser Illusion, die sich deutlich unterscheiden:
- Nicht verstandene Einordung der Größenordnung von Energieströmen.
- Nicht verstandene Begrenzungen der Verfügbarkeit mancher durchaus vorhandener - aber eben nicht zugänglicher - Energiequellen.
- „Einhorn“-Technologien: Hoffnung auf die zeitnahe Erschließung hochenergetischer Prozesse - die aber noch viele technologische Probleme bergen (z.B.: Anzapfen von Rotationsenergie eines schwarzen Loches).
Hier gehe ich erst einmal auf den „Typ 1“ ein
Beispiel: Auf einer Podiumsdiskussion wurde von einem geladenen „Experten“ gesagt:
„Energie ist doch gar kein Problem. Ich habe gehört, jetzt machen sie sogar Energiegewinnung aus dem Tanzboden. Wir haben solche Überflüsse an Energie.“
Durch eine schnelle Abschätzung347) können wir Folgendes erkennen:
Wir wollen eine Obergrenze für die so gewinnbare Energie abschätzen:
- Gehen wir davon aus, dass zwei Drittel aller Menschen alle zwei Tage für jeweils 3 Stunden auf so einem Tanzboden mit Energiegewinnung tanzen (!). Im Durchschnitt „tanzt“ jeder Mensch dann dort zu 2⁄3·3h/24/2d = 1 Stunde pro Tag.
- „Tanzend“ kann ein gut trainierter Mensch durchaus mechanisch bis zu etwa 700 Watt eine Minute durchhaltend erzeugen. Eine ganze Stunde und 2⁄3 der Bevölkerung? 400 Watt sind dafür ein sehr großzügiger Ansatz348) .
- Der Mechanismus der Energiegewinnung aus einer so erzeugten Resonanzschwingung des Bodens - der könnte, sehr optimistisch betrachtet, 75% Wirkungsgrad haben.
Die so maximal pro Person an einem Tag gewinnbare Energie ist dann:
$ E_{Tanz,max}= 400 $ W $ \frac {2}{3} \cdot \frac {3 h }{ 2 d} \cdot 0,75 = 300 $ Wh/d
Das ist jeden Tag 30% einer Kilowattstunde; 'verbraucht' werden derzeit bezogen auf eine Person in Deutschland etwa 96 Kilowattstunden am Tag: Das ist das etwa 320-fache der aus dem menschlichen Tanzvergnügen maximal gewinnbaren Energie.
Ein paar ergänzende Bemerkungen:
a) Es ist auch nicht so, dass sich das zu noch Hundertmal solcher Art Energiegewinnung aufmultiplizieren könnte - denn, wer tanzt wird in aller Regel nicht gleichzeitig am Amboss Hufeisen schmieden349) .
b) Es illustriert vor allem, wie gigantisch hoch unser derzeitiger zivilisatorischer Energieverbrauch im Vergleich zur potentiellen Leistungsfähigkeit der Menschen selbst ist. Genau dies wollte uns die Gilde der Energieingenieure schon seit Jahrzehnten immer wieder erklären, und in Bezug auf den derzeitigen Verbrauch haben sie damit auch Recht. Es ist ein physikalisch faktisch: Die heute in der Zivilisation umgesetzte Energiemenge liegt im Bereich des 100-fachen dessen, das von den Menschen, die die so gewonnenen Dienstleistungen genießen, maximal verwertbar geleistet werden könnte. Nicht recht hat diese Gilde in der selbstverständlich getroffenen Annahme, dass das gar nicht anders geht, dass dieser hohe Energieverbrauch ein Segen ist, unverzichtbar und die Dienstleistungen nicht auch auf anderen Wegen gewinnbar350) .
c) Von der anderen Seite her kommend: Die prinzipiell verfügbaren 300 Wh/d, das würde tatsächlich z.B. für den Betrieb eines effizienten Mobiltelefons mit „smarten“ Funktionen und für die Beleuchtung auch im Winter ausreichen. Damit kann ich dann meine Email-Korrespondenz machen, die Nachrichten abrufen, den software-Taschenrechner nutzen, Fotografieren und sogar ab und zu ein Video anschauen. Gewinne ich die genannten Dienstleistungen mit meinem Desktop-PC (80 W), betrieben 8 h am Tag (aber ohne Standby, „aus heißt aus“, d.h. richtig abgeschaltet) dann braucht das bereits 640 Wh/d. Schon das ist kaum noch durch menschliche Arbeit zu ermöglichen351) . Was dies nun zeigt: Ein hocheffizientes modernes Mobiltelefon ist um rund einen Faktor 50 energieeffizienter als der dicke PC. Mit besserer Energieeffizienz können wir für eine Reihe von Anwendungen somit durchaus näher an das menschliche Maß der Leistungsfähigkeit herankommen. Umfassend dargestellt wird das unter unserem Beitrag zur Energieeffizienz.
d) Da wir durch Fotovoltaik und über Windkraft durchaus in der Lage sind beträchtliche Leistungen bereit zu stellen, welche die menschlich-physische Leistungsfähigkeit bei weitem übersteigen, haben wir aber tatsächlich ein gewisses Potential für 'Mehr-Dienstleistungen' ohne alle Effizienzpotential bis zum letzten Joule ausnutzen zu müssen und ohne den Planeten unüberwindbarer Problem aussetzen zu müssen. Heute beträgt das Tagesmittel der aus Erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie bereits rund 17,5 kWh pro Tag und Person352) . Das sind schon jetzt rund 18% des gesamten Verbrauchs. Dies ist sicher noch steigerungsfähig, der Aufbau einer entsprechenden neuen Infrastruktur ist aber weder eine Kleinigkeit noch in wenigen Jahren abschließbar. Erleichtert wird dies dadurch, dass wir zumindest Teile der Effizienzpotentiale nutzbar machen. Das sei wieder am Beispiel der PC-Leistung illustriert: Auf unter 0,5 Watt pro Person, so, wie das heute mit „Mobiltelefon“-Technologie möglich wäre, müssen wir gar nicht überall herunter kommen. Nur 16 Watt 353) sind aber innerhalb von ca. 15 Jahren erreichbar, wenn die PC's auf effiziente Chips und die Bildschirme auf 'elektronisches Papier' umgerüstet werden; die Technologien dafür sind alle vorhanden und die entsprechenden Systeme werden in diesem Betrachtungszeitraum derzeit mehr als einmal erneuert354) .
e) Der Bezug zu einer 'persönlichen Solaranlage', z.B. 5 m² je Person „Balkon-solar“ wird hier noch hergestellt. Im Sommer liefert diese Anlage rund 4,5 kWh am Tag - das ist dann mehr als selbst ein heutiger durchschnittlicher Haushalts-Stromverbrauch einer Person. Im Dezember freilich schmilzt die Erzeugung auf rund 750 Wh/d zusammen; das reicht dann schon für den Normalbetrieb eines heutigen durchschnittlichen PCs. Ein energieeffizienter PC allerdings kann gut damit laufen und es bleibt dann sogar weiterer Strom übrig, z.B. für die Beleuchtung oder den Kühlschrank. Knapp bleibt das im Winter, auf PV allein können wir dafür nicht setzen; deshalb empfehlen wir den Anschluss an das Stromnetz, dort speisen Windkraft, Wasserkraft, Pumpspeicherkraftwerke und Biomasse-Stromerzeuger auch im Winter ausreichend erneuerbare Energie ein. Zumindest wird das in den nächsten Jahren erheblich zunehmen.
Wenn wir uns die Größenordnungen der hier behandelten Energieströme ansehen, dann ergibt das eine gute Perspektive: Eine Energiewende zur CO2-freien Struktur rückt mit der Kombination von ernsthaft verbesserter Effizienz und entscheidendem Ausbau erneuerbarer Quellen in greifbare Nähe.
29. Oktober
Heute gab es einmal Regen im Überfluss. Die Temperaturen liegen immer noch außen zwischen 10 und 13 °C - da es heute aber durchgehend dicht bewölkt war, kam auch kaum Sonnenenergie herein: Selbst die Fotovoltaikanlage hat weniger als 0,6 kWh über den Tag geliefert. Unter diesen Umständen verliert unser Passivhaus rund 0,1 K (°Grad Kelvin) am Tag. Das wäre dann immer noch lang hin, bis die Heizung eingeschaltet werden müsste (rund 16 Tage). Wir wissen allerdings aus früheren Jahren, dass auf den Regen auch im Herbst wieder Sonnenschein folgt - und das reicht dann in der Regel aus, das Haus nochmal um zusätzliche 1 bis 2 K aufzuwärmen.
Energie im Überfluss(2): Gern geglaubte Irrtümer
Vollständig kann die folgende Erläuterung nicht sein - all die Irrungen und Wirrungen, die immer wieder gerade zum Thema „Energie“ verbreitet werden, sie sehen immer wieder nach etwas „ganz Neuem“ aus; auch wenn sie das dann bei genauerem Hinschauen oft gar nicht sind. Meist sind es nämlich Varianten der beiden im Folgenden behandelten Irrwege: (2a) Dem Missverständnis bzgl. des Energiesatzes oder seine Ablehnung aus Prinzip. Und (2b) dem Missverständnis bzgl. des zweiten Hauptsatzes oder dessen Ablehnung aus Prinzip. Unter Naturwissenschaftlern, die das in den Grundzügen verstanden haben, müsste ich dazu nun gar nicht mehr viel schreiben: Denn, es ist aus ganz fundamentalen Gründen klar, dass aus solchen Ansätzen nichts in der Praxis Wirksames werden kann. Da ich hier versuche, diese Dinge auch für Menschen ohne tiefere Physik-Ausbildung verständlich zu machen, gehe ich darauf aber ein und zwar so, dass das für alle mit dem Wunsch nach einer aufklärenden Darstellung hilfreich ist355) .
(2a) Missverständnisse zum Energiesatz
Die gibt es in vielen unterschiedlichen Ausprägungen, ich werde auf ein paar Beispiele eingehen.
(I) Die kostenlos dauernd laufende Maschine, die auch noch Energiegewinne abwirft. Physiker nennen so etwas ein „Perpetuum Mobile“, genauer ein solches der 1.Art: Genau das wird nach dem Energiesatz nämlich 'verboten'; wobei, wie immer in den Naturwissenschaften, „Verbot“ hier heißt, dass so etwas eben einfach nicht geht, das Verbot kann also gar nicht übertreten werden, auch wenn der Gesetzesbrecher sich noch so große Mühe gibt. Leider gibt es auch hier jede Menge Verwirrung, leider oft auch gerade von geltungsbedürftigen Kollegen bewirkt, die auch auf Youtube-Kanälen nicht müde werden, 'modernste' denkbare Effekte unter extrem seltsamen Bedingungen, so zu vermarkten, als ob diese bisher als fundmental gedachte Grundaussagen der Physik generell in Frage stellen würden, auch wenn die neuen Interpretationen in vielen Fällen nur Spekulation sind356) . Stellen wir also zunächst einmal dieses klar:
Unter den makroskopischen Umgebungsbedingungen357) , die in der Nähe der Aufenthaltsbereiche von Menschen vorliegen, und innerhalb der Systemgrenze „Ökosphäre“ der Erde gilt der Energiesatz oder 1. Hauptsatz der Thermodynamik praktisch uneingeschränkt358) . Selbst wenn davon künftig sich doch Abweichungen herausstellen sollten359) , dann könnten diese Abweichungen nur so klein sein, dass sie keine für die Zivilisation relevante Energieströme liefern könnte.
Warum sind Physiker denn darin so sicher?
Diese Sicherheit hat einen Namen: Emmi Noether . Eine mathematische Physikerin, die einen grundlegenden Zusammenhang aufgedeckt hat, der unser Verständnis der Welt ganz maßgeblich erweitert hat. Emmi Noether hat bewiesen, dass es beim Vorliegen von Symmetrien in der Natur immer einen zu der betreffenden Symmetrie gehörenden Erhaltungssatz für eine messbare physikalische Größe gibt. Diesen Zusammenhang kann man mathematisch streng beweisen - in der Quantenmechanik geht das sogar einfacher als in der klassischen Formulierung, aber auch da ist das (streng!) korrekt360) .
Jetzt kommts: Wer zweifelt an, dass ein morgen (oder übermorgen oder in einem Jahr) unter ansonsten gleichen Bedingungen verlaufender Vorgang jeweils zu den gleichen physikalisch manifestierten Ergebnissen führt361) ? Diese Symmetrie nennen wir die zeitliche Translationsinvarianz: Es ist egal, ob ich das Experiment an einem anderen Tag (aber unter gleichen Bedingungen) ausführe. Der Alltag der Menschen fasst dies übrigens seit Jahrzehntausenden als selbstverständlich auf: Ich erwarte, dass der Lichtschalter meinen Nachtischlampe morgen noch da ist, wo er immer schon war oder dass das Auto morgen so anspringt wie gestern oder vor acht Tagen. Passiert das einmal nicht362) , dann zweifeln wir nicht etwa an den Regeln der Natur, sondern vermuten irgendeinen disruptiven Einfluss - 'jemand' hat den Schalter zerbrochen oder Benzin aus dem Tank geklaut. Das ist für uns geradezu selbstverständlich, und aus gutem Grund. Denn tatsächlich hat noch nie jemand glaubwürdig einen Vorgang dokumentiert, bei dem es nicht so war; so etwas nennt sich dann ein „Wunder“ und auf Wunder wird kaum jemand ernsthaft eine Energieversorgung aufbauen wollen, die so wichtige Dinge wie unsere Autos, Waschmaschinen und Heizungen versorgen muss.
Die oben erwähnte Erhaltungsgröße, die nach Emmi Noether zu dieser Symmetrie der zeitlichen Translationsinvarianz gehört ist: die Energie. Tatsächlich sind der Energiesatz und die Erwartung, dass die Dinge morgen so funktionieren werden wie gestern und heute, zueinander gleichwertig363) . Vor einem solchen Hintergrund wird denke ich klar, warum Physiker, mit einer Perpetuum Mobile Idee konfrontiert, fast schon ohne näheres hinsehen mit „Unsinn, das kann nicht funktionieren“ reagieren. Denn, ginge es dabei nur um eine abstrakte Gleichung wie dem Energieerhaltungssatz, der allerdings auch empirisch bisher noch nie verletzt wurde, dann wäre so etwas zwar immer noch recht unwahrscheinlich - aber im Grundsatz trotzdem 'denkbar'. Es müsste wirklich nur besonders schlau herumgetrickst werden. Mit der Translationsinvarianz in der Zeit ist das eine ganz andere Sache: Die ist nicht nur einige Hundertmillionen mal in Laborexperimenten bestätigt364) , sondern Zig-Billionenfach in jeder alltäglichen Erfahrung seit Menschengedenken. Auch das macht eine Verletzung nicht völlig unmöglich, aber doch so gut wie ausgeschlossen. Eben noch unwahrscheinlicher als dass ich morgen statt in meinem Bett in den Sümpfen eines anderen Planeten in der Andromeda-Galaxie aufwache. Derart unwahrscheinliche Vorgänge interessieren unter normalen Umständen nicht, allenfalls in einem schlechten Science-Fiction.
Nun zu den Irrtümern in der Anwendung
Die Skizzierung angeblicher Apparate, die als Perpetuum mobile aufwandslos Energie liefern sollen: Oft ist der Denkfehler bei diesen Apparaten gar nicht so einfach zu entdecken, wir 'arroganten Physiker' wissen aber schon, dass er wird entdeckt werden können365) . Es gibt inzwischen eine Reihe von Webseiten engagierter Naturwissenschaftler, die sich das Debugging von solcherlei Unsinn zur Aufgabe gemacht haben; ganz vorn dabei „the Mythbusters“ und BadAstro von Phil Plait.
Beispiel 1: Der blanke Betrug - immer wieder, manchmal auch als Scherz aufgeführt. Da sitzt dann z.B. ein kleinwüchsiger Mensch in einem verborgenen Hohlraum oder es ist im Innern eine aufgezogene Feder oder neuerdings auch eine Batterie versteckt - auch Apparate, denen über elektromagnetische Wirkungen Energie zugeführt wird können sich 'anscheinend' von selbst bewegen: In Wahrheit eine elektrische oder Magnetkopplung366) oder von einem Sender eingestrahlte Energie, auch Lichtenergie wird zum Antrieb eingesetzt367) . Das ist so beim überwiegenden Teil der Apparate.
Beispiel 2: Es gibt aber tatsächlich Apparate, die seit Jahrzehnten dauerhaft laufen und die, oberflächlich betrachtet ein „Perpetuum Mobile“ sind. Bei systematischer Analyse haben Ingenieure erkannt, dass diese z.B. thermische Energie aus einem im Raum bestehenden Temperaturfälle beziehen: So ist beispielsweise der Boden kälter als die Decke und aus dem so verfügbaren Wärmestrom lässt sich368) ein wenig Energie gewinnen, die dann ausreicht, das System zu betreiben. Ein anderes Beispiel dieser Art wird hier ausführlich beschrieben: der sich dauerhaft bewegende Trinkvogel; das ist eine kleine Wärmekraftmaschine, die sich aus der entzogenen latenten Wärme von verdunstendem Wasser aus dem Filz am Kopf des Vogels speist. Ich habe kurz überschlagen, wie groß die Energieströme sind, die hier im Spiel sind: Es wird eine durchschnittliche mechanische Dauerleistung von weniger als einem halben µW (mikro-Watt = 0,000 001 W) umgesetzt. Von „Energie im Überfluss“ kann dabei somit nicht die Rede sein: Wohl von einer hocheffizienten kleinen Maschine, die Verblüffendes zeigt - und durchaus z.B. für den Betrieb einer Uhr oder eines anderen Informationsprozesses eingesetzt werden könnte - sofern der betreffende Prozess selbst auch hocheffizient ist.
Bilanzielles Perpetuum Mobile durch Energieeffizienz
Bei allen diesen Beispielen ist die versteckt aufgebrachte Energie sehr gering: Die Apparate sind somit durchaus in einer Form gebaut, dass sie in ihrem normalen Betrieb sehr wenig 'Energie brauchen', bzw., zutreffender formuliert, Energie verlieren. Wir haben an anderem Ort diskutiert369) , dass die physikalischen Gleichungen370) eine unbegrenzt anhaltende Bewegung durchaus erlauben würden - nämlich dann, wenn die Energieverluste auf „Null“ reduziert würden. Es gibt tatsächlich technische Systeme, bei denen das annähernd funktioniert: Ein Strom in einer supraleitenden Spule z.B.; oder, weitaus 'dramatischer' die dauerhafte Bewegung des Planeten Erde in seiner Bahn um die Sonne - bei letzterem muss schon sehr genau gemessen werden, um auch dort auftretende Energieverluste nachweisen zu können371) ; die gibt es, sie sind aber so gering im Verhältnis zur vorhandenen Bewegungsenergie, dass das schon viele Milliarden Jahre gut gegangen ist.372)
Allerdings illustriert der letzte Abschnitt auch, dass gerade der Energiesatz es uns im Prinzip erlaubt, eine Bewegung zwar nicht auf Ewigkeit, aber doch nahezu beliebig373) lang aufrecht zu erhalten, OHNE ständig neu Energie zu zu führen. Dazu müssen nur die Verluste der betreffenden Systeme sehr klein gehalten werden. Das Praxisbeispiel ist die Bewegung einer Masse magnetgelagert in einem evakuierten Behälter374) . Die Verringerung von Energieverlusten lässt uns so tatsächlich sehr nahe an ein Perpetuum Mobile heran kommen, einige der zuvor beschriebenen Apparate nutzen das tatsächlich aus. In "Energieeffizienz - das große Ganze" gehen wir darauf ein, dass dieser Ansatz zur systematischen Reduzierung von Verlusten tatsächlich in allen Anwendungsbereichen von Energie ein gigantisches Potential hat375) . Dabei kommt es nur auch wieder auf den Aufwand an, der bei einer solchen Umsetzung getrieben werden soll: Der Wärmeverlust eines Hauses über die Außenwand 'könnte' natürlich noch von rund 0,15 W/(m²K) wie beim Passivhaus auf unter 0,01 W/(m²K) abgesenkt werden und so gebaute Objekte würden dann nur noch im wenige-Watt-Bereich etwas Regelenergie benötigen. So weit müssen wir diese Dinge aber gar nicht treiben, weil es im Bereich von mehrere-100-Watt z.B. für einen Wärmepumpenbetrieb künftig dauerhaft verfügbare Erneuerbare Energiequellen gibt.
Hochinteressant ist die hier gewonnene Erkenntnis allerdings schon: Vor dem Hintergrund einer extrem energieverschwendenden Wirtschaftsweise wirkt jede Reduktion der dabei auftretenden Energieverluste als „negativer Verlust“, d.h. vom Vorzeichen her als Energiegewinn (ohne zusätzlich angezapfte Fremdenergie). Bezogen auf das Verbrauchsniveau der bestehenden Wirtschaftsweise wirkt Energieeffizienz bilanziell wie ein Perpetuum Mobile; das wäre dann eine Betrachtungsweise wie der Fluss von positiv geladenen Elektronenfehlstellen („Löchern“) in einem p-dotierten Halbleiter376) .
Fazit: Keine grandiosen Überraschungen zu erwarten
Auch wenn viele sich darauf gern Hoffnungen machen - denn es wäre ja so schön - aus Verletzungen des Energiesatzes werden sich auf absehbare Zukunft377) keine irgendwie nennenswerten Energieströme gewinnen lassen. Noch unerschlossene Bespiel wie den „Trinkvogel“ (siehe oben) wird es durchaus auch künftig möglicherweise geben; diese werden aber vor allem auf sehr weit entwickelter Energieeffizienz-Technologie beruhen, es werden dabei nur extrem geringe Energieströme fließen.
Das kann für manche Einzelfälle durchaus praktisch relevant werden: Das „elektronische Papier“ ist ein Beispiel dafür. Hier wird eine umschaltbare aber doch sehr dauerhafte Anzeige nahezu ohne Energieaufwand erreicht: Auch große Anzeigegeräte werden damit das Stromnetz nicht mehr belasten - das ist nur ein virtuelles-Perpetuum-Mobile, in Wirklichkeit handelt es sich um das Vermeiden der Verluste heute bestehender eher ineffizienter technischer Systeme. Natürlich benötigen auch die hocheffizienten Anwendungen irgendwo wieder einen gewissen Aufwand: Diese mikroverkapselten elektrophoretischen Medien müssen natürlich zunächst produziert werden; allerdings, andere Bildschirmtechniken durchlaufen ebenfalls eine Produktionsphase.
Eine Energiebereitstellung im Überfluss (das war unser Thema) wird es mit solchen Ansätzen nicht geben; sie weisen aber wieder eine Weg zur eigentlichen Problemlösung - nämlich der systematischen Vermeidung von Energieverlusten. Die dann nur noch sehr geringen Energieströme, die für die gewünschten Dienstleistungen eigentlich nur erforderlich sind, lassen sich in jedem Fall - und dann sogar ganz einfach - aus nachhaltig verfügbaren Quellen decken.
(2b) Missverständnisse zum zweiten Hauptsatz
Das ist nun ein etwas anspruchsvolleres Thema: Denn, trotz aller Mühe der Physiklehrer ist ein wirkliches Verständnis der Aussagen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht gerade weit verbreitet. Dabei ist dieses fundamentale physikalische Gesetz zunächst sehr einfach zu formulieren:
| Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik Ein Netto-Wärme-Fluss von einem System mit niedrigerer Temperatur zu einem solchen mit höherer Temperatur findet von selbst nicht statt. | Wir brauchen für das Folgende eine Formulierung, welche die Gewinnung von hochwertiger mechanischer Energie aus Wärme beschreibt; dazu benötigen wir folgende Systeme: Ein Kraftwerk ist im Folgenden eine Maschine, deren Zweck darin besteht, Wärme in Arbeit umzuwandeln und die sich dazu einer Wärmequelle bedient. Ein Reservoir ist ein thermodynamisches System, das seinen Zustand konstanter Temperatur auch bei Entnahme und Zufuhr von Wärme beibehält378) . Die maximal gewinnbare Arbeit $W$ aus der dem oberen Reservoir entnommenen Wärme wird durch den Carnot-Wirkungsgrad begrenzt; Sie beträgt $\eta_{Carnot}\cdot Q$. Dabei ist $\eta_{Carnot}$: ${\displaystyle \eta_{Carnot}=1-\frac{T_c}{T_h}}$ |
Der erste Teil ist ganz einfach zu verstehen: Es kann z.B. der Fall sein, dass ich ein gewissermaßen gigantische Reservoir an Wärmeenergie verfügbar habe; eben tatsächlich jede Menge „Energie im Überfluss“. Wir können als konkretes Beispiel die Energie, die in der Wärmekapazität der direkt unter uns liegenden Erdschichten steckt, anführen. Auch wenn wir erstmal nur bis ca. 100 m Tiefe gehen, dann ist deren absolute Temperatur keinesfalls „Null“. Und das bedeutet, dass die dort gespeicherte thermische Energie für viele Jahrzehnte ausreichen würde, uns alle mit einem Energiestrom in der Höhe des heutigen Verbrauchs zu versorgen - auch wenn wir dieses Erdreich dafür 'nur' um 20 Grad abkühlen würden379) . Das funktioniert nun tatsächlich überhaupt nicht und der wesentliche Grund dafür ist der oben aufgeführte zweite Hauptsatz: Um aus einem wenn auch riesigen Reservoir Energie entnehmen zu können, braucht es nämlich ein weiteres Reservoir mit einer vergleichbar hohen Kapazität ABER einer niedrigeren Temperatur. Sonst können wir die im Erdreich verfügbare Energie gar nicht dazu bewegen, aus diesem herauszukommen - sie fließt ja nur von Systemen höherer Temperatur zu solchen mit einer niedrigeren. Ein Kraftwerk braucht immer zwei Reservoire.
Wie es dann doch funktionieren kann
Nun kann das zweite Reservoir z.B. eine Erdreichschicht in einer anderen Tiefe mit einer anderen Temperatur sein; die 20 Grad mehr, von denen wir vorhin geredet haben, liegen unter durchschnittlichen Verhältnissen in ungefähr 660 m Tiefe tatsächlich vor. Dieses tiefere Erdreich dort zu erschließen, das ist dann allerdings bereits mit einem gar nicht so kleinen technischen Aufwand verbunden: Es gibt tatsächlich Ansätze, welche die Erschließung der sog. geothermischen Energie betreffen. Gehen wir einmal davon aus, dass uns das mit entsprechenden Bohrungen gelingt und wir tatsächlich zwei Temperaturniveaus von 12 °C (in 60 m Tiefe) und von 32 °C (in rund 660 m Tiefe) erschlossen haben. Wir können dann mit der Formel für den Carnot-Wirkungsgrad
${\displaystyle \eta_{Carnot}=1-\frac{T_c}{T_h} = 1-\frac{(12+273,15) K}{( 32+273,15) K} =}$ = 1 - 93,4% = 6,6%
die so theoretisch maximal gewinnbare mechanische oder elektrische Energie bestimmen. Nur rund 6,6% der vorhanden thermischen Energie wäre auch bei idealen Wirkungsgraden gewinnbar380) . Aus den oben dargelegten „vielen Jahrzehnten ununterbrochener Energie im Überfluss“ werden damit deutlich weniger als 6 Jahre, nach der sich diese Schichten in den Temperaturen angeglichen haben und das so konstruierte Kraftwerk daher nicht mehr läuft. Im Anschluss müssten andere (sinnvollerweise tiefere) Schichten erschlossen werden. Technisch grundsätzlich machbar ist das schon - es wird aber auch deutlich, dass es einen fortdauernden Aufwand für immer wieder neue Erschließungen notwendig macht. Geothermische Energie kann dabei durchaus künftig einen gewissen Beitrag zur Energieversorgung leisten; die zugehörigen ökologischen Bedingungen und der erforderliche ökonomische Aufwand wird dabei von den Fachleuten in diesem Bereich diskutiert: Schon die kurzen Überlegungen hier stimmen mit der dabei weitgehend konsensfähigen Einschätzung überein, dass diese Energiequelle nicht ganz einfach und schnell überall im Überfluss erschließbar ist, sondern vor allem an dafür gut geeigneten Standorten und dort mit einem zu anderen erneuerbaren oder auch fossilen Energieträgern vergleichbaren381) Kosten verbunden sind. Einzelne besondere Situationen mit ganz leicht erschließbarer Geothermischer Energie liegen an wenigen besonderen Standorten wie z.B. Island vor. Die jeweiligen Kosten und Umweltrisiken müssen für jedes Einzelprojekt sorgfältig abgeschätzt werden - die geothermische Energiegewinnung ordnet sich so in das Gesamtfeld der Energiequellen-Erschließung ein, sowohl bzgl. der Potentiale382) , als auch bzgl. der Kosten383) und bzgl. der Umweltauswirkungen384) .
'Oberflächennahe Geothermie' und Wärmenutzung
Ein alternativer Ansatz ist die Nutzung des Wärmeinhalts von Bodenschichten direkt als Wärme: Dazu sind geringere Bohrtiefen ausreichend, weil Wärmeströme mit niedrigeren Temperaturen dafür ausreichen. Dabei ist sowohl an direkte Beheizung (über ein Fern- oder Nahwärmenetz) als auch an Quellwärme für Wärmepumpen zu denken. Hierzu liegen inzwischen weit gestreute Erfahrungen vor: Prinzipiell ist eine solche Nutzung nahezu überall möglich; allerdings ist die Erschließung der Erdwärme teurer als z.B. die Wärmeentnahme aus der Außenluft. Dafür sind die Arbeitszahlen (COP-Werte) für Erdwärmepumpen höher (zwischen 3,5 und bis zu 5) als für Luftwärmepumpen (zwischen 2,2 und 3,4). Die Frage, ob sich die höherwerte Wärmequellenerschließung lohnt, muss im einzelnen Fall geklärt werden.
Immer wird für die Wärmepumpe vor allem eine Versorgung des Antriebs des Kompressors mit elektrischer Energie gebaucht. Das definiert den eigentlichen Energieverbrauch des Systems und für die erreichbaren Arbeitszahlen kann wieder der zweite Hauptsatz der Thermodynamik angewendet werden (siehe oben); die Carnot-Formel muss dann nach dem Wärmeenergiestrom aufgelöst werden.
1. November 2023: Übersicht zum Oktober
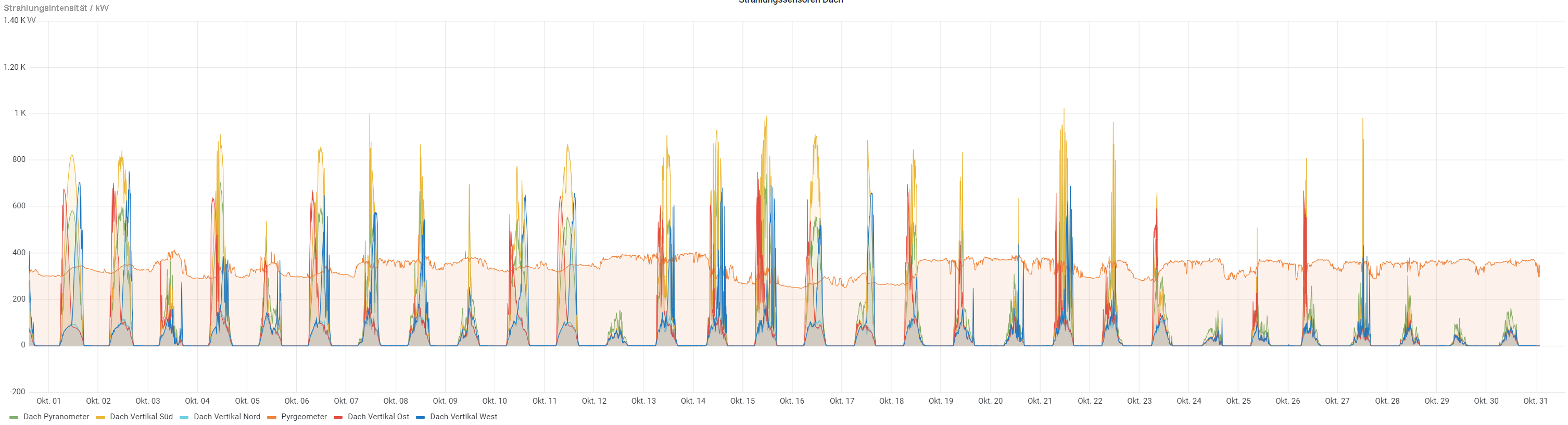
Abbildung: Der Oktober 2023 hatte ein hohes Strahlungsangebot, das ist an den vielen Tagen mit hohen Einstrahlleistungen zu erkennen. Auch unsere PV-Anlage hat eine hohen Ertrag gebracht: 150,14 kWh war die Summe im Oktober, das sind gut 2⁄3 des gemessenen Haushaltsstromverbrauchs im gleichen Zeitraum. Mit einer größeren Anlage wäre der Stromverbrauch daher noch zu decken - im Oktober; allerdings ändert sich das für die Monate November bis Februar im Kern der dunkleren Jahreszeit; das macht noch einmal deutlich, warum bei den erneuerbaren Energiequellen insbesondere auch die Windkraft mit hohem Engagement erschlossen werden muss385) . Das hohe solare Strahlungsangebot sorgt aber auch für die Verfügbarkeit von passiv solarer Energie im Haus, die vor allem über die Südfenster hereingelassen wird. Das sorgt im Oktober noch dafür, dass die jetzt schon nennenswerten Wärmeverluste immer noch durch freie Wärme ausgeglichen werden können. Für die Einordnung der Wärmeverluste kommt es auf die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen an - deshalb zeigt das nächste Diagramm den Verlauf der Außentemperaturen.
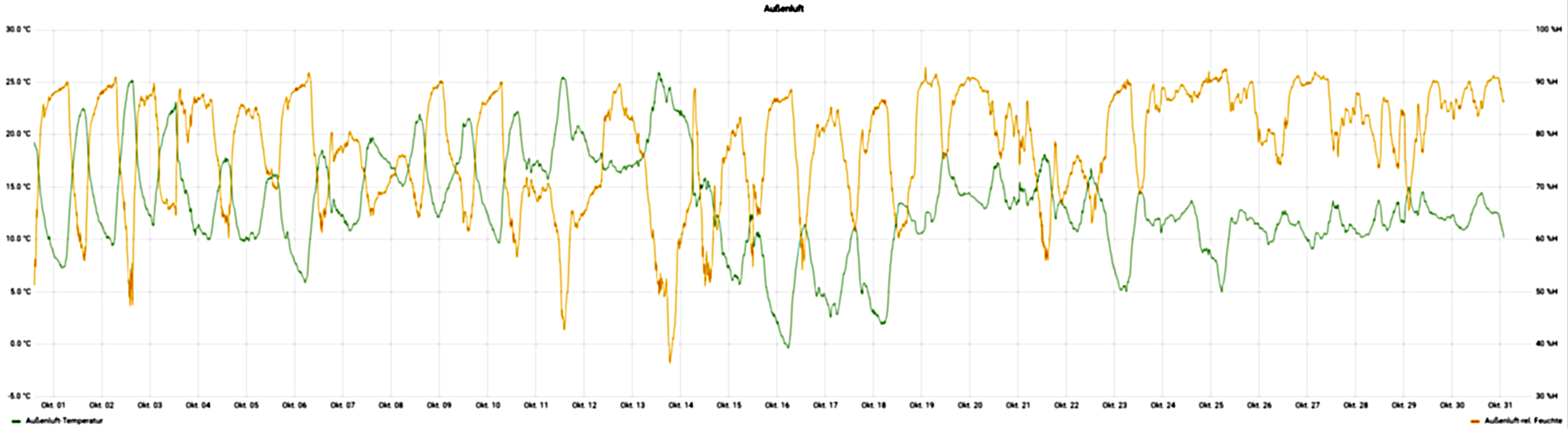
Abbildung: Bis zum 14. Oktober war es am Standort immer noch sommerlich warm. Dann gingen die Temperaturen spürbar zurück, auf ein Niveau von um und knapp über 10°C - für die Jahreszeit ist das aber immer noch untypisch warm. Der deutsche Wetterdienst schreibt „Das Temperaturmittel lag im Oktober 2023 mit 11,9 Grad Celsius (°C) um 2,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.“ Die Folgen der Klimaveränderung sind in den letzten Jahren bereits sehr deutlich erkennbar. Für die Heizung der Wohnungen heißt das, das der Verbrauch geringer als früher üblich ausfällt - in Passivhäusern wird allerdings ohnehin im Oktober in aller Regel noch keine aktive Heizung benötigt und auch in diesem Gebäude war es so: Das gilt nicht nur für unsere Wohnung (die Split-Wärmpumpe war den gesamten Oktober hindurch „aus“), es gilt auch für die drei weiteren Wohnungen, die derzeit noch über ein zentrales Gas-Brennwert-Gerät mit Wärme versorgt werden. Diese zentrale Anlage ist auch heute immer noch auf „Sommerbetrieb“ eingestellt, d.h., der Gasbrenner geht nur ab und zu zur Nachheizung der Trinkwarmwasser-Versorgung an386) .
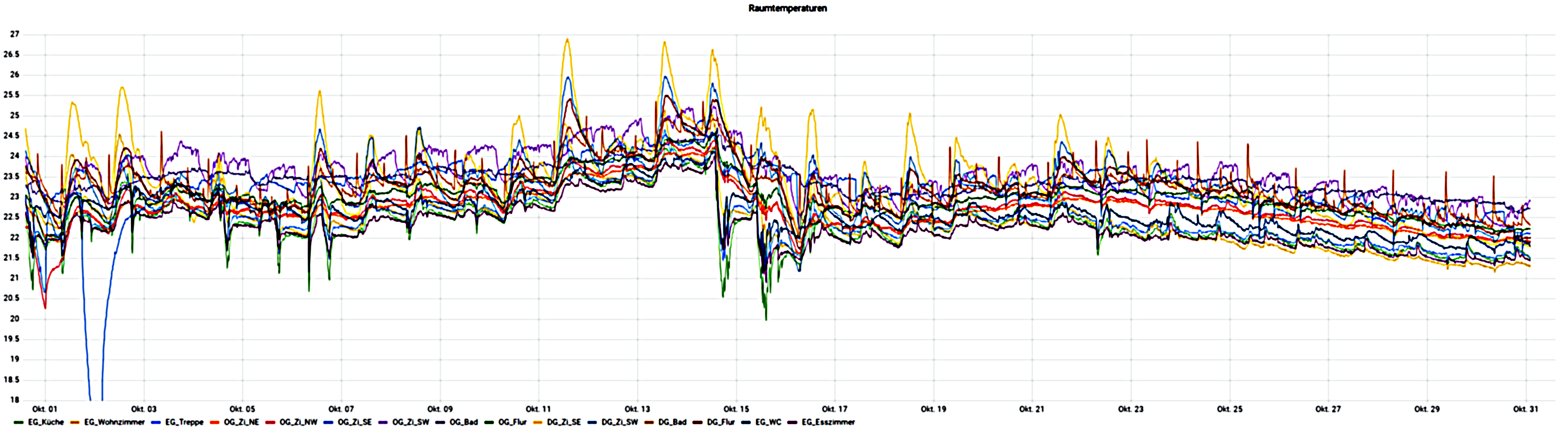
Abbildung: Bis zum Wetterumschwung lagen die Temperaturen im Haus bis auf wenige, kurzzeitige Ereignisse zwischen 21 und 25 °C; ein Extremereignis am 1. Oktober diskutieren wir mit der nachfolgenden Abbildung genauer. Inzwischen haben sich die Temperaturen zwischen 21,2 und 24 °C eingependelt; gute Behaglichkeit ist so auch ganz ohne Heizung gewährleistet und eine Kühlung wird selbstverständlich auch nicht gebraucht. Dies so aufrecht zu erhalten, dafür ist gerade zu Beginn der kälteren Jahreszeit die Lüftungsanlage mit der Wärmerückgewinnung von insgesamt über 85% sehr hilfreich: Frische Luft wird natürlich gebraucht und die kommt über die Zuluft auch dann in für die Gesundheit optimalem Umfang dorthin, wo sich die Personen vor allem aufhalten. Diese Luft ist aber durch die Wärmerückgewinnung nicht kalt, sondern liegt derzeit bei rund 21 °C, d.h. im Bereich der komfortablen Raumtemperaturen. Es gibt somit keine kalten Luftströme, wie sie bei einem Luftaustausch ohne Wärmerückgewinnung unvermeidbar sind. Dass das relevant ist, macht auch die folgende Analyse zum Ereignis am 1. Oktober deutlich.
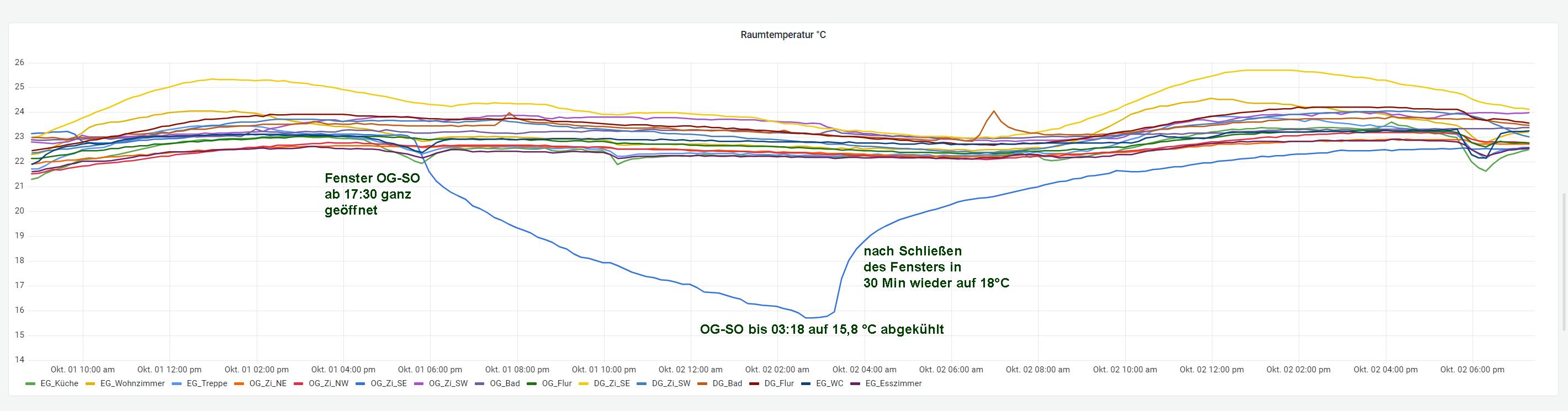
Abbildung (Ausschnitt aus der Vorausgehenden): Am 1. Oktober wurde in einem der Kinderzimmer im ersten Obergeschoss (der Süd-Ost-Raum) die Fenstertür zum Balkon ab 17:30 vollständig geöffnet - das geschah zum raschen Ablüften nach Malerarbeiten387) . Das Fenster blieb in diesem Fall sogar bis weit in die folgende Nacht (02:38 am 2. Oktober) geöffnet, das sind über 10 Stunden; die Innentür zu diesem Raum war dabei geschlossen. Hier zeigt sich dann bereits eine erste Erkenntnis: Die Temperaturen in allen allen anderen Räumen sind durch das Ereignis kaum beeinträchtigt: Bei genauer Analyse ist ein ganz leichter Rückgang im Verlauf dieser 10 Stunden um weniger als 0,2 Grad erkennbar; das wird bei Temperaturen von auch dann immer noch über 22,2 °C von den Bewohnern gar nicht bemerkt:
Werden die Innentüren geschlossen gehalten, so beeinflussen auch Extremereignisse in einem Raum, wenn sie sich auf kürzere Zeitspannen als 12 h beschränken, den Komfort in der übrigen Wohnung nicht; auch nicht, wenn dort weder aktiv geheizt noch gekühlt wird.
Im betroffenen Raum selbst allerdings nimmt die gemessene Temperatur spürbar ab, bis auf 15,8 °C zu dem Zeitpunkt, zu dem das Fenster dann wieder geschlossen wurde. Vor allem ist es die Raumluft, die hier natürlich schon nach wenigen Minuten auf das Niveau der Außenluft abfällt. Die Entladung der Wärmekapazitäten der Raumumfassungsflächen und auch der Möbel dauert allerdings länger: Nur die oberflächennahen Schichten kühlen in ein paar Stunden messbar aus - in der Tiefe der Betondecke nimmt die Temperatur kaum (um wenige Zehntel Grad) ab. Mit dem Schließen des Fensters fehlt dieser über den Luftaustausch bewirkte (sehr hohe!) Wärmeverlust wieder. Jetzt strömt weiter Wärme aus der Tiefe der Bauteile an die Oberflächen nach, die sich so schnell wieder erwärmen und dabei auch die Raumluft wieder Temperieren. Es dauert nach dem Schließen des Fensters rund 30 Minuten, dann liegt die Raumtemperatur auch im betroffenen Raum schon wieder bei 18 °C und am nächsten Morgen sind es bereits über 21 °C; dazu ist kein Betrieb der Heizung erforderlich - die Nacherwärmung funktioniert bei diesem Ereignis allein durch die in den wärmespeichernden Bauteilen verfügbare innere Energie. Der Vorgang illustriert, warum das Urteil aller Bewohner von Passivhäusern ist:
„Das Passivhaus ist sehr gutmütig, auch kleine und sogar größere 'Sünden' vergibt das Gebäude spielend, gute Behaglichkeit ist schnell wieder hergestellt.“
6. November: Immerhin mal ein wenig Sonne
Die vergangenen Tage waren eher verhangen - Tiefausläufer liefen etwas stürmisch durch und der solare Eintrag war bei Außentemperaturen um 9°C herum gering. Da verliert unser Passivhaus bereits im Nettoeffekt Energie; wenig nur von dem Vorrat, der in den Wärmekapazitäten gespeichert ist, aber zwischen 0,1 und 0,2 K am Tag würden die Temperaturen im Innenraum dann schon zurückgehen. Das freilich wird unterbrochen, wenn es zwischendurch mal einen Tag mit etwas direkter solarer Einstrahlung gibt; so war das heute, wenn auch nicht durchgehend. Es hat gereicht, die Temperatur in meinem Studio etwas anzuheben - noch immer ist „Pullover“ nicht angesagt, ich kann hier angenehm im Hemd sitzen. Dabei muss auch jetzt immer noch nicht geheizt werden - alle Heizwärmeerzeuger sind bisher dauerhaft ausgeschaltet. Im letzten Jahr hat die frei Wärme bis zum 5. Dezember ausgereicht, in dieser Wohnung ohne Heizung auszukommen (vgl. die ersten Blog-Einträge hier: "Vor dem 5. Dezember wurde nicht geheizt").
Rechtzeitig zum auf und ab der Beladung und Entladung des Gebäudespeichers habe ich die Diskussion zu den empirischen Erfahrungen unter Herbstbedingungen aufgearbeitet: Es ist schon faszinierend, wieviel doch direkt aus den Messdatenaufzeichnungen erkannt werden kann! Klar, das setzt voraus, dass die Physik dahinter vollständig verstanden ist; und selbst dann ist es extrem hilfreich, wenn im Hintergrund der Auswertung ein validiertes Modell verfügbar ist, mit dem sich die Temperaturverläufe und Wärmeströme auch da, wo sie nicht gemessen wurden, ansehen lassen; ich gebe zu, dass ich in einigen Fällen doch erst durch die Kontrolle an Hand eines solchen Modells zu einer korrekten Interpretation der Messdaten kommen konnte. Das zu erwähnen ist wichtig: Denn, bei den einfachen Überschlagsrechnungen, die in dem verlinkten Artikel gemacht wurden, handelt es sich um solche, die durch die im Hintergrund quantitativ validierte Theorie bestätigt sind. Allein durch die dargestellten „π mal Daumen“-Kalkulationen lassen sich die korrekten Zusammenhänge kaum finden, dazu sind die Gesamtsysteme einfach zu komplex. Diese „π mal Daumen“-Regeln sind jedenfalls immer an klare Randbedingungen gebunden388) . Gelten die jeweiligen Bedingungen nicht, dann kann so eine Regel schnell auch zu Irreführung Anlass geben. Ein einfaches Beispiel dafür ist: Mit gemessenen Momentanwerten der Temperaturen 'funktioniert' die naive Berechnung389) des Temperaturprofils in einem Außenbauteil nicht, weil die Voraussetzung des quasistationären Zustandes dann nicht gegeben ist: Die Temperaturen ändern sich im Zeitverlauf, oft sogar stark, dadurch werden Kapazitäten des Bauteils beladen und entladen, so dass unterschiedliche thermische Energiemengen im Bauteil gespeichert werden. Die naive Berechnung funktioniert aber, wenn ein langer Zeitraum von mehreren Tagen390) herangezogen wird und für einen solchen Zeitraum mit den Mittelwerten gerechnet wird. Dadurch mitteln sich Ein- und Ausspeichervorgänge391) heraus; wirklich faszinierend ist, dass sich das direkt mit den aufgezeichneten Messdaten nachvollziehen lässt.
13. November 2023: trübe Tage und kälter
In den vergangenen Tagen gab es nun kaum noch Sonnenschein. Heute hat es bei dichter Bewölkung den ganzen Tag geregnet; so, wie es für den November recht gewöhnlich ist. Die PV-Anlage hat deswegen auch nur 0,32 kWh am ganzen Tag geerntet. Die tagesmittleren Außentemperaturen lagen um die 7°C. Unter diesen Bedingungen sind die Wärmeverluste auch des Passivhauses größer als der Eintrag an freier Wärme: Die Folge ist, dass die Temperaturen sinken, weil sich nun die innere Wärmekapazität entlädt. Derzeit „verlieren“ wir um etwa 0,1 Grad jeden Tag. Noch liegen die Werte aber überall über 20°C (und bis 21,6°C). Wenn diese Witterung so anhält, dann wird die gespeicherte Wärme noch ein paar Tage ausreichen - die Heizung kann somit vorerst „aus“ bleiben. Das gilt sowohl für unsere Splitwärmepumpe als auch für die zentrale Gastherme, welche für das Heizen der anderen drei Wohneinheiten zuständig ist: Die steht ebenfalls heute immer noch auf Sommerbetrieb.
Sonst wird in Deutschland jetzt schon nahezu überall geheizt
Für „gewöhnliche“, wesentlich weniger gut wärmegedämmte Gebäude ist das in Deutschland allerdings anders: Die für den Haushaltssektor gemessenen Gasverbrauchswerte sind zwischen 5. und 12.Oktober dieses Jahres von rund 250 GWh/Tag auf inzwischen um 1000 GWh/Tag angestiegen392) ; das bedeutet, dass der Heizbetrieb in den meisten Objekten jetzt bereits eingesetzt hat. Die Leistung, die das aus dem Gasnetz zieht, liegen jetzt bereits bei über 40 GW im Schnitt. Zur Einordnung: Dafür müssten um 31 klassische 1,3-GW-Nuklearkraftwerke betrieben werden. Oder, um einen anderen Bezugspunkt zu bekommen, bei der mittleren üblichen Auslastung heutiger Windkraftanlagen müssten allein dafür rund 180 GW installierte Windkraftleistung bereit stehen; was das vor allem zeigt, ist, wie gigantisch hoch unser derzeitiger Fossilgas-Konsum ist. Die gute Nachricht ist, dass wir durch besseren Wärmeschutz und durch den Ersatz der Kessel durch Wärmepumpen diese Leistungen um insgesamt rund einen Faktor 10 reduzieren können - und dann lässt sich das durchaus mit einem zügigen Windkraftausbau auf eine nachhaltige Versorgung umstellen.
Die Grafik zum Gasverbrauch in Deutschland zwischen Ende September und Anfang November illustriert auch augenscheinlich, dass der Heizwärmebedarf um ein Vielfaches höher als der Bedarf für die Warmwasserbereitung ist; schon bei den mäßigen Temperaturen im Herbst beträgt er mehr als das Vierfache. Gas deckt in Deutschland derzeit etwa die Hälfte des Heizwärmebedarfs; Heizöl noch einmal 25%. Soll diese alles künftig durch erneuerbare Energie ersetzt werden, so erfordert das vor allem einen zügigen Ausbau der Windkraft. Ebenfalls leicht erkennbar ist, dass nur mit der Effizienz von Wärmepumpen und mit einer nennenswerten Reduktion der Wärmeverluste die gigantischen Energiemengen auf ein nachhaltig verträgliches Niveau gebracht werden können.
Dieser Verlauf im Oktober 2023 verdeutlicht auch noch weitere Zusammenhänge: Energiesparen im engeren Sinne von 'sparsamem Verhalten' ist über längere Zeiträume kaum durchzuhalten - es sei denn, die Energiepreise sind dauerhaft schmerzhaft hoch. Das ist nicht neu, das Wiedereinsetzen eher großzügigere Energieverbrauchswerte trat regelmäßig auch nach bedeutenden Energiekrisen spätestens nach ein paar Jahren ein: Spätestens, wenn die Preise nicht mehr spürbar waren und die Menschen dann andere Sorgen hatten. Im Sektor „Haushalte und Gewerbe“ z.B. liegt der Gasverbrauch jetzt bereits wieder nur wenig unter den Durchschnittswerten zwischen 2018 und 2021: Die noch bleibende Differenz dürfe überwiegend an Umstellungen von Gas auf Öl und auf Einzelöfen393) liegen, zu einem Anteil auch an Verbesserungen beim Wärmeschutz und in bisher nur wenig wirksamen394) Umrüstungen auf Wärmepumpen. Letztlich sind es allein diese baulichen und wärmetechnischen Maßnahmen, die den Verbrauch dauerhaft ernsthaft reduzieren. Daher sind die ausführlichen Maßnahmenbeschreibungen so wichtig: Energieeffizienzmaßnahmen JETZT.
19. November 2023: (Sonntag) ...und ein wenig Sonne
Gestern sah es fast so aus, als ob der Zeitpunkt für den Heizbetrieb jetzt gekommen sein: Ein trüber Tag, mit viel Regen und zudem auch noch kälter als die Tage zuvor (rund 5°C). In einigen Räumen lag die Temperatur da dann auch schon knapp unter 20°C. Heute brachte ein atlantisches Tief Wind, etwas höhere Temperaturen und durch die immer wieder aufreißenden Wolken sogar etwas Sonnenschein. Das Haus hat etwas Wärme getankt - in meinem Arbeitszimmer sind es jetzt komfortable 21,3°C und die Heizung kann weiter ausbleiben. Dieses Spiel nasser, trüber Tage abwechselnd mit Tagen mit etwas Sonnenschein ist typisch für diese Zeit. Das kann durch die Kombination aus Wärmeschutz und Speichermasse dieses Gebäudes gut überbrückt werden; bis es dann irgendwann im Außenbereich wirklich zu kalt wird oder es lange Zeiträume mit sehr trübem Wetter gibt. Heizbeginn zwischen Mitte November und Anfang Dezember war immer schon typisch; auch in diesem Jahr bleibt es spannend.
Auch am 21. November 2023 noch keine Heizung
Kurz gefasst: Es ist zwar jetzt wieder etwas kälter, aber es gibt tagsüber immer mal wieder ein paar sonnige Momente. Da bleiben die Temperaturen im Haus stabil zwischen 19,8 und 21,5°C - eine Heizung bedarf es dafür nicht.
Kein Geld für Klimaschutz?
Das ist die Diskussion, die gerade wieder läuft, angesichts des Haushaltsstopps des Bundesfinanzministeriums. Das zielt vor allem auf die Zukunftsinvestitionen im Bereich des Klimaschutzes - denn, an anderen Stellen unseres luxuriösen Lebens soll395) ja eben gerade nicht gespart werden396) .
Lassen Sie mich hier einen ganz anderen Aspekt einbringen: Wirklich bedeutende Teile der Dinge, die wir tun können, um zum Klimaschutz bei zu tragen: Die sparen uns nämlich richtig Geld.
In unserem Passipedia-Bereich "Energieeffizienz Jetzt!"haben wir viele konkrete Ansätze zusammengetragen, die umgesetzt werden können, nur sehr wenig Geld erforderlich machen und das auch immer wieder innerhalb kurzer Zeit einsparen. Diese Ansätze umfassen viele verschiedene Lebensbereiche. Sicher ist es richtig, dass nicht wenige von uns einige der dort dargestellten Ansätze schon praktizieren: Z.B. weniger Fleisch konsumieren, sparsam Auto fahren, vielleicht sogar die Heizung herunter drehen. Oft sind es aber ganz besonders wirksame Maßnahmen, die oft nur aus Unkenntnis, einfach unrealisiert bleiben. Das liegt auch daran, weil sich viele Menschen immer noch nicht vorstellen können, das z.B. ein technisch besserer neuer LED-Leuchteinsatz ganz erheblich mehr Strom und damit Kosten und Emissionen einspart, als wenn ich die alte Halogenlampe z.B. nur halb so lang einschalte: Die LED-Technologie ist mindestens 5mal so effizient!
Die genannten Ansätze sind überwiegend genau dieser Natur: Verbrauchskosten und damit Energie und Emissionen sparen lohnt sich in vielen Bereichen außerhalb jedes Zweifels: oft wird die Dienstleistung dabei sogar besser, wie z.B. bei den besser wärmegedämmten Kühlgeräten. Natürlich „kosten“ diese Ansätze am Anfang etwas - das nennt sich eine „Investition“. Wenn die dann erfolgt, wenn z.B. die Lampe oder das Kühlgeräte ohnehin neu beschafft wird, dann ist die Mehrinvestition nur gering397) . Diese Investition zahlt sich daher schnell zurück, auch das zeigen wir bei jeder der von uns sorgfältig dargestellten Maßnahmen-Beschreibungen.
Die Hoffnung liegt darin, dass wir etwas tun. Die wichtigste Nachricht dafür ist: Ja, wir können etwas tun. Die konkreten Ansätze zeigen das. Und dieses Handeln verbessert dann sowohl unsere persönliche Situation direkt als auch finanziell und es reduziert zugleich den CO2-Ausstoß. Möglich ist das, weil wir inzwischen über Kenntnisse verfügen, die vor dem 18. Jahrhundert schlicht nicht verfügbar waren: Ein Beispiel dazu im nächsten Absatz.
Es ist einfach faszinierend, wie fast jede/r von uns z.B. eine „Kühlmaschine“ rein praktisch selbst bauten kann! Vor 1845 war das undenkbar. Wie das möglich wurde, dazu gibt es eine spezielle Seite: Stirling-Wärmepumpe. Es ist ein Beispiel dafür, wie der wirkliche Fortschritt der Menschheit zustande kommt: Dieses Wissen geht nicht verloren solange es Menschen gibt, die bereit sind, zu lernen. Natürlich soll das keine Aufforderung sein, jetzt anzufangen, sich seinen Kühlschrank selbst zu bauen. Aber, die Beleuchtung da drin durch LED auszuwechseln, die Belüftung im Einbauschrank hinter dem Kühlschrank zu verbessern - oder auch, die Heizkörpernische zu dämmen, vielleicht sogar die Geschossdecke, … das alles können sehr viele von uns tun, weil das Wissen dafür zur Verfügung steht. Die zugehörigen Materialien kosten nicht viel - und etwas Geschicklichkeit kommt mit der Übung.
Die Möglichkeiten sind verfügbar. Nun sollten wir uns entscheiden, solches Wissen vernünftig anzuwenden. Z.B., indem wir schon einmal eine Split-Wärmepumpe einbauen; damit lässt sich im Sommer bei der nächsten Hitze gut kühlen - aber eben auch im Winter wesentlich klimafreundlicher heizen als mit einem brennstoffbetriebenen Wärmeerzeuger.
Übrigens: es ist nicht so, dass das alles „sinnlos ist, weil die hohen Emissionen ohnehin von anderen verursacht werden“. Es ist die Gesamtheit von uns allen, die den heutigen hohen Verbrauch verursacht: Insbesondere von all denen von uns, die in reichen Industrienationen leben. Wie groß z.B. der Anteil des Individualverkehrs und der Heizung am gesamten Verbrauch ist, das wird z.B. unter "Endenergie in Deutschland"erklärt.
Dass wir hier selbst etwas tun können, gibt in vieler Hinsicht Hoffnung: Es zeigt, dass wir eben nicht ohnmächtig sind. Eigenes Handeln stärkt auch das Selbstwertgefühl. es befreit uns aus Abhängigkeiten398) . Selbst die Emissionen durch die Raffinerien sinken, wenn Millionen von uns energiesparender Auto-Fahren399) .
22. November 2023
Wir heizen immer noch nicht. Kein Bedarf - heute kam die Sonne ab und an heraus und so bleibt es im Haus schön warm.
Die Sache mit dem Wachstum
Die Inhalte des folgenden Blog-Eintrages habe ich inzwischen auf eine Grundlagen-Seite in Passipedia ausgelagert, diese Seite findet sich hier: Bemerkungen zum Thema Wachstum. Den ursprünglichen Text lasse ich hier aber unverändert stehen - er ist etwas mehr mit persönlicher Note geschrieben. Ergänzungen werden allerdings nur noch an der systematisch aufgebauten Seite im Grundlagen-Kapitel gemacht. There is also an English translation available 400)
Die meisten Ökonomen lieben Wachstum: ökonomisches Wachstum. Der Wohlstand muss zunehmen, damit es etwas mehr zu verteilen gibt, denn die Begierde der Menschen ist unersättlich. Weil dieser ganze Zusammenhang sozusagen das Kern-Bekenntnis der Branche ist.
Es sind nicht so sehr viele Kritiker - aber es gibt sie schon. Die haben begründete Kritik an der zentralen Bedeutung, die dem Wachstum gegeben wird. Meist sehen sie dann, ganz im Gegensatz zu den Wachstum-Fans, das Wachstum als solches und grundsätzlich als die entscheidende Ursache dafür, dass es 'immer mehr Probleme' gibt.
Hier werde ich ein paar Gesichtspunkte anführen, die auf eine konkrete Lösung dieses Dilemmas hinweisen. Eine Lösung, die als Transformation in Fortsetzung eines Prozesses, der ohnehin schon läuft, entwickelt und umgesetzt werden kann. Die Analyse hat mehrere Teile:
(1) Die historische Aufbereitung: Das Wachstum war schon bisher gar nicht exponentiell…
(2) Die Rolle von Effizienzfaktoren (wie z.B. Produkt-Lebensdauern)
(3) Etwas elementare Mathematik: Die Summe der unendlichen geometrischen Folge konvergiert - doch was hat das mit dem Wachstum zu tun?
(4) Alles nur Theorie? Ein paar konkrete Umsetzungsansätze; bei Licht betrachtet: Da geht tatsächlich ziemlich viel!
Ich denke, das wird richtig spannend.
(1) Die historische Aufbereitung: Das Wachstum war schon bisher gar nicht exponentiell...
Kommuniziert werden bzgl. des Wirtschaftswachstums meist Prozentzahlen. Das ist schön anschaulich - und da spricht auch erstmal nichts dagegen. Dass allerdings gerade die einmal gemessene Prozentzahl dann Jahr für Jahr in mindestens der gleichen Höhe weiter fortgesetzt werden muss - das folgt aus dieser Art Angabe natürlich nicht. Das ist vielmehr eine Frage der empirischen Forschung: Deren Ergebnisse gibt es, sie sind sogar leicht allgemein zugänglich (statistische Ämter). Ein wichtiger Punkt muss natürlich beachtet werden: für die Realität, sowohl bzgl. des Wohlstandes als auch bzgl. der erforderlichen materiellen Ressourcen, ist nicht das nominale Brutto-Inlandsprodukt (BIP), sondern allenfalls das inflationsbereinigte ausschlaggebend. Das ist den statistischen Ämtern auch bewusst, daher gibt es die Daten als BIP-Zahlenreihen in realen Werten. Die Grafik stellt dies am Beispiel Deutschlands für die Zeit nach dem II. Weltkrieg dar. Und da gibt es dann bereits zwei Überraschungen:
- Ja, es gab ein stetiges und anhaltendes Wachstum - bis auf ein paar (wohlbekannte) kurzzeitige Einbrüche.
- Das war aber keinesfalls exponentiell, sondern, mit überraschend überzeugender Korrelation, linear!
So schnell ließe sich das nicht, auch nicht mit gewaltige Anstrengungen, in ein exponentielles Wachstum verwandeln. Auch wenn manche Politiker das immer mal wieder gern versprechen. Kurzzeitige „Strohfeuer“ sind durchaus auch einmal drin - das geht dann aber regelmäßig auf Kosten der nachfolgenden Zeit nach dem übermäßigen Abfackeln des Feuers. Die einen mag das enttäuschen - und einige 'Wachstumskritiker' möglicherweise auch, denn es gibt unter diesen Umständen letztlich auch nicht die Gefahr eines gewaltigen Überschießens401) . Und vor allem: Unter solchen Bedingungen bleiben die Zeitspannen für ein gesellschaftliches Handeln weiterhin überschaubar402) .
Fazit: Überschießende Wachstumserwartungen sind eine Illusion. Aber auch: Die Gefahr, dass das 'Wachstum als solches' in absehbarer Zeit zum fatalen Problem für die Gesellschaft werden sollte, besteht ebenfalls nicht akut. Die gesamte Problematik verdient es, etwas gelassener angegangen zu werden. Anders ausgedrückt: Lassen wir den Hyper-Hype mit dem unbegrenzt exponentiellen Wachstum oder seiner Forderung403) ; und lassen wir auch das gelähmte Starren auf die „Schlange exponentielles Wachstum“404) .
Wenn sich das ganze weiterhin in geordneten (linearen) Bahnen vollzieht, dann haben wir Zeit. Zeit für eine vernunftgetragene Transformation auf ein nachhaltiges Wirtschaften. Und ob und wie viel das dann auch noch wächst - das wird vor diesem Hintergrund eher zweitrangig. Das wird klar, wenn wir auch noch (2) und (3) hinzuziehen.
===(2) Die Rolle von Effizienzfaktoren ===
Hier spreche ich, einzig wichtig in diesem Zusammenhang, nur Material- und Energie-Effizienz an. Das Thema Energieeffizienz wird auf den Seiten der Passipedia eingehend behandelt, z.B. hier. Ich greife daher hier das Thema Materialeffizienz auf. Oft wird da argumentiert, dass da ja 'so sehr viel nicht zu holen' sei, denn eine bestimmte Mindest-Material-Menge für eine gegebene Aufgabe sei ja wohl offensichtlich. Selbst das ist keinesfalls so klar, wie es auf den ersten Blick erscheint. Aber es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt: Nämlich die Verweildauer, die ein einmal gewonnenes Material für diese Aufgabe in Nutzung bleibt. Die kann nämlich durchaus sehr unterschiedlich lang sein. 'Beliebig' unterschiedlich lang? Das würde eine ziemlich philosophische Diskussion: Die Voyager-Raumsonden z.B. sind jetzt bereits seit September 1977 unterwegs; und sie laufen immer noch! Ich wage hier die steile These: Für die praktischen Fragen der Gegenwart können die Nutzungsdauern 'quasi' beliebig lang verlängert werden, solange es sich nicht um Verbrauchsmaterial handelt. Das braucht eine sorgfältige Betrachtung - und in der Regel die Vermeidung jeder Form von „Verbrauch“, der nicht allein auf nachwachsende Rohstoffe zurückgreift. So, wie das hier auch immer wieder am Beispiel Energie gezeigt wurde: Dabei die Effizienz mindestens so weit verbessern, dass die Rate der nachwachsenden Rohstoffe ausreicht, den konsumtiven Teil des Umsatzes zu decken405) .
Wie gut ist denn dann „gut genug“?
Die nächste Überraschung: Das ist eine rein mathematische Frage. Wenn eine Aufgabe bisher mit einem System der Nutzungsdauer $t_N$ erledigt wird und das Wachstum $p$ beträgt406) , dann braucht die neue Lebensdauer neuer Systeme dieses Typs nur jetzt mehr als $(1+p)\cdot t_N - t_N = p \cdot t_N$ länger zu halten; sagen wir, die neue Lebensdauer ist $(1+\epsilon)$ mal $t_N$, dann ist $(1+\epsilon)$ ein typischer Effizienzfaktor. Dass der jedes Jahr erneut „aufmultipliziert“ werden kann, ist für die Anfangszeit unbestreitbar - auf Dauer natürlich eine Diskussion wert407) 408) . Die jährlich weiter erforderliche geförderte Materialmenge entwickelt sich dann nach
$\;\displaystyle q=\frac {1+p}{1+\epsilon} < 1 \;$
mit einem jährlichen Faktor $q$ kleiner als 1, also abklingend exponentiell. Das ist der entscheidende Punkt, wie mit Abschnitt (3) klar wird.
(3) Etwas Mathematik: Die Summe der unendlichen geometrischen Folge konvergiert!
Das ist nicht neu, fast alle haben das irgendwann in der Schule gehabt - meist natürlich nicht mit der Tragweite diskutiert, die es für die Praxis hat; wie so oft bei mathematischen Erkenntnissen: Viele von denen sind sehr viel relevanter als es der meist trockene Mathematik-Unterricht erscheinen lässt; das kann an sehr vielen Stellen so richtig spannend sein!
Erstmal die Fakten: Sei $q$ ein Faktor mit Betrag kleiner als 1. Dann ist die 'unendliche Summe'(genannt: geometrische Reihe)
$1+q+q^2+q^3+...$
ein endlicher Wert.
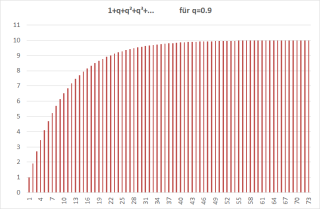 Eingebürgert hat sich in der Mathematik die Schreibweise mit dem Summenzeichen $\sum$ dafür:
Eingebürgert hat sich in der Mathematik die Schreibweise mit dem Summenzeichen $\sum$ dafür:
$\;\displaystyle { \sum_{n=0}^\infty {q^n} = \frac{1}{1-q} } \;$
Da haben wir nun bereits die Lösung für diese Summe angegeben, nämlich den Kehrwert von $1-q$. Ist $q\;$ z.B. 90%, dann ist $1-q=$0,1 und die unendliche Summe wird das 10-fache der derzeitigen Förderung an dem fraglichen Material; das reicht dann für die „Versorgung“ in „Ewigkeit“. Die Grafik illustriert diese Summe für den Fall $q=$0,9 für bis zu N=73 Summanden; da ist das bereits sehr nahe an „10“, aber es ist immer noch Platz da für unendlich viele, ständig zügig kleiner werdende $q^n$ [den Beweis stecken wir in eine Fußnote409) ].
Hier ist „Ewigkeit“ selbstredend genauso praktisch irrelevant wie bei der Debatte um das niemals endende materielle exponentielle Wachstum: Wenn die Zeiten einmal bei einigen Jahrhunderten angekommen sind, lassen sich immer Lösungen finden, solange nur die „Bedarfs“werte nicht gigantomanisch hoch sind - was sie, gemäß der $q^n$ Entwicklung mit einem $q<1$ gar nicht sein können. Im Gegenteil: $q^n$ wird immer für irgendein $n$ völlig unbedeutend klein, genau wie die dann noch folgenden Summanden. So klein, dass das für die Praxis schlicht unbedeutend ist, weil es dann nachwachsende Ressourcen gibt, die das spielend abdecken. Nicht mehr gültig wird es in der Realität dann sein, wenn wir wirklich über 'unendliche Zeiten'410) reden411) .
Kurz zusammengefasst: $q<1$ bzw. Effizienzzuwachs größer als Bedarfszuwachs löst somit tatsächlich das Wachstumsproblem.
Provokativ nochmal anders ausgedrückt: Wohlstandszunahme ist durchaus weiterhin erlaubt: Solange sie mit „Augenmaß“ erfolgt, eben über bessere Effizienz und nachwachsende Ressourcen 'finanziert' wird412) .
Ja, natürlich ist mir klar, dass das beiden „Lagern“ nicht passt: Den Wachstums-Apologeten nicht, weil sie alles unterhalb von ewigem exponentiellem unbegrenztem Wachstum als unsexy ansehen; und den Wachstums-Kritikern nicht, weil hier auf einmal durchaus auch eine gemäßigte weitere Zunahme des 'Wohlstandes' zumindest denkbar erscheint.
Gehen wir eben mit offenem Geist an diese Fragen heran. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine einfache mathematische Analyse eine seit alters als 'unlösbar' angesehene Frage eben doch löst413) . Ja, es gibt ihn eben doch, den technischen Fortschritt; allerdings: Erzwingen lässt er sich nicht und verantwortungsvoll einsetzen müssen wir ihn schon. Ich könnte Effizienzgewinne immer gleich wieder in übermäßig zunehmende Verschwendung stecken - das scheinen einige gern so zu wollen; es muss klar werden, dass das nur soweit geht, wie weiter $q<1$ bleibt. Aber einen „Stillstand“ bedeutet das eben gerade nicht414) . Wir können soviel wachsen, wie wir uns das ehrlich nachhaltig verdient haben - und dann müssen keine nicht-erneuerbaren Ressourcen darunter leiden. Das ist vernünftiges Wirtschaften im verallgemeinerten Sinn; und das ist dann auch ehrlicher Wohlstand, der nachhaltig verdient ist. Machen wir uns aber nichts vor: Derzeit sind wir von einer solchen Gleichgewichtswirtschaft noch weit entfernt - zu viele Jahrzehnte wurde die maßlose Steigerung des Konsums aus der Substanz voran getrieben; erst allmählich wird uns das nun bewusst. Die Umstellung wird anstrengend, aber es geht - und wir zeigen an relevanten Beispielen, wie.
(4) Alles nur Theorie?
Nein! Das ist heute bereits vielfach gelebte Praxis. Auf Passipedia ist dazu schon eine ganze Menge verfügbar: Nämlich konkrete, bis in die „Bauanleitung“ gehende Beschreibungen der Maßnahmen, die $q<1$ zumindest im Bereich des Energiesystems in der Praxis als umsetzbar erweisen: Praxis der Energieeffizienz. Dass damit die Ziele tatsächlich erreicht werden, das wird hier im Detail dargestellt415) .
Weiter gibt es sogar bereits die empirische Erfahrung, die wir hier für zwei Anwendungssektoren, nämlich den Verkehr und die Gebäudeheizung schon beleuchtet haben.
Tatsächlich haben wir jeweils $q<1$ für über ein Jahrzehnt erfolgreich in diesen beiden Sektoren realisiert. Übrigens jeweils mit Reduktionsfaktoren kleiner als 100% - 1%. Das würde „allein“ dann noch rund 30(Gebäude)-100(PKW) Jahre brauchen - weil zugleich aber auch die nachhaltige Erzeugung von Energie hochgefahren wird, werden sich die verbesserten Kurven für „erneuerbare Erzeugung“ und „durch Effizienz verringerten Verbrauch“ in der Zwischenzeit treffen; innerhalb von 25 bis 30 Jahren ist das leistbar - wenn wir uns gemeinsam dafür anstrengen. Funktioniert hat das jeweils bis zu dem Zeitpunkt, an dem uns die Lobbyisten erfolgreich eingeredet hatten, dass das alles gar nicht notwendig sei416) .
Wir haben also bereits bewiesen, dass das, auch für eine ganze Volkswirtschaft, erfolgreich geht. Klar ist allerdings auch: Ganz automatisch und von selbst passiert das nicht, wir müssen das schon aktiv einleiten und dann auch wirklich durchführen. Aber das geht - wir haben es ja schon einmal erfolgreich gemacht.
Der zügige Ausbau der erneuerbaren Energie gehört selbstverständlich mit dazu: Damit sich die fallende Bedarfskurve und die steigende erneuerbare Erzeugung treffen können, und das nicht erst 2100417) sondern schon um rund 2050418) .
Um noch ein wenig mehr positive Perspektive zu bieten: So ab rund 2050 ist auf diesem Weg eine 'Erneuerbare Überproduktion' von Energie möglich (über den Bedarf an Dienstleistungen hinaus). Die könnten wir dann z.B. wieder in „noch schnellere Autos stecken“, das halte ich allerdings nicht für die beste Idee. Besser ist es, dass wir diesen Energie-Überschuss dann verwenden, um aktiv weiter CO2 aus der Atmosphäre zu holen; dass auch das möglich ist, ist ebenfalls längst demonstriert (sog. „direct air capture“, DAC). Das wird notwendig sein, um die schon aufgelaufenen Sünden der Vergangenheit zu korrigieren: Denn, wir haben heute bereits mehr CO2 emittiert, als es für eine nachhaltige Entwicklung auf dem Planeten gut ist. Wenn wir uns dann weiter ein wenig anstrengen, können wir sogar ein 1,5°C-Ziel bis 2100 immer noch erreichen: Darauf aber allein auf Entscheidungen zu setzen, die erst in 25 Jahren getroffen werden, halte ich allerdings für unverantwortlich419) . Diese Überlegung zeigt aber eines: Lösungen, die eine Umstellung auf eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen, gibt es. Es ist noch lange nicht 'alles verloren'.
Um nochmal auf die einführende Analyse zum in Wirklichkeit nur linear anwachsenden Brutto-Inlandsprodukt (das Diagramm unter (1)) zurück zu kommen: Wer (2) und (3) verfolgt und nachgerechnet hat, wird feststellen, dass beides auch ohne die Annahme, dass es gar kein auf Dauer exponentielles Wachstum gibt, auskommt; es wurde ja gerade selbst in (2) immer noch ein konstantes prozentuales Wachstum $p$ verwendet. Für (2) und (3) kommt es somit nur darauf an, dass der prozentuale Effizienzgewinn $\epsilon$ größer ist als dieses prozentuale Wachstum $p$. Dazu allerdings ist die empirische Erkenntnis des eben nicht exponentiellen sondern linearen realen BIP-Wachstums praktisch relevant: Da die Effizienzverbesserung (zumindest für die nächsten ca. 1000 Jahre) der absteigenden geometrischen Folge entsprechen kann, holt sie jeden linearen Zuwachs irgendwann immer ein. Derzeit liegt das reale Wachstum relativ zum derzeitigen BIP im Mittel bei rund 1,25%/a. Das ist bereits mit einem $\epsilon$ der gleiche Höhe (1,25%/a) abgefangen; wir haben schon mehr als das geschafft - und das schaffen wir auch allemal, wie es einer der Kommentatoren ausgedrückt hat: Das ist allein eine Frage des Willens. .
Worauf es somit ankommt: Alle Anstrengungen, die Energie- und Material-Effizienz zu verbessern! Das geht u.a. durch Wärmeschutz, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen, Low-Flow-Duschköpfe, effiziente Elektronik, Elektro-Traktion, Gegenstromöfen, längere Nutzungsdauern, Reparaturfähigkeit, Vorbeugung statt Schadenszulassung u.v.a.m. Damit tauchen wir innerhalb von wenigen Jahrzehnten unter die Grenze, die für ein nachhaltiges Wirtschaften unterschritten werden muss. Ab dann kann das weitere Wohlstandswachstum, so wir ein solches wollen, dem Zuwachs an erneuerbarer Erzeugung folgen; vielleicht haben wir dann aber auch soviel Spaß an den Effizienzansätzen gefunden, dass wir auch diese darüber hinaus fortsetzen und dann so noch mehr Raum für weiteres Wachstum schaffen420) . Für die nun folgenden 30 bis 50 Jahre, die Zeit, auf die es ankommt, da sind die Effizienzpotentiale für rund 3% Effizienzgewinn jedes Jahr schon heute nachgewiesen und in der Praxis demonstriert: Wir haben heute schon Häuser gebaut, deren Heizenergieverbrauch vernachlässigbar gering ist - und Fahrzeuge, die allein durch Muskelkraft auch 100 km/h schaffen. Und wir können mit dem allen immer noch besser werden, es gibt keine prinzipielle „Bestwertgrenze“.
Die Inhalte dieses Blog-Eintrages sind inzwischen auf eine Grundlagen-Seite in Passipedia ausgelagert, die regelmäßig ergänzt und aktuell gehalten wird, diese Seite findet sich hier: Bemerkungen zum Thema Wachstum.
Samstag, 25. November 2023
Die Heizung ist nach wie vor „aus“; sowohl unsere Klimasplit-Anlage als auch die Gas-Zentralheizung der anderen drei Wohnungen in dieser Häuserreihe. Heute Nacht gab es allerdings nun auch hier in Darmstadt das erste Mal Bodenfrost; und die mittleren Temperaturen am Morgen im Haus lagen heute zwischen 19,0 und 20,8 °C. Das ist dann mit ein wenig lokaler Wärme durch gutes Licht und den Computer auch am Arbeitsplatz noch ganz okay. Ich werde jetzt übrigens mal ausprobieren, wie lange wir das mit persönlich zugeordneten IR-Strahlern und auf diese Art lokal ergänzter Wärme durchhalten.
Dazu gibt es gerade eine heftige Debatte in „social media“. Ich kann dazu schon einmal ein vorab-Ergebnis kommunizieren, das leicht überprüfbar ist: Bei rund 17°C Umgebungstemperatur421) benötigt der menschliche Organismus rund 50 W an zugestrahlter weiterer Energie, wenn ich nicht mit klammen Fingern dasitzen will422) . Diese Leistung zu 100% gleichmäßig allein auf die Person zu konzentrieren ist eine ziemliche technische Herausforderung; 40% sind vielleicht möglich, dann bedarf es eines IR-Strahlers mit 125 W für jede Person; das sind bei 3 Personen insgesamt 375 Watt, die 18 h täglich laufen müssen; über den Zeitraum, in dem sonst die Heizung läuft, das sind bei uns im Passivhaus rund 100 Tage. Das macht insgesamt $3\cdot 125 \text{W}\cdot 18 \text{h/d} \cdot 100 \text{d} = 675 \text{kWh}$. Das ist interessanterweise sogar etwas mehr als es die $635 \text{kWh}$ Stromverbrauch für unsere Split-Wärmepumpe im letzten Jahr waren; und mit der war es in der gesamten Wohnung immer angenehm warm, über 20°C, in aller Regel mehr als 21°C am Sitzplatz. „Wunder“ erwarte ich von der lokalen IR-Heizung nicht; aber wir werden sehen…
Montag, 27. November 2023
So rund 0,1 bis 0,2 °C „verliert“ das Gebäude derzeit aus der eingespeicherten Wärme jeden Tag - bei Außentemperaturen, die nun um 2°C herum liegen. Noch sind sowohl die Split-Wärmepumpe als auch die Gasheizung für die anderen Wohnungen nicht im Betrieb. Allerdings rechne ich damit, dass es in den nächsten Tagen soweit sein wird, denn die Wetterprognosen sagen Temperaturen um den Gefrierpunkt, Schneefall und nur sehr wenig Sonnenschein vorher.
Das IR-Strahler-Experiment sieht jetzt wie folgt aus: Am Arbeitsplatz gibt es jetzt zusätzlich eine Stehlampe mit einer ganz konventionellen 150 W-Glühbirne. Die ist über einen Dimmer bis auf 54 Watt reduzierbar - und da läuft sie dann auch in der Regel, außer eine Viertel Stunde am Anfang („Aufwärmen“) und, wenn es dann richtig angenehm „warm“ empfunden wird, dann schalte ich ganz ab. Die Laufzeit beträgt dabei momentan doch nur etwa 6 Stunden und die Tagesverbrauchswerte sowie die daraus bestimmten tagesmittleren Leistungen lagen gemäß der folgenden Tabelle bei
Das sind dann effektiv im Tagesdurchschnitt Leistungen von zwischen rund 15 und 40 W/Person - und das schaut zunächst nach etwas weniger aus als die vor ein paar Tagen angegebene Schätzung: Allerdings liegen die Hintergrundtemperaturen im betreffenden Raum (Studio im Dachgeschoss) derzeit auch noch zwischen 19,0 und 20,2 °C, also in einem Bereich, der mit Pullover und warmen Socken durchaus auch ohne Zusatz-Strahlungswärme „erträglich“ wäre. Meine eigene Wärmeabgabe, der PC mit Bildschirm und dieser IR-Strahler tragen dazu bei, auch die aufgezeichnete mittlere Raumtemperatur bei Anwesenheit über dem Durchschnitt im Haus zu halten. Von meiner subjektiven Wahrnehmung her habe ich Zweifel, ob die im alten Post angesetzte 17°C Raum-Hintergrundtemperatur akzeptabel wäre. Zumindest um die Füße herum am Schreibtisch würde es da noch eine gewisse Verbesserung brauchen. - Wir werden das weiter austesten, solange die Familie das akzeptiert.
Mittwoch, 29. November 2023: Jetzt ist das Splitgerät "AN"
Heute habe ich den Heizbetrieb des Splitgerätes eingeschaltet. Die Außentemperaturen liegen derzeit um den Gefrierpunkt herum und bedeutende passiv solare Gewinne sind auch in den nächsten Tagen hier am Standort nicht zu erwarten - bei rund 0,2 Grad Temperaturrückgang an jedem Tag lagen die Werte im Erdgeschoss heute früh nur noch um 18 °C herum. Und da gebe ich gern zu, dass das auch mit dem Pullover sich für mich nicht wirklich komfortabel anfühlt. Natürlich könnten wir jetzt alternativ auch noch unser körperliches Aktivitätsniveau heraufsetzen. Am PC sitzend und Texte eintippend, das reicht dafür aber nicht. Die IR-Lampe hilft schon ein wenig, aber um die Knöchel herum bleibt es dann immer noch 'etwas kühl'. Dass das mit einem Warmhalte-Hausschuh oder einer Heizmatte noch lokal ausgleichbar wäre, ist richtig - da erscheint mir jedoch jetzt die Inbetriebnahme der Split-Wärmepumpe der bequemere Weg.
Wie im letzten Jahr liegt die elektrische Durchschnittsleistung der Split-Wärmepumpe derzeit bei rund 500 Watt. Das ist nicht mehr, als es der zusätzliche Betrieb unterstützender lokaler elektrischer Wärmebereitstellung für 3 Personen auch wäre. Der Unterschied ist aber: Mit der Split-Geräte-Heizung steigen die Hintergrundtemperaturen im Haus jetzt zügig auf Werte über 19 °C an; und das ist dann überall im Haus, bei dem im Passivhaus vorliegenden günstigen Strahlungstemperaturfeld (ebenfalls um und über 19°C) ein akzeptables Komfortniveau.
Mit der Inbetriebnahme der Heizung liegen wir hier im Passivhaus für die diesjährige Winterperiode 7 Tage vor dem letzten Jahr. Letztes Jahr war es zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich noch erheblich wärmer. Das Einschalten des Heizbetriebs lag im Passivhaus auch in der Vergangenheit immer irgendwann zwischen Mitte November und Mitte Dezember; wann genau, das hängt von den jeweiligen Wetterlagen ab.
Rettet uns die direkte CO2-Entnahme aus der Luft?
Dazu hat Kollege Harald Lesch heute ein Video veröffentlicht - mit Kollegin Julia Pongratz, die auf genau diesem Gebiet forscht. Die Ergebnisse sind klar; sie können kaum besser zusammengefasst und erklärt werden, als in eben diesem 22 Minuten-Video:
Es lohnt sich, das anzusehen und weiter zu empfehlen. Es erklärt auch noch einmal den gesamten Zusammenhang:
- Wo eigentlich das Problem liegt: Nämlich beim CO2, das durch Verbrennung fossiler Brennstoffe zusätzlich in die Atmosphäre gelangt.
- Dass das sehr viel CO2 ist, nämlich jährlich über 40 Milliarden Tonnen. Mehr als 4 Tonnen pro Kopf der Erdbevölkerung. Das ist zuviel für eine weiter lebenswerte Zukunft.
- Dass wir derart riesige Mengen nicht mit vertretbarem Aufwand jährlich wieder werden rausholen können,
- …es daher zu einer massiven Reduktion dieser Emissionen keine Alternative gibt.
- Dass das und wie das geht: Durch Energiesparen und erneuerbare Energie,…
- und dass auch dann trotzdem schon jetzt zuviel CO2 zusätzlich der Atmosphäre zugeführt wurde, vom dem wir schließlich auch noch
- eine ganze Menge wieder herausholen müssen. 2 bis 8 Mrd Tonnen Entnahme sind künftig vielleicht einmal möglich,
- viel zu wenig, um damit allein das Problem zu lösen. Aber genug, um damit am Ende die letzten überschüssigen wenigen Milliarden Tonnen zu erfassen.
- Dazu wird Energie gebraucht, gar nicht wenig. Das kann und darf natürlich nur CO2-frei erzeugte Energie sein. Von dieser haben wir momentan nicht so sehr viel übrig. DAC (direct air capture) ist deshalb vor allem eine Aufgabe, die wir künftig haben, dann, wenn einmal ein Überschuss an erneuerbarer Energie verfügbar wird,
- was möglicherweise, wenn wir uns anstrengen, ab Mitte des Jahrhunderts möglich wird.
- In der Zwischenzeit muss alles getan werden,
- durch Energieeffizienz,
- Ausbau erneuerbarer Energie,
- Erhalt von Wald- und Moor-Ökosystemen,
- nachhaltiger Landwirtschaft,
- was wir mit vertretbarem Aufwand jetzt tun können, um die Emissionen zu reduzieren.
- Auch, damit der Zustand mit einem Überschuss an erneuerbarer Energie baldmöglichst erreicht wird.
Das ist im Grundsatz alles leicht nachvollziehbar. Warum machen wir das dann nicht schon längst? Meine These: Wir verbringen derzeit noch viel gesellschaftliche (und politische) Energie für ablenkende Diskussionen: Nein, die Erde ist nicht flach. Nein, an der Erwärmung ist nicht die Sonne 'schuld'. Doch wir alle hier (insbesondere in Europa) emittieren bei weitem übermäßig viel CO2 (nämlich rund 8 Tonnen pro Person und Jahr).
Es kommt nicht auf akademische Debatten an, sondern
auf konkretes Handeln hier und jetzt
* Windkraft ausbauen,
* Häuser dämmen,
* Wärmepumpen einbauen,
* auf Elektro-Fahrzeuge umsteigen,
* Infrastruktur Fußgänger-freundlicher gestalten,
* gesünder ernähren,
* ökologische Land- und Forstwirtschaft,
* nachwachsende Rohstoffe,
* längere Nutzungsdauern von Systemen, …
Alle diese Dinge sind letztlich viel kostengünstiger als z.B. DAC; oft ist das sogar kostengünstiger als heutige fossile Energieträger. Deshalb gilt es, jetzt zügig mit all dem anzufangen. Dann sind die Probleme noch lösbar. Selbstverständlich muss die DAC-Technologie aber ebenfalls weiterentwickelt und getestet werden: Zugleich sollten wir überlegen, wie eine solche CO2-Entnahme aus der Atmosphäre finanziert werden soll. Dass die Forschung und auch die Demonstration aus staatlichen Mitteln gefördert wird, ist angesichts der Situation durchaus vertretbar. Wird die Entnahme künftig in größerem Stil praktiziert, so entstehen dadurch Kosten, die den CO2-Emissionen zuzuordnen sind. Verursachungsgerecht muss dann der Preis der CO22-Abgabe in die Atmosphäre so hoch sein, dass er diese Kosten mit enthält. Leider sind diese erforderlichen Rücklagen für die Emissionen in der Vergangenheit nicht gebildet worden. Da wir dieses Problem jetzt kennen, müssen die verursachungsgerechten CO2-Wieder-Entnahme-Kosten jetzt mit keinem weiteren Verzug von künftig gehandelten fossilen Energieträgern einbehalten werden: Die Abgabe auf CO2 muss somit eine angemessene Höhe haben423) .
6. Dezember 2023: Rückblick November
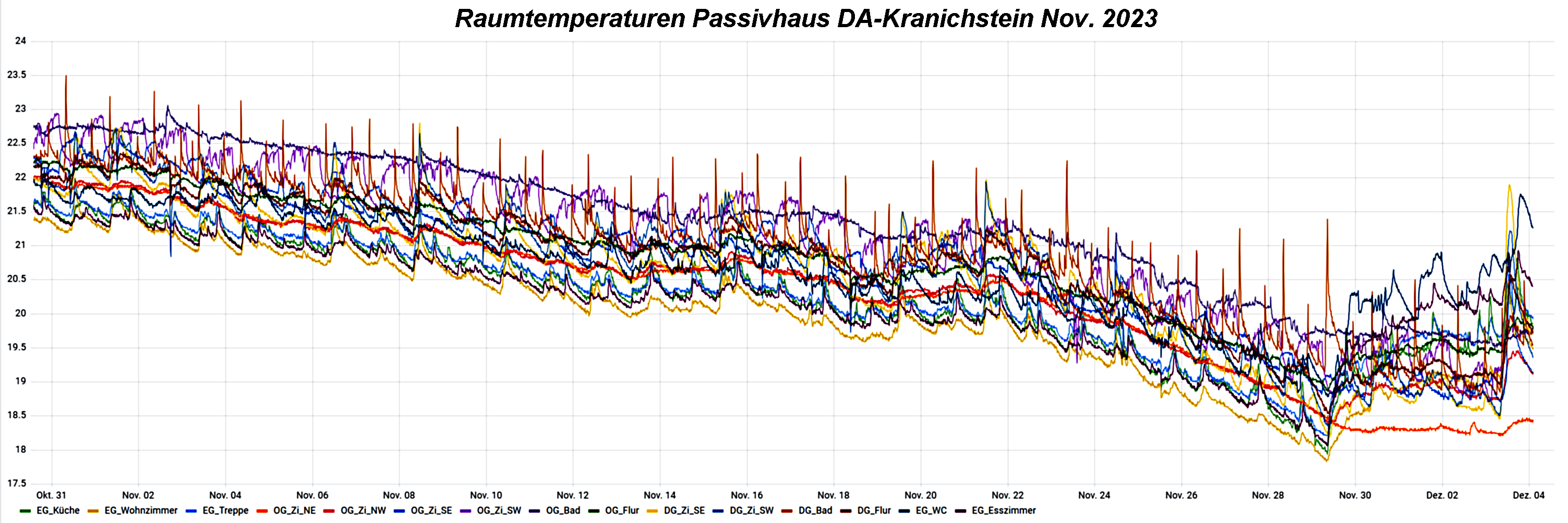 Temperaturen von Ende Oktober bis 4. Dezember 2023.
Temperaturen von Ende Oktober bis 4. Dezember 2023.
Zwei Rückgänge bei den Temperaturen sind erkennbar - die erste zwischen 2. und 12. November (herunter auf 20 bis 22°C) sowie zwischen 23. und 29. November; letzteres war der eigentliche Kälteeinbruch in der Winterperiode 2023/24. In der Zeit zwischen 13. und 22. November wurde ein Plateau gehalten, hier gab es zumindest ab und zu etwas solare Einstrahlung.
Gut erkennbar ist die Inbetriebnahme des Splitgerätes am 29. November: Damit werden die Temperaturen im Haus oberhalb von 19°C abgefangen. Am dritten Dezember gab es einen einzelnen Tag mit direkter passiv solare Energie. Für das Zimmer „OG_zi_NE“ (Nordost-Zimmer im Obergeschoss) halten wir wie im letzten Jahr die Tür zum Treppenhaus geschlossen. Diese Zone bleibt dann ca. 1 K kälter (um 18,3 °C) als die anderen, stärker miteinander gekoppelten Räume. Dies illustriert gut, wie das offene Treppenhaus zusammen mit der guten Dämmung der Hülle die hier gewählte Beheizung mit dem Splitgerät ermöglicht.
17. und 18. Dezember 2023: zwei sonnige Tage mitten im Dezember
Gestern und auch heute kam die Sonne heraus, zumindest nachdem der morgendliche Nebelschleier aufgelöst war. Das sorgt für passiv solare Wärme im Haus: Insbesondere die Räume im Süden profitieren davon; so wurde es dann in meinem Arbeitszimmer über 22 °C warm - das empfinde ich als angenehm und außerdem entspannend, die Lichtdurchflutung hebt zusätzlich die Stimmung. Dazuhin reduziert es auch noch den Heizwärmeverbrauch. Eine sehr anschauliche Illustration der Prinzipien eines Passivhauses.
Übrigens: wenn der gesamte Dezember immer soviel Strahlung erhalten würde, müssten wir hier überhaupt nicht heizen. Aber, so ist das in Mitteleuropa: Überwiegend ist der Himmel hier im Dezember bewölkt; dann gibt es immer noch ein wenig diffuses Licht - das dann in den Südräumen tagsüber für die natürliche Belichtung in aller Regel reicht - aber die passive Energiezufuhr kann die Wärmeverluste dann nicht vollständig kompensieren. Für den kleinen verbleibenden Rest reichen auch dann Leistungen im Bereich von bis maximal 1,2 kW aus (vgl. dazu Messergebnisse zum Energieverbrauch im Passivhaus Kranichstein).
19. bis 24. Dezember 2023: die kürzesten Tage und die auch noch durchgehend stark bewölkt
Das typische mitteleuropäische Winterwetter: Das ist oft eine atlantische Strömung, nicht besonders kalt, aber dicht zugezogener Himmel und regnerisch. So war es die gesamten letzten Tage hindurch: An zwei dieser Tage hat die Solarstromanlage noch nicht einmal ein paar Wattstunden geliefert. Kurz ist die dann noch nicht einmal besonders helle Tageslichtzeit auch noch. Das steigert meinen Bedarf an künstlichem Licht - und die Split-Wärmepumpe läuft an diesen Tagen auch dauerhaft; wegen der nun eher etwas höheren Außentemperaturen aber mit geringerer elektrischer Aufnahmeleistung (rund 400 W). Im Haus bin ich mit Komfort sowohl bzgl. Licht als auch Wärme sehr zufrieden. Ein paar Minuten im Regen spazieren-gehen muss aber sein, auch wenn da wegen der Nässe nur die befestigten Straßen und Wege in Frage kommen.
27. Dezember 2023
Die Sonne kam heute und gestern zumindest jeweils ein paar Stunden heraus: Mit den schon bekannten Auswirkungen von geringfügigen, aber angenehm spürbaren Erhöhungen der Temperaturen in unseren südorientierten Räumen. Die Split-Wärmepumpe läuft dennoch weiter - denn, trotz mäßig niedriger Außentemperaturen (zwischen 5 und 9 °C gestern) sind die Wärmeverluste derzeit höher als die Wärmegewinne - die Dauer des hellen Tages ist zu kurz und die meiste Zeit ist es auch immer noch bewölkt.
PBS Terra: Video zum Klimawandel
PBS Terra ist ein Wissenschaftskanal der Weiterbildung (in englischer Sprache). Hier finden sich viele gute Erklärungen zu einer Vielzahl der Forschungsergebnisse der Geo-Wissenschaften. So auch dieses Video zum Zusammenhang der Temperaturen auf dem Planeten mit der Zusammensetzung der Atmosphäre.
Kurze Zusammenfassung:
(1) Die globalen Temperaturen auf der Erde haben immer wieder, oft sogar stark, geschwankt. Dabei war in 90% der Fälle eine der Änderung CO2-Konzentration die Ursache. Es ist das CO2.
(2) In Millionen Jahren hat die Biosphäre der Erde einen großen Teil des CO2 aus der Atmosphäre entfernt - und zu einem Teil in Kohle, Öl und Gas verwandelt, die zunächst den Kohlenstoff sicher abgelagert haben.
(3) Jetzt kommt die menschliche Zivilisation ins Spiel: Innerhalb weniger Jahrzehnte verbrennen wir den abgelagerten Kohlenstoff und bringen ihn als CO2 wieder in die Lufthülle zurück, wo er für die derzeit beschleunigte Erwärmung sorgt.
(4) Eine der Auswirkungen, die für die Zivilisation erhebliche Probleme bereitet, ist der Anstieg des Meeresspiegels. Dieser erfolgt zeitverzögert - und er wird bei mehr als 3°C Erwärmung Werte erreichen, die für eine Weltbevölkerung von über 8 Milliarden Menschen wirklich nur als „katastrophal“ bezeichnet werden können. Die Infrastruktur der Zivilisation ist auf die bestehenden Bedingungen abgestimmt - sie wird überfordert, wenn sich diese Bedingungen so dramatisch ändern, wie es, wenn wir so weitermachen wie bisher, der Fall sein wird. Diese Entwicklung darf in dieser Geschwindigkeit nicht weiterlaufen.
(5) Der Wandel derzeit ist viel zu schnell, er überfordert die Anpassungsfähigkeit der Zivilisation. Die einzige „Anpassung“, die wirklich funktionieren kann, ist, das übermäßige Verbrennen von Kohlenstoff systematisch zu verringern.
Wie das geht, darüber sagt das Video nicht viel aus (außer ein paar Bildern von Solaranlagen und Windrädern, ganz sicher wichtige Beiträge zur Energiewende, die dafür unverzichtbar ist). Auf https://www.Passipedia.de gibt es eine Fülle von weiteren konstruktiven Beiträgen, wie der Wandel so gestaltet werden kann, dass die menschliche Zivilisation damit umgehen kann.
28. Dezember 2023
In vielen Teilen Deutschlands wird Hochwassergefahr gemeldet - auf Grund des anhaltenden Niederschlags. In einer Reihe von Posts in den 'Social Media' häufen sich die Klagen, dass in schon betroffenen Gebieten Menschen oft rücksichtslos agieren. Nun: Verwunderlich ist das eigentlich nicht. Um Probleme dieser Art zu vermeiden, ist es notwendig, die Ursachen rechtzeitig und konsequent zu bekämpfen: Die entscheidende Ursache hier ist der Klimawandel, der schon jetzt Extremwetterereignisse häufiger macht als in den vergangenen Jahrzehnten. Wie wir den Klimawandel eindämmen können, ist klar: Die Verbrennung fossiler Energieträger muss zügig und umfassend reduziert werden. Wie das geht, kann z.B. auf der folgenden Seite der Passipedia nachgelesen werden: Maßnahmen zur Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen.
Thema: Energiepreise
Gestern machte die Angabe der Bundesnetzagentur die Runde, dass wegen des Wegfalls von Subventionen die Strompreise für die meisten Verbraucher 2024 eher steigen werden (Quelle: "Tagesschau: Verbraucherpreise Strom 2024". „Die Zeit der billigen Energie sei vorbei, jedenfalls solange wir noch große Mengen konventionell erzeugter Energie verbrauchen“, so der Behördenchef Klaus Müller.
Wer die Struktur der Energiepreise kennt und weiß, dass für die Sicherung der Versorgung umfangreiche Maßnahmen an der Infrastruktur erforderlich sind, wird sich über diese Aussagen nicht wundern. Es gibt für die Verbraucher allerdings einen Weg, die Belastung durch steigende Energiepreise zu mildern: Wirksame Maßnahmen für höhere Energie-Effizienz durchführen. Dazu gehört vor allem die Wärmedämmung der Gebäude - aber auch von Rohrleitungen und Speichern, und der Austausch von Fenstern gegen solche mit guten Verglasungen und gedämmten Fensterrahmen. Alle diese Maßnahmen rechnen sich nämlich ziemlich gut: Sie liefern 'Einsparenergie' meist deutlich kostengünstiger als jede andere verfügbare Endenergiequelle. Das haben wir gerade durch die selbst ausgetesteten Maßnahmen im eigenen Umfeld erneut getestet: Tatsächlich sind die zugehörigen Materialkosten tragbar - und die Ausführung vieler Maßnahmen nicht allzu kompliziert. Es lohnt sich also, das z.B. auf unseren Seiten zu den baulichen Maßnahmen nachzuschlagen.
1. Januar 2024
Zu Neujahr 2024 liegen die Messdaten aus dem Dezember 2023 vor.
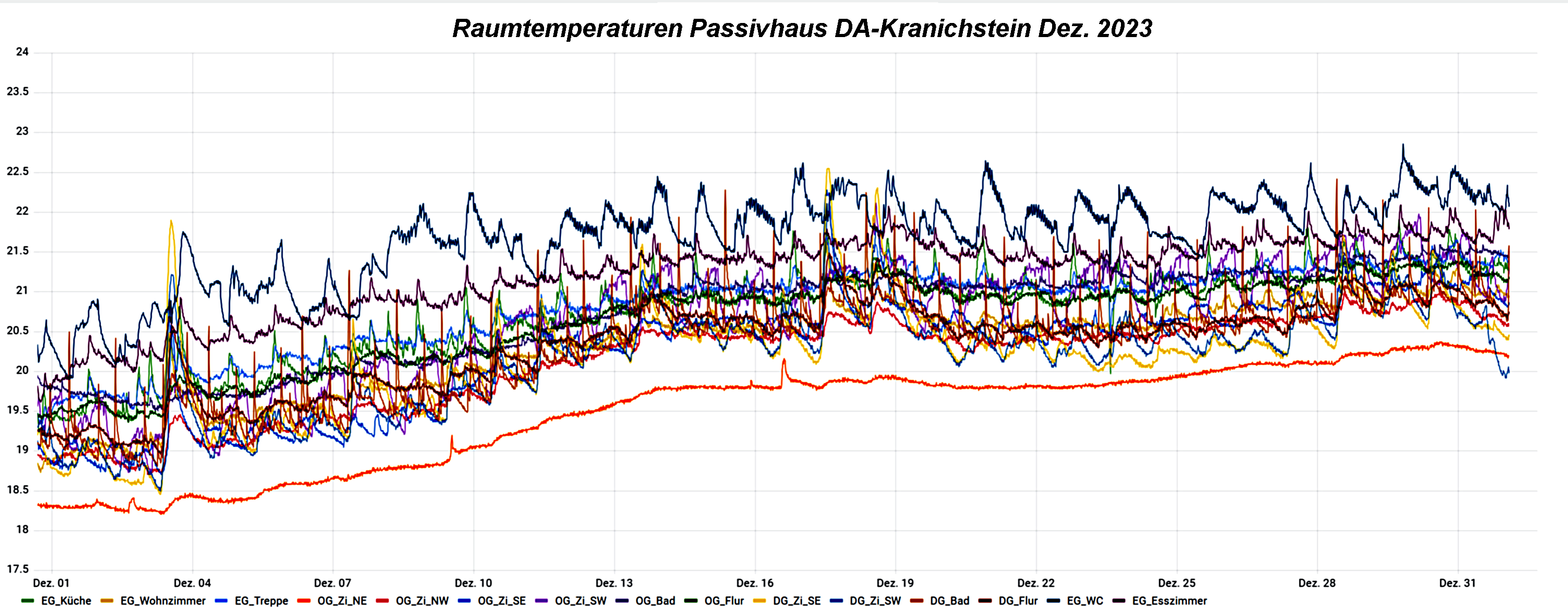
Der Verlauf der Raumtemperaturen im Dezember 2023.
Die ersten Tage im Dezember des letzten Jahres waren etwas kälter als im langjährigen Mittel. Im Diagramm ist leicht zu erkennen, dass im Haus die Temperaturen von Anfang Dezember bis zum 13.12. überall um durchschnittlich 1,5 Kelvin zunehmen. Dabei wirken drei Veränderungen zusammen:
- Das Splitgerät wurde etwas verzögert erst am 28. November in Betrieb genommen; seither wurde durch die Wärmeabgabe im Erdgeschoss die interne Wärmekapazität kontinuierlich weiter aufgeladen, bis die thermostatisch vorgewählte lokale Temperatur an der Installationsstelle des Gerätes, nämlich um 21,5 °C, erreicht wurde.
- Ab dem 10. Dezember nahmen auch die Temperaturen der Außenluft wieder auf zwischen 7 und 11 °C zu, so dass auch die Wärmeverluste inzwischen wieder geringer sind. Seit diesem Wetterumschwung war es in Darmstadt wieder wärmer als in dieser Jahreszeit gewohnt.
- Offenbar sind wir in diesem Winter auch schon wieder anspruchsvoller die Raumtemperaturen betreffend; wir sind damit nicht allein, auch die durchschnittlichen Verbrauchswerte an Erdgas für die Heizung lagen im Dezember 2023 wieder auf vergleichbarem Niveau wie vor der Erdgas-Krise. Diese beherrscht den Nachrichtenzyklus schon lange nicht mehr - eindringliche Apelle zum Energiesparen waren kaum zu hören.
Der Stromverbrauch für das Splitgerät lag im Dezember 2023 zwischen 300 und 560 Watt und summierte sich auf 309,42 kWh. Das ist eher hoch im Vergleich zu den Vorjahren (im Durchschnitt bei 248 kWh). Der Dezember war eher strahlungsarm, es gab also auch nicht viel passiv solare Gewinne. Trotzdem ist die benötigte Leistung mit rund 140 Watt pro Person so gering, dass dies keine bedeutende Last im Netz darstellt - ein Stromverbrauch in dieser Größenordnung kann aus erneuerbarer Energie auch in Mitteleuropa leicht bereit gestellt werden, auch wenn alle diesen Bedarf hätten424) .
26. Januar: Einfach nur alles elektrifizieren...
„Electrify everything“ - das ist das Schlagwort, das von zumindest einem Teil der Energiewirtschaft gern als das generelle Konzept einer nachhaltigen Energiewende präsentiert wird. Wir sind dem am Beispiel der Situation in Deutschland genauer nachgegangen, insbesondere im Bereich der (nahezu vollständigen) Elektrifizierung der Heizung. Die detaillierte Analyse dazu findet sich unter "Die Zunahme der elektrischen Last durch Wärmepumpen".
Kurze Zusammenfassung des Ergebnisses
Die zusätzlich (zur sonstigen winterlichen Maximallast) erforderliche gesicherte Leistung im deutschen Netz für Wärmepumpen beträgt gegenwärtig 54,7 GWel. Diese muss auch im Fall einer Flaute bereitstehen, da die Flauten mit den Höchstlastzeiten des Heizwärmebedarfs zusammenfallen können. Diese Last ist der Mittelwert über 7 Tage und beträgt etwa 76% des gesamten heutigen 7-Tages-Lastwertes. Dieser Wert gilt dann, wenn der Gebäudebestand wärmetechnisch auf dem Zustand der Jahre 2019-2022 verbleibt.
Die zusätzlich zu installierende Windkraftkapazität (Nennleistung) für die Versorgung dieses Bedarfs mit erneuerbarer Energie beträgt rund 100 GWInst. Das sind das etwa 1,45fache der heutigen Windkraftkapazität (69 GWInst). Dieser Installationsbedarf kommt zu dem bisher geplanten Ausbau dazu, d.h., es müssen rund 4 GWInst Windkraftleistung in jedem Jahr mehr installiert werden, als bisher vorgesehen.
Auch die Last im Netz nimmt auf allen Netzebenen im Winter dementsprechend stark zu. Hieraus ergibt sich ein hoher Bedarf an zusätzlichem Netzausbau.
Wie wir an verschiedener Stelle dokumentiert haben, lässt sich der Wärmebedarf der Gebäude im hier relevanten Umstellungszeitraum (das sind ca. 25 Jahre) durch Anwendung des EnerPHit-Konzeptes um rund 50% reduzieren; wegen der dadurch auch steigenden Effizienz der Wärmepumpen reduzieren sich die Werte für den zusätzlichen Leistungsbedarf bei der 7-Tages-Last auf unter 24 GW und bei der zusätzlich zu installierenden Windkraft auf rund 44 GWInst, das entspricht einem zusätzlichen Zubau von rund 1,75 GWInst in jedem Jahr. Auch das ist ein ehrgeiziges Ziel, nach unserer Einschätzung aber erreichbar.
Etwas Hintergrund zu diesen Zahlen: Durch die Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur lässt sich der Leistungsbedarf für die gasbeheizten Gebäude in Deutschland ermitteln; da rund 50% der Heizwärme aus Gas erzeugt wird und die Kesselwirkungsgrade mit um 90% bekannt sind, lässt sich daraus empirisch der Heizlastbedarf inkl. deutschlandweitem Gleichzeitigkeitsfaktor ermitteln. Mit einem Wärmebereitstellungsgrad (COP) der dafür im Ersatz zu installierenden Wärmepumpen ergibt sich so die zugehörige elektrische Last im Netz. Daraus lassen sich die Lastwerte für unterschiedliche Durchdringungsgrade der Wärmepumpen (Standardannahme hier: 70%) und unterschiedlichen Wärmeschutzstandard der Gebäude ermitteln.
„Einfach nur elektrifizieren“ ist daher im Bereich der Heizwärme für Gebäude eine stark vereinfachte Sicht: Die hier im Winter auftretenden zusätzlichen Lasten liegen in der Größenordnung der heutigen Gesamtlast. Die Lage entspannt sich, wenn der Wärmebedarf der Gebäude reduziert wird, wie das z.B. in "Potentiale des verbesserten Wärmeschutzes" beschrieben wird.
Fazit: Die überwiegende Elektrifizierung der Raumwärmeversorgung durch Wärmepumpen in Deutschland kann funktionieren, wenn die thermische Qualität der Gebäude in angemessener Weise verbessert wird.
29. Februar 2024: ENBIL jetzt online verfügbar
ENBIL - das ist ein interaktives Programm für die Energieberatung. Es erlaubt eine stark vereinfachte Eingabe von Gebäudedaten:
- Architekturtyp, Baujahr und einige Abmessungen werden interaktiv eingegeben.
- Aus einer Datenbank mit typischen Kennwerten der jeweiligen Baualtersklasse schätzt das Programm dann den Aufbau der Gebäudehülle ab. Diese Daten können noch verfeinert werden, wenn der Nutzer mehr über die Bauteile weiß (z.B. eine schon erfolgte nachträgliche Dämmung).
- Auch die Heiztechnik wird aus einem Menü ausgewählt…
- Und, wenn gemessene Verbrauchswerte aus einem Bestandsgebäude vorliegen, können auch die mit angegeben werden.
Aus einem so erzeugten Datensatz für das Gebäude kann ENBIL eine Energiebilanz für ein Standardjahr erstellen - auch hier können Nutzer dann unterschiedliche Standorte aus einer Liste auswählen.
In weiteren Schritten gibt es 'Maßnahmenlisten' aus denen die Nutzer unterschiedliche Maßnahmen zur Einsparung von Heizenergie und Warmwasserkosten auswählen können. Diese werden mit Investitionskostenschätzungen angeben und zur Orientierung gibt es auch bereits eine Angabe, wie 'teuer' die Bereitstellung einer kWh Einsparenergie mit einer solchen Maßnahme sein wird. Damit können für Gebäude und konkrete Maßnahmen schon einmal eine Orientierung für die Auswahl energiesparenden Maßnahmen gegeben werden.
Bei der Nutzung von ENBIL entstehen keine Kosten - Ihre Daten und ihre Adresse werden Dritten nicht zugänglich gemacht, sie erhalten keine Produktwerbung. Wir empfehlen für eine erfolgreiche Sanierung die Wahrnehmung einer unabhängigen Energieberatung - diese kann dann auch auf evtl. verfügbare Fördermöglichkeiten eingehen. Für alle, die konkret etwas an ihrem Gebäude verbessern wollen, stellen wir auf den Seiten von JETZT detaillierte Beschreibungen von Maßnahmen zur Verfügung, die wir selbst in der Praxis ausgetestet haben: ENBIL erlaubt es, in Ihrem konkreten Fall den Aufwand und die Wirtschaftlichkeit nachzurechnen.
 Hier finden Sie den Link zum Einsatz von ENBIL: ENBIL starten.
Hier finden Sie den Link zum Einsatz von ENBIL: ENBIL starten.
17. März 2024: Rückblick Winter 2023/24
Am 9. März konnten wir das Splitgerät abschalten - die Temperaturen im Haus waren jetzt überall auf über 21,3 °C angestiegen und sie halten sich oberhalb dieser Temperatur auch ohne aktive Heizwärmezufuhr: Erfahrungsgemäß ist die Heizzeit für das Passivhaus damit für diesen Winter beendet, denn ab Mitte März gibt es regelmäßig immer wieder Tage mit recht hohen Solarstrahlungsangeboten, die dann reichen, die Temperaturen anzuheben, sollte es doch noch einmal wirklich kalt werden. Letzteres ist selbst für den April nicht sicher auszuschließen, es wird aber nicht dazu führen, dass es im Haus mit der jetzt nachhaltig wieder aufgeladenen inneren Wärmekapazität spürbar kälter wird.
Die Außentemperaturen im November, Dezember und Februar lagen auch in diesem Winter deutlich über den langjährigen Mittelwerten - waren aber mit unter 7,6 °C doch niedrig genug, um einen Heizbetrieb auch in unserem Passivhaus zu erfordern. Zwischen dem 11. und dem 24. Januar gab es eine ausgeprägte Kälteperiode mit zugleich nur geringen Solareinträgen: An diesen Tagen nahm der Stromverbrauch des Splitgerätes auf Werte zwischen 500 und 620 Watt zu. Auch der Gasverbrauch der gasbeheizten Wohnungen in Deutschland wies in diesen beiden Wochen eine ausgeprägte Spitze auf.
Der gesamte Stromverbrauch für die Heizung mit dem Splitgerät lag in diesem Winter bei 906,7 kWh oder 5,8 kWh/(m²a). Im Zeitraum des Heizbetriebs lag die Gesamtstromerzeugung unserer Photovoltaik-Anlage bei 203 kWh. Der so erzeugte Strom wird natürlich für die üblichen Haushaltsanwendungen verbraucht und kann auch diese nicht vollständig decken: Es bestätigt sich wieder, dass der Beitrag der Photovoltaik zum Heizbetrieb vernachlässigbar gering ist. Erneuerbarer Strom für den Betrieb der Gebäudeheizung muss weit überwiegend durch Windenergieanlagen erzeugt werden; das ist in jedem Fall auch in der Zukunft in Verbindung mit Wärmepumpen die kostengünstigste Option für den Heizbetrieb425) .
Mit dem hier verwendeten Split-Klimagerät als Heizung ist eine besonders günstige Alternative gegeben: Wie nun in 7 Jahren Betrieb erfahren, reicht ein solches Gerät selbst in einer mehrgeschossigen großen Passivhaus-Wohnung aus, dauerhaft komfortable Bedingungen im Raum zu garantieren - bei extrem niedrigen Kosten für den dazu verwendeten Strom: Das waren etwa 300 € für das ganze Jahr; üblicherweise betragen die Kosten für die Heizung in ähnlich großen Wohnungen um 2000 € pro Jahr. Die Anschaffungskosten für ein Splitgerät liegen dabei bei rund 3000 €. Natürlich reicht diese Lösung mit nur einem solchen Gerät in durchschnittlichen Wohnungen im Bestand, die rund das Zehnfache an Wärmebedarf aufweisen, nicht allein aus. In "Verwendung eines Raumklimagerätes zur Heizungsergänzung" haben wir untersucht, welchen Beitrag ein solches Gerät in einer Wohnung im Bestand aber trotzdem leisten kann: Wir waren selbst überrascht, dass Anteile von bis hin zu rund 50% an der Heizwärme über das Jahr hinweg erreicht werden können. Derzeit ist die so erzeugte Heizwärme allerdings immer noch etwa gleich teuer wie alle anderen Optionen zur Heizung. Das kann sich künftig mit weiter teurer werdender fossiler Energie und mit zugleich steigendem Anteil kostengünstiger erneuerbarer Stromerzeugung aber ändern. Wirklich Energie, Emissionen und Kosten spart der Wohnungseigentümer aber, wenn bei Gelegenheit Schritt für Schritt der Wärmeschutz der Wohnung verbessert wird. Wie das praktikabel geht, haben wir unter "bauliche Maßnahmen zur Energiekosteneinsparung" beschrieben. Diese Maßnahmen addieren sich in ihrer Wirkung - und mit jeder solchen Verbesserung sinkt die Heizlast der Wohnung. Dadurch nimmt der Anteil zu, der mit der Wärmepumpe gedeckt werden kann - und die erforderliche Kondensationstemperatur der Wärmepumpe nimmt ab, wodurch deren Effizienz zusätzlich verbessert wird. Schritt für Schritt kann so ein leistbarer Übergang von der fossilen Heizung zu einer nachhaltigen Lösung durchgeführt werden.
Innentemperaturen Januar bis März 2024
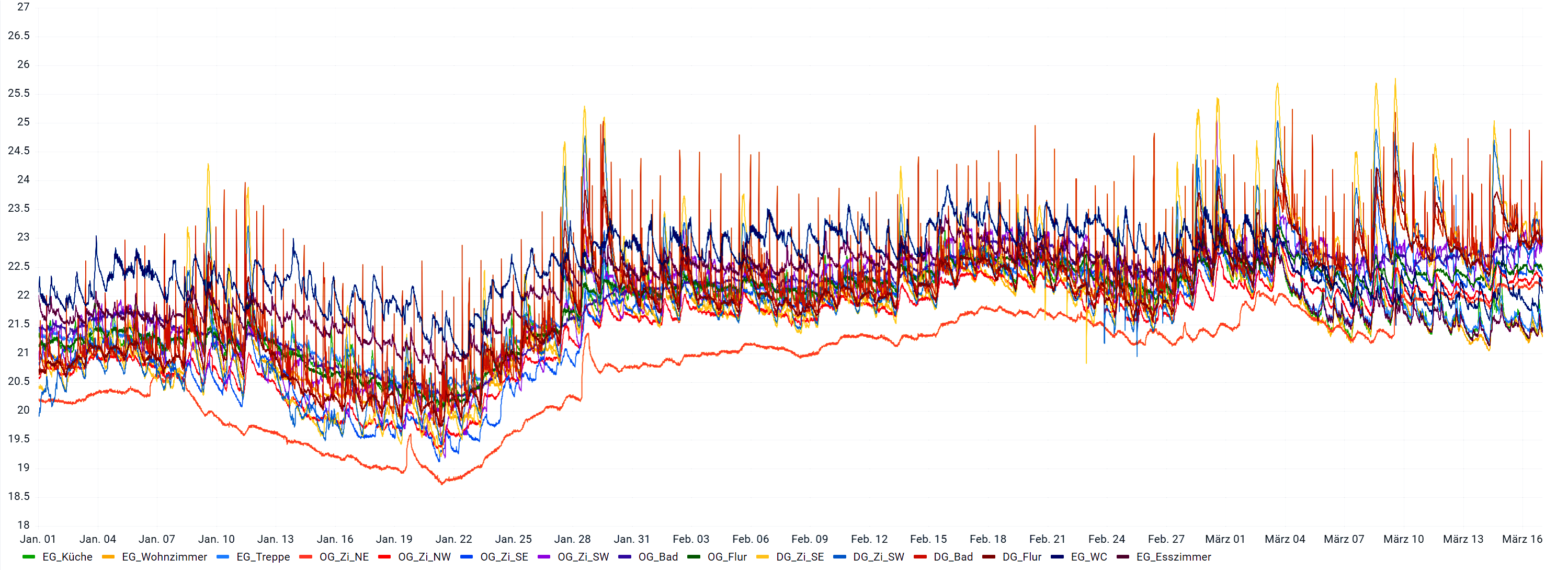 Mit dem Diagramm ergänzen wir die Temperaturverlaufswerte für alle Räume in der messtechnisch erfassten Wohnung im Jahr 2024. Erkennbar ist ein langsamer Rückgang der Temperaturen in der Kälteperiode zwischen 14. und 21. Januar - wobei innerhalb der Aufenthaltsbereiche während Aufenthaltszeiten in den genutzten Räumen die Temperaturen zwischen 19,6 und 21,5 °C verbleiben - der Raum OG-Nord/Ost wird, wie auch schon im vergangenen Winter, bis zum 2. März bewusst aus dem zu beheizenden Volumen ausgenommen426) . Ab dem 9. März ist das Splitgerät im Esszimmer (EG-Nord) nicht mehr in Betrieb, zeitgleich wurde auch die Tür zu OG-Nord/Ost geöffnet. Während sich das Temperaturniveau im Haus dadurch kaum verändert (jeweils zwischen 21,1 und 23,5 °C), so tauschen jetzt alle Temperaturen im Erdgeschoss von EG-Nord über Küche und Treppenhaus (unten) zu Wohnzimmer in den unteren Rand es Feldes ab (21.1 bis 21.8 °C).
Mit dem Diagramm ergänzen wir die Temperaturverlaufswerte für alle Räume in der messtechnisch erfassten Wohnung im Jahr 2024. Erkennbar ist ein langsamer Rückgang der Temperaturen in der Kälteperiode zwischen 14. und 21. Januar - wobei innerhalb der Aufenthaltsbereiche während Aufenthaltszeiten in den genutzten Räumen die Temperaturen zwischen 19,6 und 21,5 °C verbleiben - der Raum OG-Nord/Ost wird, wie auch schon im vergangenen Winter, bis zum 2. März bewusst aus dem zu beheizenden Volumen ausgenommen426) . Ab dem 9. März ist das Splitgerät im Esszimmer (EG-Nord) nicht mehr in Betrieb, zeitgleich wurde auch die Tür zu OG-Nord/Ost geöffnet. Während sich das Temperaturniveau im Haus dadurch kaum verändert (jeweils zwischen 21,1 und 23,5 °C), so tauschen jetzt alle Temperaturen im Erdgeschoss von EG-Nord über Küche und Treppenhaus (unten) zu Wohnzimmer in den unteren Rand es Feldes ab (21.1 bis 21.8 °C).
20. März 2024; Ein paar Gedanken zur Wohnungslüftung
Gerade habe ich es in einer Diskussion nach dem Vortrag über eine Beispielmodernisierung wieder gemerkt: Wir pflegen in Deutschland seit Jahrzehnten Vorbehalte gegen die mechanische Wohnungslüftung. Es ist an der Zeit, das gründlich zu überdenken; ein paar Überlegungen dazu:
- Ich kann es nachvollziehen: In den 70ger Jahren in Deutschland, insbesondere in für den Umweltschutz engagierten Kreisen - da war alles „Mechanische“ verdächtig; auch ich kannte Lüftung eigentlich nur als riesige Kanalinstallation, laut und zugig - genutzt zur Klimatisierung von innenliegenden unbelichteten Räumen im Neubau unserer Schule; es war ein Grauen.
- Anfang der Achtziger Jahre besuchte ich Schweden und traf dort die Experten zum Thema Wohnhygiene: In diesem Kreis war es 100% Konsens, dass dies ohne geregelte Lüftung vernünftig nicht wirklich funktioniert: „Wenn ich frische Luft da haben will, wo sie hin muss, dann muss ich sie dorthin bringen“ haben sie mir erklärt - und ich habe das, Jahrzehnte in Deutschland sozialisiert, zunächst vehement abgelehnt (nach dem Motto: Wir machen das besser.). Aus den Erfahrungen und aus mannigfachen Publikationen in Schweden zu diesem Thema wurden mir dann aber innerhalb von ein paar Monaten die Zusammenhänge klar. Wieso, das steht in den nächsten Punkten.
- Irrtum 1: Es geht dabei eben nicht um das Heizen oder Kühlen mit Luft (wofür regelmäßig diese hohen Luftmengen gebraucht werden; das wird dann teuer und meist auch laut). Es geht um frische Luft - auch keine Umluft, sondern frische Außenluft, von der eine Person rund 30 m³ in jeder Stunde braucht, um gesund atmen zu können. Das sind keine riesigen Luftmengen - durch ein gekipptes Fenster kommen, je nach Wind, zwischen 15 und 90 m³/h herein - nur, dass wir eben heutzutage kaum dauerhaft Fenster gekippt halten. Und dass es eben Zufall ist, ob gerade genug Wind weht, um ausreichend zu lüften.
- Irrtum 2: Es wird immer angenommen, „normalerweise“ hätten wir doch durch 'natürliche Lüftung' genügend frische Luft. Genau das ist aber leider nicht richtig - die üblichen Frischluftmengen sind in einer großen Zahl von Wohnungen unzureichend, unter 10 m³/Person, vor allem in der Nacht. Wir haben das mehrfach nachgemessen427) . Zuletzt haben wir alle es wieder während der Pandemie bemerkt - diese unzureichenden Luftmengen sind die Hauptursache für die im Winter steigenden Ansteckungszahlen. Die Wohnungslüftung, wie wir sie empfehlen, sichert genau den unbedingt erforderlichen hygienisch notwendigen Luftaustausch - und bringt die Frischluft dahin, wo sie gebraucht wird (in die Wohn- und Schlafräume).
- Irrtum 3: Ganz oft missverstanden wird der Einfluss der winterlichen Lüftung auf die Luftfeuchte im Innenraum: Je mehr ich lüfte, desto trockener wird die Luft im Raum (hier genauer erklärt: Grundlagen zum Thema feuchte Luft.). Mit einer geregelten Wohnungslüftung lässt sich die Luftfeuchtigkeit zu allen Jahreszeiten wie gewünscht einstellen. Auch das ist ein Beitrag zur Wohngesundheit, aber insbesondere wichtig für den Bautenschutz. Wird die Innenluft durch mangelnde winterliche Lüftung nämlich zu feucht, dann ist die Gefahr von Tauwasser stark erhöht; das genau war die Ursache mancher 'Probleme mit neuen Fenstern'. Mit einer geregelten Wohnungslüftung sind diese Probleme gelöst.
- Irrtum 4: Wohnungslüftungsanlagen machen Lärm. Es gab solche (und gibt am Markt leider auch immer noch solche); deswegen legen wir bei der Zertifizierung auf extrem leisen Betrieb in Wohn- und Schlafräume großen Wert. Alle Hersteller mit Zertifikat haben das übrigens auch geschafft - es ist allein eine Frage des Know-hows, insbesondere die Körperschallentkopplung der Lüfter ist dabei wichtig: Die Werte in den Aufenthaltsräumen bekommen wir immer unter 25 dB(A) herunter.428)
- Irrtum 5: „Das verbraucht doch alles nur zusätzlich unnötig Strom.“ Auch das hat für manche Altanlagen in Schulen und Hallen manchmal gestimmt. Durch die saubere Auslegung (auf Lufthygiene und NICHT auf Heizung oder Kühlung) sind die Luftmengen jedoch erheblich angemessener und die Querschnitte so geplant, dass es kaum noch große Druckverluste gibt. Wichtigste Innovation waren aber die elektronisch kommutierten Lüftermotoren - die heute auch in jedem PC verbaut werden. Die sind insbesondere im Teillastbetrieb um rund einen Faktor 4 effizienter als es die alten Ventilatoren waren. Zuletzt kommt die Wärmerückgewinnung zur Hilfe, die rund 80% der Wärme aus der Abluft zurückholt - alle diese Innovationen zusammen führen dazu, dass eine zertifizierte Passivhaus-Lüftungsanlage mit einer Kilowattstunde Strom etwa 8 bis 10 kWh Heizwärme einspart; so gut ist kein alternativer Wärmeerzeuger. Lüftung diese Qualität sichert damit nicht nur gute Luft in der Wohnung, sie spart zugleich auch noch Energiekosten und CO2-Emissionen.
- Irrtum 4: „Da hole ich mir doch Staub und Keime in die Wohnung…“. Ganz im Gegenteil, die zertifizierten Passivhaus-Anlagen sind mit qualifizierten Feinfiltern ausgestattet: Der schädliche Feinstaub bleibt draußen, inklusive aller Keime; auch das haben wir mehrfach im Betrieb nachgemessen [Feist, Pfluger 2016]. Die Filter und deren Wechsel kosten einen jährlichen Wartungsaufwand: Das liegt in einem Bereich zwischen 25 und 100 € je Wohnung und das lohnt sich in jedem Fall, es trägt erheblich zur Lebensqualität bei.
Schlussfolgerung: unsere generelle Empfehlung
Lüftung mit Feinfilter und Zuluftführung gehört heute zu den wichtigsten Aufgaben der Wohnhygiene. Die Innenraumluftbelastung wird dadurch messbar und nachhaltig verbessert, die CO2-Konzentrationen sinken, die Luftfeuchtigkeit bleibt aber im empfohlenen Bereich, Außenlärm und Feinstaub bleiben draußen. Zugleich spart die Wohnungslüftung zusätzlich Energie und bietet erhöhten Komfort im Winter und im Sommer: Empfehlenswert!
Wie bei den Bauteilen der Gebäudehülle empfehlen wir bei der Wahl der Lüftung ebenfalls das Motto „Wenn schon, denn schon“. Die Hauptinvestitionskosten fallen bei den Bohrungen, Kanälen, Verkleidungen und Montagen an - da lohnt sich eine gute Planung429) ; die zentralen Geräte werden nicht bedeutend teurer, wenn sie höhere Effizienz und weniger Laufgeräusche aufweisen: Diese wenigen Euro Zusatzkosten lohnen sich allemal. Eine weiter Erfahrung war übrigens: Diese Lüftungsanlagen sind lange haltbare technische Systeme; allenfalls die Lüfter selbst (rund 40 € je Stück) müssen evtl. nach einem Jahrzehnt getauscht werden - in unserem Passivhaus-Prototyp in Kranichstein laufen über 60% der urspr. eingebauten Lüfter auch nach 30 Jahren immer noch - und die Kanalnetze bleiben dank der hochwertigen Filter dauerhaft sauber und Abnutzungs- sowie korrosionsfrei.
Hinweise, wie das auch in bestehenden Wohnungen nachgerüstet werden kann: Nachrüstung von Lüftungsgeräten im Gebäude-Bestand.
Eine Bemerkung zu den sozialen Auswirkungen sei in diesem Zusammenhang erlaubt, gerade weil das in letzter Zeit von verschiedener Seite angesprochen wurde:
- Ist die bessere Wohnungslüftung ein Luxus der Reichen auf Kosten der weniger Wohlhabenden430) ?
- Die bessere Luftqualität ist kein Luxus - sie dient vielmehr der hygienischen Gesundheitsvorsorge. 'Braucht man die' jetzt nur, weil die Reichen derzeit die Luft auf Kosten der Anderen im Übermaß verpesten? Dass wir, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten die Außenluft mehr belasten, als dies zuträglich ist, ist richtig: Es ist vor allem der Feinstaub, der dabei die größte Verschmutzung darstellt - und dieser Staub kommt überwiegend aus dem Verkehr (Verbrennungsmotoren und Reifenabrieb). Dass 'die Reichen' dazu in überproportionalen Maß beitragen ist nicht gesichert: Es kommt dabei auf die Frequenz des Autofahrens und die Qualität der Motoren und Abgassysteme an431) . Ein weiterer Teil der Feinstaubbelastung kommt aus dem Betrieb der Heizungen, wenn diese mit Feuerungen betrieben werden. Diese Emissionen werden umso geringer, je geringer der Heizwärmebedarf ist - eine energieeffiziente Lüftung verringert somit die Feinstaubbelastung auch für die Umwelt; wird insgesamt ein Umstieg auf erneuerbare Energie möglich - und das funktioniert bei energieeffizienten Gebäuden - dann geht diese Quelle der Belastung sogar auf nahe Null zurück. Die Verbesserung der Luftqualität im Wohnraum geht somit nicht auf Kosten der Anderen, im Gegenteil, sie entlastet die Umweltverschmutzung; diese Technik ist daher ein gutes Beispiel für eine Win-Win-Situation: Die Nutzer der Technik haben dadurch persönliche (gesundheitliche) Vorteile - und reduzieren zugleich die Belastung für die Allgemeinheit.
- Die Luftbelastung in der Außenluft ist darüber hinaus keinesfalls allein 'menschengemacht'. Stäube, auch ungesunde, kommen auch aus natürlichen Quellen (Windeintrag, Vulkane) und Allergene aller Art sind für viele Menschen ein Problem. Der wichtigste Hygienebeitrag der Wohnungslüftung ist aber die gesicherte Abfuhr der Innenraumluftbelastungen: Die Staub-, Mikroben-, CO2- und Geruchsstoffeinträge, die durch unsere Wohnnutzung in den Räumen entstehen, werden auf ein gesundheitlich akzeptables Maß reduziert. Das gleiche gilt für Radon im Wohnraum und für Feinstäube aus der Küchennutzung - allein dies kann uns Hunderte Lungenerkrankungen in jedem Jahr ersparen.
- Sind diese Systeme so teuer, dass sich das nur die Reichen 'leisten' können? Auch das ist nicht richtig - für rund 6000 € ist in einer Bestandswohnung eine hygienisch gute Lüftungslösung nachrüstbar. Das sind, bei 2% Realzins und (mindestens!) 30 Jahren Nutzungszeit 22 € im Monat; bilanzieren wir die Strom- und Filterkosten mit und rechnen die Heizkosteneinsparung gegen, dann bleiben davon rund 8 € im Monat 'übrig'. Ist uns das die bessere Luftqualität Wert? Der Gesetzgeber müsste dies eigentlich wegen der Entlastung der Krankenkassen längst fordern - und es spricht auch nichts dagegen, die Systeme auf Basis ihrer Umweltwirkung (weniger CO2 und weniger Feinstaub) im sozialen Wohnungsbau zu fördern; es handelt sich mit um die kostengünstigsten Klimaschutz-Maßnahmen überhaupt - mit zusätzlichem die Lebensqualität steigernden Effekt.
28. März 2024: Rückblick über die bisherige Betriebszeit 2017 bis 2024
Das Splitgerät ist jetzt in dieser Wohnung seit 7 Jahren im Betrieb 432) . Das Diagramm zeigt die gemessenen monatlichen Stromverbrauchswerte des Systems im Winter. Im Mittel ergeben sich für eine Heizperiode 806 kWh oder 5,2 kWh/(m²a), wobei die mittlere Jahresarbeitszahl für den Heizbetrieb bei HSPF433) =2,08 lag. Die wetterbedingte Streuung zwischen den Jahren liegt bei rund ±20%.
Damit gibt es eine Untergrenze für die Lebenszyklus-Standzeit solcher Geräte; einen nennenswerten Kältemittelverlust gibt es bisher nicht, dies wäre im Betrieb bemerkbar; das System lief seit 2017 ohne Störung. Im Diagramm sind auch die theoretisch nach dem Passivhaus Projektierungspaket [PHPP] prognostizierten Strombedarfswerte für das langjährige Standardklima in Darmstadt eingetragen (hellgelbe Säulen). Diese liegen leicht höher (+12%), die wesentliche Ursache für die Abweichung ist das durch den Klimawandel mildere Wetter am Standort.
Zum auffällig höher berechneten Wert für den November (rechnerisch 144 kWh; im Mittel der Jahre gemessen: 74 kWh) gibt es einen Beitrag, der systematisch bedingt ist: Mit dem Monatsverfahren wird Wärme, die an den Monatsgrenzen z.B. vom Oktober in den November übertragen wird, nicht berücksichtigt. Hierbei fließt aber auch ein nicht unbedeutender Anteil von Nutzergewohnheit ein. Generell kann ein 'besonders energiegerechtes' Verhalten hier nicht unterstellt werden. Im konkreten Fall, in dieser Wohnung, erlauben wir als Bewohner es regelmäßig, dass das Haus eine mittlere Temperatur von über 23 °C gegen Ende September aus den sommerlichen Solarüberschüssen behält - die zugehörige Wärme wird in der Gebäudekapazität gespeichert; die Heizung geht erst bei Temperaturen unter rund 21°C in Betrieb - diese Differenz macht rund
$Q_{kap}= \Delta \theta \cdot C = \text{3 K} \cdot \text{30 kWh/K} = \text{90 kWh}$
Heizwärmebedarf aus. Natürlich ist auch ein Nutzerverhalten vorstellbar, bei dem auch noch Ende September und bis zum unvermeidbaren Betrieb der Heizanlage die Fenster eher in der vom Sommer her gewohnten Weise regelmäßig längere Zeit geöffnet werden: Dann werden die 90 kWh aus der Gebäudekapazität innerhalb weniger Tage abgegeben, die Heizzeit beginnt nun früher und der Heizwärmebedarf für November wird bei einer solchen Betriebsweise näher an dem durch das PHPP berechneten Wert liegen434))lt;nowiki> \</nowiki> frac {0,6}{70}=0.86 \ %$, also geringer als 1%. Wir müssen also vorsichtig sein bei der Bewertung solcher Strategien der Energieeinsparung: Sie hängen einerseits von einem bewusst durchgeführten aktiven Nutzerverhalten ab - und sie sind andererseits in ihrem Beitrag bei wenigen einstelligen Prozentwerten begrenzt.)) .
An dieser Stelle drei Punkte zur Einordnung435) :
- Dieses Splitgerät bringt für die hier versorgte Wohneinheit (156 m²) den gesamten Heizwärmebedarf auf - es gibt KEINE zusätzliche Heizung. Natürlich gibt es andere interne Wärmequellen, wie z.B. drei Personen, die sich überwiegend hier aufhalten und einen mittleren Stromverbrauch für die Computer436) , den Kühlschrank, Spülmaschine, Licht etc. in Höhe von durchschnittlich rund 300 Watt im Winter.
- Die Komfortbedingungen in der Wohnung waren in allen Aufenthaltsräumen und zu allen Nutzungszeiten komfortabel (vgl. frühere Berichte in diesem Blog).
- Der sehr geringe Verbrauch begründet sich daher nicht durch ein besonders sparsames Verhalten - sondern vor allem durch den ausgezeichneten Wärmeschutz dieses Gebäudes.
- Die hier gemessenen Stromverbrauchswerte für die Splitgeräte-Heizung liegen rund einen Faktor 8 unter den Werten, die bei einer Ausrüstung eines 'durchschnittlichen' Gebäudes im Bestand in Deutschland mit einer Wärmepumpe für die Heizung zu erwarten sind. Das ist ein beträchtlicher Betriebskostenunterschied: Bei rund 28 Cent/kWh Stromkosten437) liegen die Heizkosten im hier dokumentierten Gebäude bei rund 226 € im Jahr (!), in dem durchschnittlichen Referenzgebäude dagegen bei rund 1860 €/a438) . Umgerechnet auf monatliche Heizkosten je Quadratmeter sind dies für den durchschnittlichen Bestand rund 1 € pro m² und Monat, für die hier beschriebene Lösung aber nur 12 €Cent/(m²mon).
30. März 2024: Zur Wirtschaftlichkeit der besseren Energieeffizienz im konkreten Fall
Immer wieder haben wir zur Kostenbetrachtung zum letzten Eintrag den Einwand gehört, dass dies nur mit hohem anfänglichem Investitionsaufwand erkauft wurde. Für dieses Prototyp-Gebäude als Passivhaus hatten wir 1990 während des Baus alle Kosten 'pfenniggenau' dokumentiert, da es sich um ein Forschungsprojekt handelte. Damals waren z.B. dreischeibenverglaste Wärmeschutzfenster am normalen Markt gar nicht erhältlich und sie mussten in einer Sonderanfertigung eigens produziert werden. Die 1990 dokumentierten baulichen Mehrinvestitionen lagen dann auch bei 321,20 €/m² (Wohnfläche) inkl. aller Besonderheiten und des Planungsmehraufwandes. Für einen regulär privat finanzierten Bau war das damals 'viel Geld', es machte 18% (!) der Baukosten (Kostengruppen 300+400) aus. Legen wir nun nachträglich diese investiven Ausgaben zu 3,5% effektivem Jahreszins auf 50 Jahre (Mindestnutzungszeit des Gebäudes) um, so ergeben sich rund 1270 € pro Jahr an Kapitalkosten (real) für den Mehraufwand des Passivhaus-Baus439) , das entspricht weniger als 68 €Cent/(m²mon) auf die Wohnfläche bezogen. Zusammen mit den oben nachgewiesenen Betriebskosten von 12 €Cent/(m²mon) sind das 80 €Cent/(m²mon), somit um rund ein Fünftel geringere Gesamtkosten als in dem Fall, dass 1990 ein 'herkömmliches Gebäude' ohne Mehrinvestition gebaut worden wäre und jetzt mit einer Wärmepumpe beheizt würde440) . Interessanterweise liegen die Lebenszyklus-Gesamtkosten bei diesem Passivhaus-Prototyp, trotz des Experimental-Charakters und der damit auftretenden erheblich höheren Kosten durch Sonderfertigungen, bereits unter denen eines konventionellen Gebäudes.
Heute sind alle für den Passivhaus-Neubau erforderlichen Komponenten marktgängig als industriell gefertigte Produkte erhältlich; in vielen Fällen sind diese kaum teurer als ihre 'konventionellen' Vergleichsprodukte. Dementsprechend sind in den letzten Jahren an mehreren Standorten Passivhaus-Neubauten entstanden, deren dokumentierten baulichen Mehrinvestitionen zwischen 80 und 120 €/m² liegen441) . Das ist nur noch rund ein Drittel der damaligen Kosten beim Prototypen. Mit diesem Kostengerüst liegen die jährlichen Gesamtkosten im Lebenszyklus bei weniger als der Hälfte der Vergleichswerte mit einer weniger energieeffizienten Bauweise. Energieeffizienz auf dem hier gewählten Niveau ist erkennbar ökonomisch ganz besonders attraktiv. Dies gilt sogar ohne Einbeziehung evtl. angebotener Förderungen; allerdings nur, wenn auch korrekt über den gesamten Lebenszyklus gerechnet wird.
Wir gehen auf drei Einwände ein:
- Der Betrachtungszeitraum sei zu lang angesetzt: Dass ein heute vernünftig realisierter Neubau eine Nutzungsdauer von mehr als 50 Jahren aufweist, kann nicht bestritten werden442) . Dass auch die Einzelkomponenten (bis auf Heizkessel und Wärmepumpen) mindestens diese Nutzungszeiträume aufweisen, wurde in [AkkP 60] behandelt und bestätigt. Dass der „wirtschaftlich finanzmathematisch“ anzusetzende Betrachtungszeitraum z.B. wg. Risiken geringer anzusetzen wäre - ist bei sorgfältiger Betrachtung nicht richtig; wird das trotzdem gemacht, so sind die Restwerte der Komponenten nach dem kürzer gewählten Zeitraum zu berücksichtigen443) .
- Der Kalkulationszinsfuß sei zu niedrig angesetzt: Hypothekendarlehen sind heute bei rund 3,5% nominalem effektivem Zinsfuß für kreditwürdige Baufamilien oder Eigentümer von Bestandsimmobilien zu erhalten 444) . Auch wenn deren Zinssätze nicht auf viele Jahrzehnte fix angeboten werden, so kann doch von einer späteren Umschuldung der Restschuld mit auch in Zukunft nicht höheren Zinsen ausgegangen werden. Woher diese Einschätzung kommt, wird aus dem Blog-Beitrag zur Wachstumsdebatte verständlich: Die realen Zinsen können im Mittel nicht über das Niveau des allgemeinen wirtschaftlichen Wachstums ansteigen445) .
- Die Mehrinvestitionen seien in Wahrheit viel höher: Dass es einfach ist, erhöhte Baukosten zu verursachen, kann nicht bezweifelt werden. Die Ursachen dafür sind aber andere als solche, die auf eine bessere wärmetechnische Qualität der Komponenten zurück zu führen sind. Wir wollen hier keine lange Liste der von uns gemachten Erfahrungen zu den Ursachen erhöhter Kosten am Bau anführen446) , ich beschränke mich hier auf ein paar Beispiele:
- Hochwertige Verkleidungen: für modisch gestaltete Fenster oder edle Fassadenoberflächen447) .
- Unnötig überhöhte Geschosshöhen: Mehr als einmal wollten Unternehmen darauf bestehen, dass für 'die Unterbringung der Lüftungskanäle' ein Passivhau-Neubau eine höhere Geschosshöhe als für ein Normalgebäude benötigen würde - in den Fällen, in denen wir dazu überhaupt gefragt wurden, konnten wir dies regelmäßig vermeiden. Lüftungskanäle in großen Längen weisen ohnehin auf eine wenig optimale Planung hin; aber selbst solche sind als Deckenkanäle am Rand der Räume immer gestalterisch ansprechend unterzubringen, dafür bedarf es keiner Deckenabhängung448) . Selbstverständlich führen erhöhte Geschosshöhen oft zu beträchtlichen Mehrkosten - diese haben aber andere Ursachen als die verbesserte Energieeffizienz.
- Nachlässige Planung der Luftdichtheit: Die substantielle Verbesserung der Luftdichtheit einer Außenhülle im Neubau erfordert am Bau keine nennenswerten Zusatzkosten, wenn die Lösungen von den Planern von Anfang an durchdacht werden.
- Angstzuschläge bei der Installation von Heizsystemen: Tatsächlich haben wir immer wieder erlebt, dass Planer der Zuverlässigkeit der reduzierten Heizlastwerte „nicht trauen“ und trotzdem die gesamte Fläche belegende Fußbodenheizungen oder grob überdimensionierten Heizkörper und Wärmeerzeuger einbauen lassen. In einem Passivhaus können Heizkörper übrigens überall im Raum eingebaut werden, z.B. auch einfach oberhalb einer Innentür am Türsturz oder hinter der aufschlagenden Tür. So lassen sich erheblich kürzere Leitungslängen erreichen und sogar Kosten gegenüber konventionellen Installationen reduzieren. Etwas größere Heizkörper (z.B. sechslagig) sind übrigens kaum teurer und sie erlauben in energiesparenden Gebäuden eine niedrigere Vorlauftemperatur bei Wärmepumpenlösungen, ohne dass eine deutlich teurere Fußbodenheizung realisiert werden muss.
Der Mehrwert eines energieeffizienten Neubaus oder einer energieeffizienten Sanierung ist quantifizierbar: Er beträgt mindestens die Höhe des Barwerts der dadurch eingesparten Energie. Meist gibt es zugleich weiteren Mehrwert: Wie künftig kleiner dimensionierte Wärmeerzeuger- und -Verteiler, längere Haltbarkeit der Komponenten449) und ausgeglicheneren Komfort450) . Die besseren Komponenten dürfen somit durchaus auch höhere investive Kosten benötigen.
Es ergibt sich dadurch eine erweiterte Nachfrage nach verbesserten Produkten, d.h. solchen Produkten, bei denen durch besseres Know-How je Produktionseinheit ein höherer Mehrwert erzeugt wird. Das ist die klassische Definition von Fortschritt uns Mehrwertschöpfung! Die beschriebenen Methoden und Systeme verlagern dabei Ausgaben von der konsumtiven (Öl, Gas, Brennholz) auf die investive Seite (Dämmstoff, Lüftungskanal, PV-Anlage). Verbrauch an endlichen natürlichen Ressourcen wird durch Verbesserung der Produkte, also Know-how und Fertigungstechnik, ersetzt.
Entscheidend dabei ist letztlich, welche Gesamtkosten bei den Lösungsalternativen entstehen: Die effizienter Energienutzung erweist sich dabei regelmäßig als die im Lebenszyklus auch ökonomisch günstigere Variante. Diese löst dennoch auch weiterhin wirtschaftliche Aktivität aus451) - nur, dass diese Aktivität im Vergleich zu den Alternativen sehr stark verringerte negative Umweltauswirkungen haben, im Beispielfall der Zellulose-Dämmung sogar positive Umweltauswirkungen ermöglicht452) .
Passivhaustagung in Innsbruck: 5. und 6. April 2024
Paul Ormond, M.S. vom Department of Energy Resources (DOER) des Commonwealth of Massachusetts (Bundesstaat der USA) stellt eine vorbildliche Regelung für Energiestandards bei Gebäuden vor. Er erklärt, wie sich das historisch entwickelt hat und wie erst spät wirklich erkannt wurde, warum gute Wärmedämmung, Luftdichtheit, bessere Fenster und die Reduktion der Wärmebrücken so wichtig sind. Aus seinem Beitrag wurde unmittelbar erkennbar: Es kommt vor allem darauf an, die besseren Lösungen zu erlauben und zu empfehlen - sie als Entscheidungsalternative zuzulassen453) .
Die zentrale Aussage von Bürgermeister Georg Willi aus Innsbruck: „Die Stadt Innsbruck baut seit Jahren generell im Passivhaus Standard. Das gilt auch für den stadteigenen Bauträger, die IIG (Innsbrucker Immobilien Gesellschaft) macht das z.B. auch im sozialen Wohnbau.“
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Österreichische Bundesregierung): „Wir haben eine Kommunikationsaufgabe: Wir bauen in Österreich das Passivhaus kostenneutral.“ Sie weiß natürlich auch, dass es regelrechte Kampagnen gibt, die bewusst Stimmung machen gegen den Klimaschutz. Trotzdem ist es in Österreich gelungen, ein Förderpaket einzuführen, durch den der EnerPHit-Standard ökonomisch für jeden Hausbesitzer attraktiv wird. „Die Wohnbauförderung geht noch viel zu oft in den Neubau. Sie muss noch in viel größerem Umfang für die Sanierung genutzt werden.“ Sie spricht es auch aus: „Gas ist nicht die Lösung. Eine klimafreundliche Lösung ist immer die beste Wahl und wir unterstützen das mit unseren Förderungen.“ Auch zur Energieeffizienz sind die Aussagen klar: „Die beste Energie ist die, die wir nicht brauchen“ - daher die Empfehlung für den KlimaAktiv-Standard454) .
Auf der abschließenden Plenarveranstaltung haben Jürgen Schnieders, Jan Steiger und Jessica Grove-Smith entscheidende Erkenntisse aus dieser Tagung zusammengetragen und einige Schlussfolgerungen gezogen:
- Auch im vergangenen Jahr sind zahlreiche neue Bauprojekte mit nachhaltiger Energieeffizienz umgesetzt worden von denen eine Auswahl auf der Tagung vorgestellt wurde.
- Dabei nimmt die Breite der Anwendung weiter zu: Sehr unterschiedliche Bauaufgaben wurden realisiert - und das auch in ganz unterschiedlichen Bauweisen und in verschiedenen Klimazonen. Hier liegt eine der Stärken des Ansatzes: Bessere Energieeffizienz funktioniert überall, ist an jedem Ort der Welt praktikabel und in der Regel heute die auch ökonomisch attraktivste Alternative.
- Für immer mehr Projekte liegen Messergebnisse des tatsächlichen Energieverbrauchs und Nutzungserfahrungen vor. Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich: Passivhaus und EnerPHit halten, was die Standards versprechen. Das ist insofern beeindruckend, als die Verbrauchswerte bei diesen Standards in aller Regel um rund 75% unter denen der üblichen Neubau- oder Sanierungsstandards liegen. Damit tragen die Projekte sehr stark zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei.
- Für einige Projekte gibt es inzwischen sogar Langzeiterfahrungen, die zeigen, dass die Komfortwerte über Jahrzehnte aufrecht erhalten werden und die Energieverbrauchswerte in der Tendenz sogar eher noch ein wenig weiter zurückgehen.
- Bei neuen Komponenten für den Bau von Passivhäusern und die Sanierung zu EnerPHit gibt es eine weiter rasch zunehmende Auswahl. In allen heute üblichen Bauweisen gibt es zertifizierte Bausysteme, die eine Planung im Passivhausstandard ermöglichen. Einige Neuentwicklungen wurden von beteiligten Partnern vorgestellt - die so auch einen Einblick in die Arbeitsweise der Berater für Passivhaus-geeignete Komponenten gegeben haben455) .
- Die Arbeitskreise 58 und 60 zum kostengünstigen Passivhaus haben einige systematische Erkenntnisse über die CO2-Emissionen in den Vorketten, die bei verschiedenen Heiztechnologien zu erwartenden Emissionen, die typischen Nutzungsdauern von Komponenten und den Einfluss von Weiter- und Wiederverwendung von Materialien erbracht. Klares Ergebnis ist, das nach wie vor die durch den Betrieb der Gebäude verursachten Emissionen bei weitem dominant sind. Es kommt daher vor allem darauf an, energieeffizient zu bauen - und das ist heute mit nahezu jeder Bauweise möglich.
- Ganz entscheidend ist aber die Erkenntnis, dass die über die nächsten Jahrzehnte ausschlaggebenden Emissionen beim Betrieb der Gebäude im Gebäudebestand entstehen. Die dort zur Zeit üblichen jährlichen Bedarfswerte machen weltweit ein Drittel des Endenergiebedarfs aus. Diese Verbrauchswerte lassen sich durch die EnerPHit-Methodik um rund 75% senken - und dann künftig leicht mit einer nachhaltigen weitgehend CO2-freien Wärmeversorgung decken.
- Beim Bestand der Gebäude sind zwei Grundprinzipien zielführend: (1) Das Kopplungsprinzip: Jedes Bauteil, das erneuert oder bearbeitet wird, dabei auch gleich energetisch auf eine zukunftsfähige Qualität verbessern. (2) „Wenn schon, denn schon“ - wenn ich irgendeine relevante Komponente anfasse, dann sollte ich die von Anfang an auf einen wirklich guten energetischen Standard bringen: Denn, die Kosten es gleich richtig zu machen, sind viel geringer als die, wenn ich ein Bauteil ein zweites mal bearbeiten muss.
Lösungen! (19.04.2024)
Eine Meldung meiner Universität hat mich nachdenken lassen: Klimaschutz-Engagement an Universitäten. Dieser Beitrag vermittelt vor allem konstruktive und positive Botschaften:
- Dass ein Engagement für den Klimaschutz möglich ist - und dass er greifbare Früchte trägt.
- Dass Universitäten in der Lage sind, dazu in hohem Ausmaß beizutragen.
- Dass das sogar geeignet ist, in als festgefahren geltenden Bereichen der Politik konstruktive Bewegung auszulösen.
- Dass es nicht nur beim Reden (und Schreiben) bleibt, sondern das Veränderungen in der Realität umgesetzt werden können, welche die Klimagas-Emissionen signifikant schon heute reduzieren und in einem überschaubaren Zeitraum diese auf nahe Null bringen können.
Im Bereich der Energieeffizienz in der Alltagswelt, insbesondere beim energieeffizienten Bauen, sind solche Erfolge unmittelbar wirksam, sie sind messbar und von den Menschen auf vielen Wegen wahrnehmbar:
- Die Universität Innsbruck hatte sich z.B. bei der ohnehin notwendigen Sanierung des Fakultätsgebäudes der technischen Wissenschaften sorgfältig mit dem Umbauprozess befasst.
- Es wurden bei allen Details auf den Erkenntnissen der Bauingenieure aufbauende Verbesserungen in der Ausführung entworfen, z.B. Dreischeiben-Verglasung in den neuen Fenstern statt der sonst üblichen nur 2 Scheiben456) .
- Bei der Fassade sind die Effekte mit noch weniger Aufwand noch höher: Die Vorhangpaneele waren von den Architekten ohnehin geplant - deren Montage wärmebrückenfrei zu machen erfordert wenig mehr als ein wenig Nachdenken und ein paar Wärmestromberechnungen457) ; mit niedrigeren Wärmebrückeneffekten lohnt es sich dann auch, statt der meist üblichen 12 cm Dämmung gleich 20 cm einzusetzen458) Gegenüber dem Altbauzustand beträgt der Verbesserungsfaktor hier mehr als 5.
- Die ohnehin erforderliche Entlüftung der Kernbereiche des Gebäudes wurde durch gezielte Zufuhr der zugehörigen Frischluft nicht in die Gänge, sondern in die Büroräume zu einer balancierten Be- und Entlüftung des gesamten Bauwerks erweitert459) - die zugehörigen hocheffizienten Rotationswärmetauscher auf dem Dach wurden um die Feuchterückgewinnung ergänzt. Das führt nicht nur zu einer bedeutende Energieeinsparung, sondern auch zu komfortablere Innenluftqualitäten im Winter.
Es wird unterschätzt, wieviel diese460) Verbesserungen für den praktischen Betrieb bringen: Der Energiebedarf für die Heizung in diesem Fakultätsgebäude wurde durch die Summe aller solcher 'kleinen' Verbesserungen von „vorher“ 149 kWh/(m²a) auf „nachher“ unter 17 kWh/(m²a) verringert; das ist ein Reduktionsfaktor von rund 9. Mit einem derart vernachlässigbar geringen Verbrauch sind auch die dadurch verursachten Klimagas-Emissionen im gleichen ausmaß verringert. Besser noch, jetzt kann zukünftig z.B. allein die regional verfügbare Menge an biogenem Methan ausreichen, diesen Bedarf netto-emissionsfrei zu liefern; das würde dann sogar für alle Gebäude in Innsbruck reichen, wenn dies dem Vorbild der Fakultät folgen. Selbstverständlich ist bei den nun nur noch geringen Vorlauftemperaturen auch eine Beheizung mit Wärmepumpen leicht möglich. Das Biogas würde dann für andere Anwendungen, die nicht so leicht elektrifizierbar sind, zur Verfügung stehen.
Die Bedeutung solcher richtungsweisenden Beispiele wird ebenfalls oft unterschätzt: Die über 450 Teilnehmer der Tagung auf dem Campus aus aller Welt nehmen diese Erfahrungen in ihre Heimat mit - viele Kollegen anderer Universitäten haben das seit der Fertigstellung des Umbaus 2015 bereits mehrfach getan. Es entstanden so mehrere Projekte rund um die Welt, die ähnliche Verbesserungen mit ähnlichen Ergebnissen auslösten. Über einige dieser neuen Projekte wurde auf der 27. Internationalen Passivhaustagung in Innsbruck berichtet461) .
Weitere herausragende Beispiele wurden durch die Initiative der Universität in Innsbruck realisiert: So das Projekt Sinfonia, das umfassende Stadtquartier-Modernisierungen umsetzen ließ. Viele der dabei sanierten Gebäude in der Stadt konnten bei Exkursionen auf der Tagung besichtigt werden - Messergebnisse, z.B. auch aus Sanierungen innerhalb von Sinfonia im benachbarten Bozen wurden in einem Vortrag auf der Tagung dokumentiert.
Wenn wir konstruktiv an der Umsetzung des Klimaschutzes arbeiten, so wie es die beispielhaft vorgestellten Projekte demonstrieren, dann lassen sich die Maßnahmen im Zuge der ohnehin erforderlichen Erneuerungszyklen nahezu überall umsetzen. Die Klimagas-Emissionen werden so Schritt für Schritt auf ein vernachlässigbar kleines Ausmaß reduziert - der dann ebenfalls nur noch geringe Energieverbrauch kann dann leicht über lokale erneuerbare Quellen gedeckt werden.
Dieser Umsetzungsprozess führt noch nicht einmal zu einem besonders hohen zusätzlichen Aufwand - denn Fassaden werden ohnehin gestrichen und Fenster müssen irgendwann ausgewechselt werden. Die verbesserten Komponenten sind weder bedeutend aufwendiger in der Installation noch besonders viel teurer: Nachdenken über die angemessen Qualität müssen die Beteiligten allerdings schon und ein paar sogfältig überlegte Planungsschritte mehr sind dazu erforderlich: Sonst entgehen den Eigentümer diese einmaligen Chancen und ein unbefriedigender Zustand wir abermals über Jahrzehnte fixiert. Die meisten Universitäten verfügen über das Know-how, bei dieser Transformation unterstützend mit zu wirken. Sie können dies sogar in ihre Lehrveranstaltungen integrieren.
Mit der Umsetzung und Kommunikation solcher konstruktiver Lösungen ist dem Klimaschutz weit besser gedient als mit dem Hinweis auf Weltuntergangs-Szenarien. Wenn die Menschen wissen, das es Lösungen gibt und dass sie selbst konstruktiv zu diesen Lösungen beitragen können - dann kommen wir einer Gesamtlösung der vor uns liegenden Aufgaben wirklich näher.
Wenn die Passivhaustagung in Innsbruck etwas bewiesen hat, dann ist es das.
Verblüffend: Oft führt das Verständnis ganz einfacher Grundlagen bereits zu wichtigen Ergebnissen (28.04.2024)
Das habe ich gerade eben bei der Pflege unserer Grundlagenkurse gemerkt.
Hier ein Beispiel: Wie nachhaltige Energieversorgung (durch Erneuerbare) von effizienter Energieanwendung profitiert, das ist sofort einsichtig, wenn wir die elementaren Grundlagen zum Thema „Wärmespeicherung“ wirklich verstehen. Viele 'hoffen' auf die 'Erfindung' irgendwelcher „Super-Speicher-Materialien“ und hoffen das durch noch nicht untersuchte hochkomplexe, schwere Moleküle umsetzen zu können. Was davon wirklich zu erwarten ist, wird sofort klar, wenn die molekulare Grundlage der Wärmespeicherprozesse verstanden wird: Das ideale Wärmespeichermaterial für 90% aller Anwendungen ist längst gefunden. Es ist ... Wasser.
Etwas weiter unten im gleichen Text gibt es noch ein weiteres Praxisbeispiel: Die Wärmespeicherung in einer Betondecke. Ist die hilfreich? Aber sicher! Sie erlaubt es, Temperaturen im Tag/Nacht-Gang besser auszugleichen. Das hilft z.B. in unseren Breiten bei der Einsparung von Kühlenergie462) . Für die Heizung ist der Einfluss aber nur sehr gering - und umso bedeutsamer, je besser das Gebäude ansonsten gegen Wärmeverluste geschützt ist. Auch das ergibt sich zwanglos aus ganz elementaren Grundlagen.
Und noch ein Beispiel: Der Wärmeverlust eines Gebäudes steigt naturgemäß an, wenn die Außenoberfläche des Objektes größer wird; auch dann, wenn dabei die Nutzfläche gar nicht ansteigt. Eindeutige Folgen: Durch eine Zerklüftung der Hülle wird der Bau teurer (mehr Oberfläche); die Heizkosten werden ebenfalls höher und oft die Nutzfläche auch noch kleiner. Beschwert sich da jemand über Kostensteigerungen beim Wohnen? Vieles davon ist offensichtlich geplant und gewollt - nicht, dass das 'verboten' ist oder verboten werden sollte. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Schauen wir genauer hin, dann stellt sich nämlich heraus, dass es vor allem solche Ursachen sind, welche für die oft beklagten Kostensteigerungen sorgen. Weil wir das aber nicht gern zugeben wollen, suchen viele nach anderen 'Gründen'; manche behaupten sogar, solche gefunden zu haben: den verbesserten Wärmeschutz zum Beispiel. Tatsächlich kostet gerade der nicht wirklich viel mehr, Dämmstoffe sind nämlich billig - und er spart Betriebskosten ein, und das in bedeutendem Umfang. Wie das wirklich kostengünstig geht, findet sich z.B. in den Beiträgen zu Protokollband 55: kostengünstiger sozialer Wohnungsbau.
Übersicht April 2024: Trotz Kälteeinbruch kein Heizbedarf (Eintrag vom 2. Mai)
Ab dem 15. April waren die Temperaturen im Außenbereich auf Tagesmittelwerte unter 7,5 °C gesunken - das liegt 'eigentlich' deutlich unter der Heizgrenztemperatur auch bei unserem Passivhaus - trotzdem gab es keine Notwendigkeit, tatsächlich wieder mit heizen zu beginnen: Denn, die Gebäudespeichermasse hatte zuvor schon Kerntemperaturen über 23°C erreicht. Da es zugleich leider auch wenig solare Einstrahlung im betreffenden Zeitraum gab, sanken die Temperaturen im Haus allerdings schon ab, und zwar auf eine Kernmitteltemperatur von nur noch 21,1 °C am 27. April. Die zur Temperaturabnahme gehörende Wärme aus dem massiven Kern des Gebäudes hat die kurze Kälteperiode nahtlos überbrückt - und seit dem 28. April ist es in Darmstadt auch wieder sonniger und wärmer geworden.
Die niedrigste Raumtemperatur, die am frühen Morgen des 26. April im Erdgeschoss erreicht wurde, lag bei 20,0°C.
Solche Kaltlufteinbrüche im späten April oder selbst noch im Mai sind in Mitteleuropa typische Wetterlagen. In den konventionell gebauten Gebäuden muss dann in aller Regel noch einmal geheizt werden. Das konnte für die beiden Wochen 14.-21. April und 21.-28. April tatsächlich an den Daten zum Erdgasverbrauch in Deutschland verfolgt werden: In der 2. Aprilwoche war diese Leistung für Erdgas zu Raumheizzwecken schon einmal auf durchschnittlich 13,5 GW zurückgegangen, am dann aber wieder auf das rund Vierfache, 45 und 52 GW jeweils, anzusteigen.
Übrigens: auch diese späte Leistungsspitze beim Heizwärmebedarf fiel vom 22. bis zum 26. April mit einer Flaute zusammen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie der Bedarf an kostspieligem Backup und teurer Jahreszeiten-überbrückender Energiespeicherung durch verbesserte Effizienz klein gehalten werden kann463) . Im April wird es künftig in der Regel nicht problematisch sein, die PV-Stromerzeugung so auszubauen, dass diese dann mit dem 'normalen'464) zeitlichen Gang des Strombedarfs zusammen mit auf Tagesspeicherung ausgelegten Batteriespeichern zurecht kommen kann. Wenn allerdings weitere 35 GW an Wärmepumpenstrom dazu kommen, würde auch in dieser Periode jahreszeitlich gespeicherte Energie angezapft werden müssen. Wie die Auswirkung einer konsequent ausgeweiteten Wärmepumpen-Umrüstung der überwiegenden Zahl aller Raumheizungen auf den Leistungsbedarf im Stromnetz aussehen würde, haben wir eingehend unter dieser Analyse untersucht.
Ende der aktuellen letzten Eintragung
==== Hintergründe ====
Leser dieses Blogs werden sich vielleicht fragen: „Wer oder was steckt da eigentlich dahinter?“
Dahinter steckt zunächst eine Person und deren persönliche Erfahrung. Wer sich für Details zur Person interessiert, dazu werde ich in Zukunft irgendwann mehr aufschreiben; das hat aber aus meiner Sicht keinen Vorrang465) .
Die Passipedia, innerhalb der dieser Blog erscheint, wird vom Passivhaus Institut (PHI) unterhalten. Das PHI wurde 1997 vom Autor gegründet; es hat inzwischen um 50 fest angestellte Mitarbeiter und ist jetzt eine GmbH, deren Gesellschafter Mitarbeiter des Institutes sind466) . Zwei Punkte vorab: 1) Es gibt keine offenen oder verdeckten institutionellen Anteilseigner oder Geldgeber, die GmbH ist im vollständigen Besitz der Gesellschafter. 2) Es war immer Ziel des PHI, keine einseitigen Abhängigkeiten von Auftraggebern oder Fördermittelgebern entstehen zu lassen. So kann das Institut einen der explizit formulierten Ethik und der Wissenschaft verpflichteten Kurs sicherstellen467) .
=== Der niedergelegten Ethik und der Wissenschaft verpflichtet ===
Das sind die entscheidenden Elemente für unsere Arbeit, auf diese gehe ich im Folgenden etwas genauer ein:
- Wir maßen uns nicht an, innovative ethische Konzepte aufzustellen, denn „Ethik“ ist nicht unser zentrales Arbeitsgebiet. An dieser Stelle müssen wir uns Ansätzen anschließen, die bereits bestehen und dokumentiert sind. Das ist z.B. die von den Vereinten Nationen angenommene „Deklaration der Menschenrechte“ sowie das völkerrechtlich bindende https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Statut_des_Internationalen_Strafgerichtshofs. Sofern nicht im Widerspruch dazu, gibt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland darüber hinaus eine gute Richtlinie. Die Regeln können in die Bereiche „Verletzungsverbot“ und „Hilfsgebot“ eingeordnet werden. Letzteres ist, insbesondere oft in Ländern mit hohem materiellen Wohlstand, oft wenig betont - hier liegt aber in Verbindung mit dem Wissenschaftlichkeits-Prinzip ein zentraler Ansatz für die Arbeit unseres Institutes.
- Wissenschaftlichkeits-Prinzip: Die methodischen Grundlagen der Naturwissenschaft wurden über die Jahrhunderte immer klarer herausgearbeitet; Karl Poppers „Logik der Forschung“ stellt hier immer noch eine gute Grundlage dar. Wir erklären uns an diese Grundlagen gebunden. Die philosophischen Fragen, wie 'objektiv' Wissenschaft letztendlich sein kann 468) und ob wir Menschen überhaupt die Fähigkeit besitzen, solche Erkenntnisse objektiv zu gewinnen, werden an nochmals anderen Stellen diskutiert. Im Kontext unserer Arbeit spielen diese erkenntnistheoretischen Grundsatzfragen allerdings nur ein geringe Rolle; im Grund nur die, dass uns immer klar sein muss, dass sich der Stand der Erkenntnis auch ändern könnte469) .
- Die Aufgabenfelder des PHI ergeben sich klar aus dem Namen. Das wird aber meist etwas zu verengt gesehen: Als wir vor rund 50 Jahren mit den Arbeiten in diesem Umfeld begonnen haben, haben wir ganz allgemein die Frage gestellt: „Wieso eigentlich verbraucht unsere Zivilisation so viele Ressourcen und wandelt diese letztendlich in verschiedenste Formen von Müll um470) ? Damals taten wir das in einem akademischen Umfeld - und gingen die Fragen sehr grundsätzlich an. Wie Kollegen in Dänemark, Kanada und den USA war die Erkenntnis ziemlich ernüchternd: Genau genommen bedarf es all dieser Verwandlung von „Rohstoffen“ über Waren zu letztlich „Müll“ überhaupt nicht - die Bedürfnisse, ja auch der Bedarf, der durch gedeckt wird, lässt sich meist auch anders befriedigen. Heute ist das im wissenschaftlichen Bereich interessanterweise weitgehend akzeptiert471) .
- Dass gerade der Wirtschaftssektor „Energie“ sich als so entscheidend wichtig herausstellte, hat viele verwundert; uns seit ca. 1978 nicht mehr, weil wir durch intensive Analyse der Abhängigkeiten dazu erkannt hatten, dass vom Energieverbrauch der industriellen Zivilisation die größten vom Menschen verursachten artifiziellen Stoffströme ausgehen: Kohle, Öl und Gas werden im Bereich mehrerer Tonnen pro Kopf und Jahr 'gefördert'472) und zum Zwecke der Energiegewinnung in überwiegend gasförmigen 'Müll', eben CO2 und H2 O, verwandelt. Diese Verbrennungsgase geben wir im Umfang von einigen Tonnen pro Erdenbewohner einfach in die Atmosphäre ab. Das ist ein hochgradig irreversibler Prozess, er hat eine große Vielzahl direkter und indirekter Konsequenzen. Der bedrohlichste davon ist gegenwärtig die Veränderung des Erdklimas. Das war in der Wissenschaft schon 1980 unbestritten. Eine Zusammenfassung dazu, warum diese Tatsache sich seither trotzdem über 40 Jahre lang nicht ausreichend in politisches oder gar praktisches Handeln umsetzen ließ, dazu haben andere Autoren an anderer Stelle bereits eine Menge ausgesagt, das ich hier nicht wiederholen muss [Mann 2021][Kemfert 2023].
- Eine Seite dieser Angelegenheit ist es, die Probleme und ihre Ursachen zu verstehen. Eine andere Seite besteht daran, Lösungen für die Probleme zu suchen oder zu entwickeln: Genau das Letztere haben wir von Anfang an verfolgt; dabei haben wir erkannt, dass solche Lösungen oft sehr viel einfacher sind, als es ein Großteil der derzeitigen Diskussionen erscheinen lässt. Sie sind dann einfach, wenn die jeweiligen Aufgaben von ihrer Bestimmung her angegangen werden und auch systematisch andere Lösungen mit betrachtet werden. Viele überrascht es, welche Arten von Lösungen sich so ergeben und wie viele Vorteile diese dann haben - oft eben nicht nur bzgl. des reduzierten Energieverlustes, sondern auch wegen besserer und längerer Haltbarkeit, besserem Komfort und weniger Lärm. Unsere Beschreibungen für die Lösungen beim Ansatz Energieeffizienz JETZT illustrieren das beispielhaft konkret.
- Unser Ansatz ist somit: Genaue Analyse der Aufgabe (der „Dienstleistung“) die durch den Energieeinsatz erbracht werden soll. Das allein zeigt oft schon die entscheidenden Pfade für eine nachhaltigere Lösung: Wir kommen hier eben gerade nicht von der Versorgungsseite her, sondern von den zu deckenden Bedürfnissen. Sehr oft lassen sich diese mit Lösungen erbringen, die gar keine oder zumindest sehr viel weniger Energie benötigen, als die heute in der Breite eingeführten. Gerade das Heizen von Gebäuden ist hier ein geeignetes Beispiel: Dort lassen sich zunächst die Wärmeverluste gegenüber den üblichen Werten (um 150 kWh/m²a) durch besseren Wärmeschutz um gut einen Faktor 5 senken - auch in den meisten Altbauten. Diesen, schon viel geringeren Bedarf, können wir dann leicht mit Hilfe kleiner und daher kostengünstiger Wärmepumpen473) decken - durch deren erheblich höhere Effizienz ist der erforderliche Stromeinsatz dann nochmals um einen Faktor 3 niedriger als der Wärmebedarf. Schließlich kann der so nicht besonders stark ansteigende Strombedarf künftig überwiegend aus erneuerbarer Energie gedeckt werden - und das bewirkt einen weiteren etwa Faktor 2 bzgl. der Klimagasemissionen. Der Anwendungsbereich Gebäudeheizung ist übrigens nicht so unbedeutend, wie das oft fälschlich dargestellt wird: In Deutschland sind das rund 29% des Energiebedarfs, nur noch übertroffen vom Spritverbrauch im Verkehr (rund 30%). In den anderen Anwendungs-Sektoren gibt es jeweils andere aber ebenfalls vergleichbare hochwirksame Ansätze zur Verbesserung der Effizienz474) .
Warum die wissenschaftliche Erkenntnis in diesem Gebiet gut gesichert ist
Seriöse Naturwissenschaft beruht gerade darauf, dass den Dingen auf den Grund gegangen wird: Dazu gehört eine ständige kritische Analyse des Erkenntnisstandes: Nur die Aussagen, die diesem Prozess standhalten, bleiben in der Kategorie des gesicherten Wissens. An den Grenzen der Forschung (heute z.B. bei den Fragen von dunkler Materie) sind Aussagen auch in der Wissenschaft oft noch deutlich weniger gesichert - einen bedeutenden Einfluss auf das für uns hier relevante gesicherte Wissen (z.B. über 'die Bewegung von heute gebauten Raumschiffen im Schwerefeld von Erde, Mond und Sonne' oder den Wärmeabfluss aus einem Behälter) wird das aber auch künftig nur sehr wenig ändern. In dem hier behandelten Bereich der Wärmeleitung sind diese Erkenntnisse seit Jahrhunderten bei jeder Anwendung, auch gerade bei allen kritischen Prüfungen, immer nur bestätigt worden. Das Passivhaus Institut hat selbst zahlreiche gut dokumentierte und publizierte Tests der Grundgleichungen zum Wärmetransport in Bauteilen durchgeführt: Auch in diesem Anwendungsfeld stimmt die Physik. Das ist in diesem Fall sogar für alle, auch Nicht-Wissenschaftler, leicht überprüfbar: Durchschnittliche bestehende Gebäude in Deutschland brauchen auch heute noch (um 2021) über 125 kWh/(m²a) allein für die Heizung. Inzwischen in hoher Anzahl realisierte und genutzte Gebäude in Passivhausqualität dagegen nur um 15 kWh/(m²a) [Johnston 2020]. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien besteht eben gerade in der konsequenten Verwendung der gesicherten Erkenntnisse der Bauphysik bei den Gebäudehüllen.
Literatur
[AKkP 55] Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser: Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient (k)ein Widerspruch? Protokollband Nr. 55, Darmstadt 2021 (kostenloser download ist verlinkt); vergleiche dazu auch folgenden Passipedia-Eintrag: Passivhäuser im sozialen Wohnungsbau
[AKkP 58] Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser: Protokollband Nr. 58, Darmstadt 2024; Lebenszyklusbilanzen, Passivhaus Institut, Darmstadt, tbp 2024
[Bastian 2022] Zeno Bastian, Jürgen Schnieders, William Conner, Berthold Kaufmann, Laszlo Lepp, Zack Norwood, Andrew Simmonds, Ingo Theoboldt: Retrofit with Passive House components; Energy Efficiency 1/2022 (online: Experience Retrofit)
[Fanger 1970] Fanger, P Ole. Thermal Comfort: Analysis and applications in environmental engineering. McGraw-Hill. Syracuse University 1970
[Feist 2022] Feist, W.: Heizen mit dem Klima-Splitgerät? Passivhaus Darmstadt Kranichstein – Experiment zum Heizen und Kühlen aus einer räumlich konzentrierten Quelle, innsbruck university press, 2022, ISBN 978-3-99106-078-9, Internet-Aufruf: Heizen mit dem Klima-Splitgerät
[Feist, Pfluger 2016] Feist,W.*; Pfluger, R.*; Peper, S.; Hasper, W.; Ebel, W.; Schulz, T., Saxer, A.*: Studie zur Dauerhaftigkeit von Energieeffizienzmaßnahmen - Erfahrungen nach 25 Jahren Passivhaus Darmstadt-Kranichstein; Passivhaus Institut, 2016 (*Universität Innsbruck, Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften)
[Feist 2020] Wolfgang Feist; Rainer Pfluger; Wolfgang Hasper: „Durability of building fabric components and ventilation systems in passive houses“ Energy Efficiency 13(3) Dec. 2020 DOI: 10.1007/s12053-019-09781-3; (direct link to full-text-publication: Durability Passive House)
[Feist 2023] Feist, W., Schnieders, J., Hasper, W, und Huneke, S.: Validierung der Algorithmen für die thermische Gebäudesimulation an Hand von Feld-Messergebnissen, PHI DA, 2023; siehe auch Das Passivhaus Kranichstein im Winter 2022/23 besonders sparsam heizen in diesem Blog.
[Global 2000] The global 2000 [two thousand] report to the President of the U.S. – Entering the 21st century. A report. Prepared by the Council on Environmental Quality and the Department of State. Gerald O. Barney. Pergamon Press, New York (3 Bde., 1980–1981), DNB 550695664
[Gore 2006] „An Inconvenient Truth (U)“. British Board of Film Classification. May 18, 2006
[Johnston 2020] David Johnston, Mark Siddall, Oliver Ottinger, Soeren Peper und Wolfgang Feist: Are the energy savings of the passive house standard reliable? A review of the as-built thermal and space heating performance of passive house dwellings from 1990 to 2018; Energy Efficiency (2020) 13:1605–1631; https://doi.org/10.1007/s12053-020-09855-7
[Kemfert 2023] Claudia Kemfert: Schockwellen: letzte Chance für sichere Energien und Frieden, 2023
[Mann 2021] Michaal Mann: The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet. PublicAffairs. ISBN 978-1-541-75822-3
[Meadows 1972] Meadows, Donella H; Meadows, Dennis L; Randers, Jørgen; Behrens III, William W (1972). The Limits to Growth; A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books. ISBN 0876631650.
[Weinersmith 2023] Kelly and Zach Weinersmith 2023: A city on Mars. New York, 2023, Penguin Press. ISBN 9781984881724. LCCN 2022951665