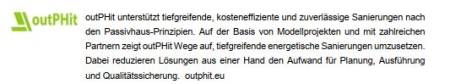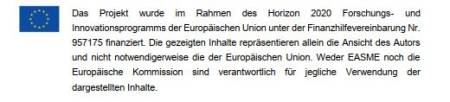Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
EU-Taxonomie Verordnung – Ziele, Pflichten, Funktionsweise und Einordnung von Passivhaus/EnerPHit
Grundsätzlich: Was ist die EU-Taxonomie?
Die EU-Taxonomie ist ein Eckpfeiler des EU-Rahmens für nachhaltige Finanzen und ein Instrument der Markttransparenz. Sie trägt dazu bei, Investitionen in die Wirtschaftszweige zu lenken, die - aus Sicht der EU - für den Übergang am dringendsten benötigt werden, im Einklang mit den Zielen des Europäischen Grünen Deals. Bei der Taxonomie handelt es sich um ein Klassifizierungssystem, das Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten festlegt, die mit einem Netto-Null-Profil bis 2050 und den umfassenderen Umweltzielen zusätzlich zum Klimaschutz in Einklang stehen.
Dazu gibt das BMUV EU-Taxonomie und die rechtliche Grundlage folgendes an: Die Taxonomie ist ein EU-weit gültiges System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Sie soll Anlegerinnen und Anlegern Orientierung geben und Kapital für den grünen Umbau von Energieproduktion und Wirtschaft anreizen. Das Finanzsystem spielt eine Schlüsselrolle im Übergang zu einer emissionsarmen, ressourcenschonenden Wirtschaft. Die Europäische Kommission hat daher bereits im Juni 2021 erste Kriterien vorgelegt, die dazu beitragen sollen, in der Europäischen Union mehr Geld in nachhaltige, klimaschonende Tätigkeiten zu lenken und die Umweltbilanz in Unternehmensberichten sichtbarer zu machen. Die Europäische Union selbst, gibt eine Art Checkliste aus, in der erklärt wird was die Taxonomie ist und was sie eben nicht ist. Ein Versuch also, von Anfang an mit Vorurteilen zu dem Thema aufzuräumen:

Die Taxonomie bildet zusammen mit der Offenlegungsverordnung (SFRD) und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eine der drei Säulen der sog. „Sustainable Finance Strategy“ und ihr Ziel besteht darin, die Anleger anhand gemeinsamer EU-weiter Kriterien zu informieren, ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch nachhaltig ist. Die bereits erwähnten Umweltziele beziehen sich auf verschiedene ökologische Aspekte, die in sechs Zielen zusammengefasst werden:
- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser und Meeresressourcen;
- der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- der Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.
Die Verordnung legt die folgenden Kriterien fest, nach denen die EU und ihre Mitgliedstaaten entscheiden müssen, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit ökologisch nachhaltig ist. Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn
- Sie wesentlich zu einem oder mehreren der oben genannten Umweltziele beiträgt.
- Durch die Verordnung keines dieser sechs Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird. (auch bezeichnet als „Do No Significant Harm„ (DNSH))
- Sie unter Einhaltung von festgelegten Mindestschutzmaßnahmen durchgeführt wird.
- Sie die gemäß der Taxonomie Verordnung festgelegten technischen Bewertungskriterien für die konkrete Tätigkeit erfüllt.
Eine gute Hilfestellung zum besseren Verständnis der Anforderungen bietet der online Taxonomie Navigator. Im online verfügbaren Taxonomie Kompass werden die Kriterien sortiert nach Sektor und Aktivität aufgeführt. Er ermöglicht es den Nutzern und Nutzerinnen zu überprüfen, welche Aktivitäten in der EU-Taxonomie enthalten sind (sog. taxonomiefähige Aktivitäten), zu welchen Zielen sie wesentlich beitragen und welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Aktivitäten als taxonomiekonform gelten.
Wer ist berichtspflichtig?
Ab dem Inkrafttreten der Taxonomie Verordnung gilt diese für verschiedene Akteure, hauptsächlich im Bereich der kapitalmarktorientierten Unternehmen. Dafür wird in drei Gruppen eingeteilt.
- Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, welche unter die nicht-finanzielle Berichterstattung fallen.
- Finanzinstitute inklusive Anbieter von Berufsrenten die Finanzprodukte in der EU anbieten und vertreiben (auch mit Sitz außerhalb der EU)
- EU und deren Mitgliedsstaaten beim Festlegen von öffentlichen Maßnahmen, Standards oder Labels für grüne Finanzprodukte oder (Unternehmens-) Bond
Mit dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive 2023 wurde darüber hinaus der Anwendungsbereich auf weitere Unternehmen ausgeweitet, die zur Nachhaltigkeitsbereichterstattung verpflichtet sind. Diese sind
- alle großen Kapitalgesellschaften, unabhängig von einer Kapitalmarktorientierung und
- kapitalmarktorientierte KMU
Wie sind die ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten und Kennzahlen der Taxonomiekonformität zu ermitteln?
Die Kommission hat eine Liste ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten erstellt, in der sie für jedes der sechs Umweltziele technische Bewertungskriterien festlegt. Diese Kriterien werden durch delegierte Rechtsakte festgelegt. Weiterhin gelten auch delegierte Rechtsakte zu Offenlegungspflichten und zum Klimaschutz. Diese legen den Inhalt, die Methode und die Darstellung der Informationen fest, die von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen über den Anteil ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind.
Für die Berichterstattung müssen drei Kennziffern ermittelt werden, um die Tätigkeiten eines Unternehmens einzuordnen. Diese Kennzahlen sind Umsatzerlöse, Investitionsausgaben und der Betriebsaufwand.
Umsatzerlöse, sind hierbei Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten die nach den Merkmalen der Taxonomie als nachhaltig eingestuft werden können und somit Taxonomie konform sind. Für die Investitionsausgaben und den Betriebsaufwand, geben (insbesondere nicht-Finanzunternehmen) den Anteil im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen oder Prozessen an, die mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.
EU-Taxonomie für den Gebäudesektor
Die Anforderungen der EU-Taxonomie sind zunächst für Akteure auf dem Finanzmarkt von Bedeutung. Aber auch für andere Akteure und deren vielfältige Arbeit im Gebäudesektor ist die EU-Taxonomie von Relevanz, denn es ist davon auszugehen, dass die Taxonomiekonformität von Gebäuden zunehmen an Bedeutung gewinnen wird. Bauherren, darunter z.B. auch berichtspflichtige Unternehmen, lenken mit ihren Wünschen und Investitionsentscheidungen die erreichte Nachhaltigkeit ihrer Immobilien und können damit ihre eigene Taxonomiekonformität beeinflussen. Auch die Arbeit und von Planenden und Ausführenden ist von hoher Bedeutung, denn sowohl der Gebäudeentwurf, als die Dokumentation, Umsetzung und Inbetriebnahme sind entscheidend für die erreichte Nachhaltigkeit und Taxonomiekonformität.
Verschiedene Akteure innerhalb des Gebäudesektors nehmen verschiedenste Tätigkeiten war, die sich wiederum unterschiedlichen Sektoren und Tätigkeiten der EU-Taxonomie zuordnen lassen. Eine Checkliste für taxonomiefähige Aktivitäten im Gebäudesektor aufzustellen ist daher nicht trivial und braucht Anpassungen je nach individuellem Kontext. Die Hauptaktivitäten die hier von Relevanz sind, sind der Neubau, die Renovierung bestehender Gebäude, der Erwerb und das Eigentum von Immobilien, sowie verschiedene individuelle Maßnahmen und Dienstleistungen (insb. Installation, Wartung und Reparatur). Für die Betrachtung und Bewertung der jeweiligen Taxonomiekonformität sind von den sechs Umweltzielen hauptsächlich der „Klimaschutz“, die „Klimanpassung“ und die „Kreislaufwirtschaft“ von Relevanz.
Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Mindestanforderungen an Gebäude gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (Delegierte Verordnung (EU) 2021/2800).
Diese Anforderungen basieren auf den technischen Bewertungskriterien zur Erreichung der Klimaziele der EU und zur Vermeidung erheblicher Schäden an anderen Umweltzielen, die in der Verordnung festgelegt sind. Alle technischen Kriterien sind direkt in den Anhängen der Verordnung detailliert beschrieben.
Zusätzlich zu diesen Mindestanforderungen in der Kategorie den „Klimaschutz“, müssen erhebliche Beeinträchtigungen bei den verbleibenden fünf Umweltzielen ausgeschlossen werden (DNSH Anforderungen). Insbesondere für Neubau und die Renovieren werden ergänzende Themen abgefragt wie z.B. Betrachtung des Gebäudes unter Klimaszenarien als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel, konkrete Anforderungen an Wasserspararmaturen, Anforderungen an Widerverwertung von auf der Baustelle anfallenden Materialien, Umweltanforderungen für verwendete Materialien, sowie Nachweispflichten in Bezug auf Biodiversität und Ökosysteme.
Die Berichtspflichten und -fristen für Unternehmen sind im Delegierten Rechtsakt der Taxonomieverordnung ebenfalls festgelegt und sehen wie folgt aus:
Passivhaus und die EU-Taxonomie
Der Passivhaus Standard ist zunächst definiert über einen sehr geringen Energiebedarf für Heizen oder Kühlen bei Neubauten (Passivhaus oder PHI Energiesparhaus) und einen etwas höheren aber immer noch sehr geringen Energiebedarf für Sanierungen (EnerPHit). Zudem bestehen entsprechend anspruchsvolle Anforderungen an die Gebäude-Luftdichtheit, den Komfort, und an den gesamten Primärenergiebedarf des Gebäudes, inklusive des Strombedarfs für Haushaltsgeräte. Hier geht es zu den Gebäudekriterien für den Passivhaus-, EnerPHit- und PHI-Energiesparhaus-Standard.
 Ein behagliches Innenklima ist mit sehr niedrigem Energieeinsatz erreichbar: Dazu darf der Jahresheizwärmebedarf nach Passivhaus Projektierungs-Paket (PHPP) max. 15 kWh/(m²a) sein. Die Behaglichkeitskriterien müssen in jedem Wohnraum im Winter wie im Sommer erfüllt sein. Daraus ergeben sich bestimmte Bauteilqualitäten. Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie (PER, nach Verfahren des PHI) für alle Haushaltsanwendungen (Heizung, Warmwasserbereitung und Haushaltsstrom) zusammen darf nicht höher sein als 60 kWh/(m²a). Die Berechnung erfolgt ebenfalls nach PHPP.
Ein behagliches Innenklima ist mit sehr niedrigem Energieeinsatz erreichbar: Dazu darf der Jahresheizwärmebedarf nach Passivhaus Projektierungs-Paket (PHPP) max. 15 kWh/(m²a) sein. Die Behaglichkeitskriterien müssen in jedem Wohnraum im Winter wie im Sommer erfüllt sein. Daraus ergeben sich bestimmte Bauteilqualitäten. Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie (PER, nach Verfahren des PHI) für alle Haushaltsanwendungen (Heizung, Warmwasserbereitung und Haushaltsstrom) zusammen darf nicht höher sein als 60 kWh/(m²a). Die Berechnung erfolgt ebenfalls nach PHPP.

 EnerPHit ist der etablierte Standard für die Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten. Trotz etwas höherem Energiebedarf bietet EnerPHit nahezu alle Vorteile des Passivhaus-Standards. Der EnerPHit-Standard kann durch die Einhaltung der Kriterien des Bauteilverfahrens oder alternativ durch Einhaltung der Kriterien des Energiebedarfsverfahrens erreicht werden. Je nach Nutzung erneuerbarer Energien werden die EnerPHit-Klassen Classic, Plus oder Premium erreicht.
EnerPHit ist der etablierte Standard für die Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten. Trotz etwas höherem Energiebedarf bietet EnerPHit nahezu alle Vorteile des Passivhaus-Standards. Der EnerPHit-Standard kann durch die Einhaltung der Kriterien des Bauteilverfahrens oder alternativ durch Einhaltung der Kriterien des Energiebedarfsverfahrens erreicht werden. Je nach Nutzung erneuerbarer Energien werden die EnerPHit-Klassen Classic, Plus oder Premium erreicht.


Der PHI-Energiesparhaus-Standard eignet sich für Gebäude, die aus verschiedenen Gründen die Kriterien für das Passivhaus Classic nicht erreichen können, aber dennoch viele seiner Vorteile bietet. So muss auch hier beispielsweise ein maximaler Heizwärmebedarf von 30 [kWh/(m²a)] erreicht werden und andere Kriterien eingehalten werden.

Die zentrale Taxonomie-Anforderung für einen maximal zulässigen Primärenergiebedarf wird durch die per Definition sehr hohe Energieeffizienz beim Passivhaus (Neubau) und bei EnerPHit (Renovierung) erfüllt.
Da unterschiedliche Berechnungsmethoden und Bilanzgrenzen für das Passivhaus und die Taxonomie-Bewertung (die sich wiederum auf die unterschiedlichen nationalen NZEB Definition der Mitgliedsstaaten bezieht) gelten, ist eine solch pauschale Aussage nicht ganz richtig. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nur selten Ausnahmen auftreten, in denen ein zertifiziertes Passivhaus oder EnerPHit Gebäude die Taxonomie-Anforderungen für Klimaschutz als wesentlichen Beitrag nicht nachweisen kann.
Taxonomiekonformitäts-Einschätzung Neubau | Passivhaus
1. Der Primärenergiebedarf eines neuen Gebäudes muss mindestens 10 Prozent unter den nationalen Werten für Niedrigstenergiegebäudestandards liegen.
Durch die per Definition sehr hohen Effizienzanforderungen des Passivhaus Standards sind 10% Einsparungen gegenüber des gesetzlichen Mindeststandards in der Regel mit Leichtigkeit erfüllt. Insbesondere durch die hohen Anforderungen an den Heizwärmebedarf (der einen hohen Anteil am Gesamtenergiebedarf ausmacht!) führt der Passivhaus Standard zu Gebäuden mit sehr hochwertiger Gebäudehülle und effizienten Lüftungskonzepten mit Wärmerückgewinnung, die ganz wesentlich zur Unterschreitung der Taxonomie-Primärenergiekennwerte beitragen.
Für eine differenzierte Einschätzung muss allerdings auf die unterschiedlichen Bilanzgrenzen und Berechnungsmethoden hingewiesen und geachtet werden.
Der Passivhaus und der EnerPHit Standard fordern feste Grenzwerte (maximal zulässige kWh/m² pro Jahr) für Heizung, Kühlung und Primärenergie. Der Primärenergiekennwert beinhaltet in diesem Fall alle Nutzungen im Gebäude, inklusive Haushaltsstrom bei Wohngebäuden. Der ausgewiesene Primärenergiebedarf auf einem Passivhaus-Zertifikat ist also immer höher als der auf dem gesetzlichen Energieausweis genannte Wert für dasselbe Gebäude. Wenn also die Grenzwerte beim Passivhaus/EnerPHit auf den ersten Blick höher erscheinen als die für die Taxonomie verwendenden Anforderungswerte, steht das nicht im Widerspruch mit der geforderten 10% Einsparung. Für einen Vergleich ist eine Anpassung der Bilanzgrenze notwendig.
Zudem ist im Detail bei der Definition der verwendeten Primärenergiefaktoren Vorsicht geboten, sowie bei eventuellen Unterschieden in den anzusetzenden Randbedingungen der Energiebilanzierung. An dieser Stelle unterscheiden sich die Methoden und auch die energetischen Grenzwerte der NZEB Anforderungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten.
In Deutschland wird für den gesetzlichen Nachweis das Referenzgebäudeverfahren verwendet, die eine Reduktion des Primärenergiebedarfs im Vergleich zu einem definierten Referenzgebäude fordert. Bei großvolumigen und kompakten Gebäuden führt dieses Verfahren zu Energieeffizienz, die primärenergetisch im Bereich des Passivhaus-Standards liegen kann. In solchen Fällen kann ist es nicht zwingend gegeben (und auch nicht unbedingt zielführend!) den bereits recht anspruchsvollen Primärenergiekennwert um weitere 10% zu unterschreiten. Bei kleineren Gebäuden, wie z.B. Einfamilienhäusern, Reihenhäusern oder auch kleinen Mehrfamilienhäusern, führt das gesetzliche Referenzverfahren zu weniger effizienten Lösungen. Hier ist das Passivhaus eine deutliche Steigerung bei der die Taxonomie-Anforderung in der Regel mit Leichtigkeit erfüllt wird.
2. Bei Gebäuden mit einer Fläche von mehr als 5 000 m² muss das Gebäude bei Fertigstellung auf Luftdichtheit und thermische Integrität geprüft werden, wobei jegliche Abweichungen von der in der Planungsphase festgelegten Effizienz oder Defekte an der Gebäudehülle Investoren und Kunden gegenüber offengelegt werden. Eine andere Möglichkeit sind robuste und nachvollziehbare Verfahren zur Qualitätsprüfung während des Bauvorgangs, als eine annehmbare Alternative zur Prüfung der thermischen Integrität.
Ganz unabhängig von der Gebäudegröße ist diese Qualitätssicherungsmaßnahme ein fester Bestandteil der Zertifizierung von Passivhaus- Neubauten oder EnerPHit-Sanierungen durch unabhängige Experten. So ist für die Zertifizierung ein Luftdichtheitstestergebnis vorgegeben sowie die Überprüfung aller Bauteilaufbauten und Bauteilanschlüsse auf wärmebrückenfreies bzw. wärmebrückenreduziertes Konstruieren. Die Umsetzung auf dem Bau wird als Teil der Zertifizierung photographisch dokumentiert und mit der Planung abgeglichen. Auf Wunsch werden bei machen Projekten auch vor Ort Baustellenbegleitung und –prüfung durchgeführt.
Bereits vor Beginn des Baus sind eine gute Planung und deren Dokumentation essentiell. Als Qualitätssicherungsmaßnahme bietet sich eine unabhängige Überprüfung der Energieeffizienzplanung an, ein so genanntes „Design Stage Approval“. Dieses ermöglicht eine Überprüfung der Erreichbarkeit von Passivhaus- oder EnerPHit Standard zu verschiedenen Planungsstadien und sollte von akkreditierten Passivhaus-Zertifizierern vor Beginn des Bau- oder Sanierungsvorgangs vorgenommen werden. Die tatsächliche Einhaltung des Passivhaus oder EnerPHit Standards wird allerdings erst nach Fertigstellung der Arbeiten mit Vorliegen eines gültigen Luftdichtheitstests und Einregulierungsprotokollen der Lüftungsanlage bestätigt und festgestellt.
3. Bei Gebäuden mit einer Fläche von mehr als 5000 m2 wurde das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial (GWP) des errichteten Gebäudes für jede Phase im Lebenszyklus berechnet und wird gegenüber Investoren und Kunden auf Nachfrage offengelegt.
Das Passivhaus ist ein erprobter und heute baupraktisch leicht umsetzbarer Baustandard. Es führt zu beträchtlichen Betriebskosteneinsparungen und zu gesicherten Energieeinsparungen in der Nutzungsphase. Der erforderliche Herstellungs-Energie-Mehraufwand, obwohl vorhanden, ist im Vergleich zu den im Lebenszyklus erzielten Einsparungen gering.
Sowohl der Primärenergieaufwand für den Stromeinsatz während der Nutzungsphase als auch die Graue Energie in den Baumaterialen gewinnen aber bei energieeffizientem Bauen an Bedeutung. Hier können sowohl durch weitere Effizienzsteigerungen bei der Baustoffherstellung als auch durch effizienten Materialeinsatz weitere Fortschritte erzielt werden; diese dürfen aber nicht auf Kosten wieder steigender Betriebsenergie gehen, denn letztere überwiegt immer noch.
Bei der heute gegebenen Neubauaktivität in Deutschland ist es keinesfalls so, dass zusätzlicher Neubau von was auch immer den Klimaschutz verbessert. In aller Regel aber erhöht ein Neubau auch heute die Gesamtemissionen, nur vereinzelt kann ein neu erstelltes Objekt die Emissionen verringern und dann nur in geringem Umfang. Selbst dann ist es in aller Regel günstiger, ein Bestandsgebäude minimalinvasiv auf ein gutes Energieeffizienz-Niveau zu modernisieren – die erzielten Klimagas-Emissions-Entlastungen sind dabei meist deutlich höher. In AkkP 60 hat das Passivhaus Institut gezeigt, dass ein Netto-Null- oder geringfügig-negativ-Emissionsgebäude mit gewissem Aufwand heute zwar realisierbar ist, aber dennoch nicht nennenswert andere Emissionen kompensieren kann. Sorgfältig geplant, sowohl bzgl. Herstellungsenergie als auch bzgl. des Betriebsenergiebedarfs ist deswegen nicht grundsätzlich jeder Neubau im Hinblick auf das GWP im Lebenszyklus schlecht.
Zur einfachen Berechnung und Nachhaltigkeitsbewertung stellt das Passivhaus Institut das MEETonline-Tool zur Verfügung. Dieses kann bei der nachhaltigen Planung und Optimierung von Bauprojekten als unterstützende Maßnahme genutzt werden. Durch den Vergleich verschiedener Außenbauteile ermöglicht es fundierte Entscheidungen hinsichtlich Energieeffizienz und Umweltauswirkungen für die Gebäudehülle zu treffen. Dazu werden die Bauteile auf Grundlage ihrer Herstellungs- und Betriebsenergie pro m2 Bauteil bewertet. Zusätzlich wird das Treibhausgaspotenzial (THG-Potenzial) ausgewiesen und Nutzende erhalten wertvolle Informationen und Tipps, die helfen, die Grundlagen der Ökobilanzierung zu verstehen und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.
Taxonomiekonformitäts-Einschätzung Renovierung | EnerPHit
1. Das Gebäude muss entweder den national geltenden gesetzlichen Anforderungen für größere Renovierungen erfüllen ODER eine Reduktion von mindestens 30% des Primärenergiebedarfs gegenüber dem unsanierten Gebäudezustand erreichen.
Bei Gebäudesanierungen zum EnerPHit Standard sollte, zumindest bei Komplettsanierungen, in der Regel immer die Einhaltung der Anforderungen der Taxonomie gegeben sein: Durch die Reduktion des Heizwärmebedarfs auf den EnerPHit Standard um einen Faktor 5 bis zu Faktor 10 ergibt sich eine Reduktion des Primärenergiebedarfs um den Faktor 2-5, also ca. 50% Einsparung oder mehr. Damit ist die Reduktionsanforderung gegenüber des unsanierten Gebäudes gegeben. In der Regel sind die EnerPHit Anforderungen auch deutlich strenger bzw. ambitionierter als die gesetzlichen Mindestanforderungen.
Auch eine schrittweise Sanierung kann je nach gewählter Maßnahme bereits zu erheblichen Einsparungen führen und bereits durch die erste(n) Maßnahme(n) im Einklang mit den Anforderungen der Taxonomie sein. Vor Beginn einer schrittweisen Sanierung ist ein Sanierungsfahrplan sinnvoll, nicht nur um über das langfristige Ziel und Taxonomiekonformität zu informieren, sondern vor allem um Lock-In Effekte zu vermeiden. Eine gute Möglichkeit ist an dieser Stelle die Vorzertifizierung als EnerPHit oder Passivhaus Gebäude auf Basis eines EnerPHit-Sanierungsplans.
Taxonomiekonformitäts-Einschätzung Erwerb und Eigentum von Gebäuden
1. Gebäude, die vor dem 31. Dezember 2020 gebaut wurden, müssen mindestens einen Energieausweis der Klasse A besitzen. Alternativ gehört das Gebäude zu den oberen 15 % des nationalen oder regionalen Gebäudebestands, ausgedrückt durch den Primärenergiebedarf im Betrieb.
2. Gebäude, die nach dem 31. Dezember 2020 gebaut wurden, müssen die oben genannten Kriterien für Neubauten erfüllen.
3. Für größere NiWo wird ein effizienter Betrieb durch Energiemanagement gefordert.
Thema Klimaanpassung
Vor allem der Beitrag zur „Klimafolgenanpassung“ ist dabei nicht zu übersehen. Die Sommerkomfort-Richtlinien des Passivhauses tragen z.B. zur Anpassung an den Klimawandel bei, indem sie sicherstellen, dass Gebäude auch unter steigenden Außentemperaturen und Hitzewellen komfortabel bleiben. Dies deckt sich mit den Zielen der EU-Taxonomie, die die Anpassung von Gebäuden an klimatische Veränderungen fordert. Der Sommerkomfort Stresstest, wie er im PHPP zu finden ist, ergänzt diese Anforderungen durch eine simulationsbasierte Überprüfung der Hitzebeständigkeit von Gebäuden, was eine langfristige Klimaanpassung gewährleistet.
Fazit: Passivhaus und EU-Taxonomie
Betrachtet man die oben genannten Beispiele von technischen Bewertungskriterien und überträgt diese auf die Arbeit verschiedener Akteure mit dem Passivhaus Standard wird deutlich: Die Einhaltung der Kriterien zur Erfüllung des Unterziels werden durch die Anwendung der Passivhaus und EnerPHit Standards deutlich einfacher! Dadurch ist das Passivhaus bei richtiger Anwendung vor allem für die Ziele „Klimaschutz“ und „Klimafolgen Anpassung“ von Wert. Dies gilt sowohl für Neubau als auch Sanierungen. Der Passivhaus und der EnerPHit Standard stellen einen geeigneten Lösungsweg dar, um taxonomiekonform zu bauen, zu sanieren oder zu investieren!
Beispiele Passivhaus als Nachweis zur Taxonomiekonformität
TÜV-Süd, welcher selbst als Dienstleister für die Einstufung der Wirtschaftsaktivitäten zur Taxonomie tätig ist, empfiehlt Passivhaus als Lösungsweg für Taxonomiekonformität. In einem Maßnahmenkatalog zur Erreichung der Klimaziele, unterstützt und forciert durch die Taxonomie Verordnung, fordert der TÜV-Süd Nachschärfungen in verschiedenen Bereichen des Referenzgebäudes, wie es im GEG gefordert wird. Vor allem im Bereich der Gebäudehülle wird eine bessere Dämmung in Richtung eines Passivhaus Standards gefordert. Dieser Standard sei insbesondere im Wohnungsbau anzustreben und auch auf Gewerbeimmobilien zu übertragen, heißt es in einem Whitepaper des TÜV.
Quellen
[Europäische Kommission. (o. D.)] EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten. Abgerufen von https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
[Europäische Kommission. (o. D.)] EU-Taxonomie-Kompass. Abgerufen von https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass/the-compass
[Europäische Union. (2020)] Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Festlegung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088. Amtsblatt der Europäischen Union, L 198, 13-43. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.DEU
[ Europäische Kommission. (o. D.)] Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch große Unternehmen und Gruppen. EUR-Lex. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=LEGISSUM%3A240601_2
[Europäische Union. (2023).] Delegierte Verordnung (EU) 2023/2485 der Kommission vom 17. Oktober 2023 zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates. Amtsblatt der Europäischen Union, L 2485. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202302485
[Europäische Union. (2021)] Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur Festlegung technischer Bewertungskriterien. Amtsblatt der Europäischen Union, L 2139. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=DE
[Europäische Union. (2020).] Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Festlegung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Amtsblatt der Europäischen Union, L 198, 13–43. Abgerufen von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=de
[Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. (2020)] Nachhaltiges Finanzwesen: Parlament nimmt Taxonomie-Verordnung an. Abgerufen von https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nachhaltiges-finanzwesen-parlament-nimmt-taxonomie-verordnung-2020-06-19_de
[Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. (2023)] Nachhaltige Finanzen: Konsultation zur Definition nachhaltiger Tätigkeiten. Abgerufen von https://germany.representation.ec.europa.eu/news/nachhaltige-finanzen-konsultation-zur-definition-nachhaltiger-tatigkeiten-2023-04-11_de
[Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). (o. D.)] Taxonomie und die rechtliche Grundlage – FAQs. Abgerufen von https://www.bmuv.de/faqs/taxonomie-und-die-rechtliche-grundlage
[Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). (o. D.)] EU-Taxonomie-Verordnung. Abgerufen von https://www.bmk.gv.at/green-finance/finanzen/eu-strategie/eu-taxonomie-vo.html
[Wirtschaftsprüferkammer. (o. D.)] EU Taxonomie-Verordnung – Regulatorische Anforderungen. Abgerufen von https://www.wpk.de/nachhaltigkeit/kompass/regulatorische-anforderungen/eu-tax-vo/#c18479
[EU Taxonomie Info. (o. D.)] EU Taxonomie Grundlagen. Abgerufen von https://eu-taxonomy.info/de/info/eu-taxonomy-grundlagen
[EU Taxonomie Info. (o. D.).] EU Taxonomie Grundlagen. Abgerufen von https://eu-taxonomy.info/de/info/eu-taxonomie-in-unternehmen
[Europäische Kommission. (o. D.)] EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten. Abgerufen von https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en.
[Wirtschaftsprüferkammer. (o. D.)] EU Taxonomie-Verordnung – Regulatorische Anforderungen. Abgerufen von https://www.wpk.de/nachhaltigkeit/kompass/regulatorische-anforderungen/eu-taxonomie-verordnung/
[Europäische Kommission. (2021)] Taxonomie Benutzerhandbuch. Abgerufen von https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/assets/documents/Taxonomy%20User%20Guide.pdf